Chapter structure
- 1.1 Eingrenzung des Feldes
- 1.2 Innovative Antwort auf eine Krise
- 1.3 Die Gründungsjahre
- 1.4 Ausbau in einer Situation des Umbruchs
- 1.5 Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus
- 1.6 Von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Max-Planck-Gesellschaft
- 1.7 Wissenschaft im Wirtschaftswunderland: Die Ära Butenandt
- 1.8 Ausblick
- Fußnoten
1.1 Eingrenzung des Feldes
Wissenschaft neigt, was ihre Vergangenheit betrifft, zu Vergesslichkeit. Sie macht sich frei von überholten Vorurteilen und lässt unfruchtbar gewordene Kontroversen ruhen. Die Diskussion zukünftiger Forschungsperspektiven der Max-Planck-Gesellschaft richtet sich vor allem an der Zukunft und ihren Herausforderungen aus. Dennoch mag es sich auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihren Blick in die Zukunft richten, lohnen, zu fragen, ob und was man aus der Vergangenheit lernen kann. Anknüpfend an die Tradition der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ist die Max-Planck-Gesellschaft heute eine einzigartige Institution der Grundlagenforschung, die weltweit Attraktivität und Vorbildwirkung besitzt. Auf welchen Erfahrungen und Prinzipien beruht diese Wirkung? Wie fanden die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) und dann die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) ihre Themen, wo wurden Durchbrüche erreicht und welche strukturellen Voraussetzungen haben erreichte Erfolge? Wie verhält sich die Dynamik der Wissenschaftsentwicklung zur gesellschaftlichen Dynamik? So einfach diese Fragen erscheinen mögen, so schwierig lassen sie sich beantworten, denn hier liegen wenig oder nur teilweise bearbeitete historische Forschungsprobleme und kaum entsprechende Ergebnisse vor. Schwerpunktmäßig widmet sich dieser Essay, der einige dieser genannten Probleme und Fragen etwas näher beleuchten soll, daher immer noch der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und der Anfangsphase der Max-Planck-Gesellschaft.
Eine historische Analyse und Reflexion der inneren und äußeren Bedingungen wissenschaftlicher Erfolge erscheint immer dringender – sowohl angesichts globaler Herausforderungen, die nur durch die Wissenschaft zu bewältigen sind, als auch angesichts historischer Veränderungen, denen die Rolle von Forschungsorganisationen wie die der Max-Planck-Gesellschaft unterworfen ist. Welche Rolle können zukünftig an nationalstaatliche Strukturen gebundene Institutionen wie die Max-Planck-Gesellschaft in einer globalisierten Wissenschaft spielen? Wie konkurrenzfähig ist die Max-Planck-Gesellschaft in Hinsicht auf Flexibilität und kritische Masse im Vergleich zu privatwirtschaftlich verfassten Forschungsinstitutionen in den USA? Wie verändert die Stärkung exzellenter Forschung an den Universitäten und die Ausweitung der institutionell geförderten Grundlagenforschung auf andere Forschungsinstitutionen die Arbeitsteiligkeit des deutschen Forschungssystems? Welche Aufgaben sollte die Max-Planck-Gesellschaft im weiteren Ausbau einer weltweiten, auf dem Internet beruhenden Forschungsinfrastruktur übernehmen? Ohne gründliche historische Untersuchungen, die Erkenntnisprozesse in den Kontext gesellschaftlicher Dynamik stellen, lassen sich solche Fragen nur oberflächlich beantworten. Dieser Aufgabe wird sich ab 2014 ein vom Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Peter
Mit dem vorliegenden Beitrag wollen und können wir künftigen Ergebnissen des neuen Forschungsprojekts nicht vorgreifen. Anhand ausgewählter historischer Beispiele wollen wir jedoch einige für die Max-Planck-Gesellschaft auch heute noch wirksame Strategien aufzeigen und die Fruchtbarkeit einer Perspektive deutlich machen, die zugleich die Dimension der inhaltlichen Herausforderungen von Erkenntnisprozessen als auch die ihrer Bewältigung im Rahmen institutionalisierter Forschung in den Blick nimmt. Darüber hinaus versuchen wir auch die Gefährdungen deutlich zu machen, die sich immer dann mit wissenschaftlicher Forschung verbinden, wenn diese moralische und gesellschaftliche Kontexte ausblendet, und sich stattdessen ausschließlich an immanenten Effizienzkriterien und äußeren Opportunitäten orientiert. Hans F.
Der Zeitraum, den wir dabei in den Blick nehmen, reicht von der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1911 bis zur Amtsübergabe von Präsident Adolf
Fortschritt ist kein additiver Prozess, sondern mit der Umstrukturierung von Wissenssystemen verbunden. Ein herausragendes Beispiel dafür ist die Entstehung der modernen Quanten- und Relativitätsphysik und die durch sie eingeführten Veränderungen der klassischen Begriffe von Raum, Zeit und Materie – mit weitreichenden Auswirkungen auf die gesamte Wissenschaft. Solche Innovationen sind oft nicht das Resultat spontaner Paradigmenwechsel, sondern einer langfristigen, konfliktreichen Zusammenführung heterogener Wissensbestände. Die Identifikation und Lösung der produktiven inneren Konflikte von Wissenssystemen verlangt oft eine andere Perspektive als die, die zu ihrer Erzeugung führte. Eine solche Sicht entsteht eher an der Peripherie als im Zentrum entsprechender Hauptentwicklungsströme. Die Rolle des Querdenkers Albert
Der langfristige, heterogene und diskontinuierliche Charakter des wissenschaftlichen Fortschritts und die Notwendigkeit, solche Außenseiterperspektiven einzubeziehen, stellt besondere Anforderungen an die Organisation von Forschung, die in einem Spannungsverhältnis zur unbestreitbar ebenfalls notwendigen Fortschreibung der Hauptströmungen steht. Der Erfolg der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft in den vergangenen hundert Jahren beruhte unter anderem darauf, dieser Herausforderung besser als andere Forschungsorganisationen gewachsen zu sein und oft als Katalysator für die Umstrukturierung von Wissenssystemen gedient zu haben. Die langfristige und nachhaltige Förderung solcher Umstrukturierungsprozesse durch institutionelle Forschungsförderung auch abseits des Mainstreams spielt hier eine Schlüsselrolle und erscheint als die eigentliche Mission der Max-Planck-Gesellschaft.
1.2 Innovative Antwort auf eine Krise
Das Humboldt’sche Bildungsideal der Einheit von Lehre und Forschung an den Universitäten und Hochschulen geriet Ende des 19. Jahrhunderts durch das zunehmende Tempo der Wissenschaftsentwicklung, durch industrielle Anforderungen, aber auch durch zunehmende nationale, wenn nicht nationalistische Einflüsse an Grenzen, die eine Gründung außeruniversitärer Forschungsinstitute nahelegten. Die Errichtung solcher selbständiger, ausschließlich der Forschung gewidmeter Institute entsprach gewissermaßen dem Zeitgeist der Jahrhundertwende, doch die weitere Ausgestaltung dieser Idee erwies sich als eine der bedeutendsten institutionellen Innovationen des 20. Jahrhunderts. Sie war zunächst einmal eine Konsequenz aus dem enorm anwachsenden Forschungsbedarf der Industrie und anderer Praxisbereiche, der von – mehr oder minder entwickelten – eigenen Industrielaboratorien zumindest im Grundlagenbereich nicht abgedeckt werden konnte. Sie war zugleich die Folge einer universitären Krise, die an die heutige Hochschulproblematik erinnert. Die Universitäten hatten sich zu Massenlehranstalten entwickelt, hielten aber am Ordinarienprinzip und einem ausschließlich am Lehrbedarf orientierten Stellenplan fest. Man war darüber hinaus zu der Einsicht gelangt, dass der wissenschaftliche und technische Fortschritt angesichts der immer kürzer werdenden Zeitspanne zwischen Entdeckung und Innovation permanent eines gewissen Vorrats an Ergebnissen naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung bedürfe, um wirksam umgesetzt werden zu können. Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gab es seit längerem. Als ein Beispiel in Deutschland mit nationaler und internationaler Ausstrahlung sei die 1887 gegründete Physikalisch-Technische Reichsanstalt genannt.3 Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es Überlegungen, eine ähnlich geartete Chemische Reichsanstalt zu schaffen – erste Pläne dazu entstanden um 1905.4
Es waren diese Überlegungen, die schließlich zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft führten. Doch stellte sich die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegenüber den bisherigen Konzepten als eine wesentliche institutionelle Neuerung dar. Sie hätte sich womöglich nicht durchsetzen lassen, hätte sich nicht ein Gelehrter vom Range des Theologen und Generaldirektors der Königlichen Bibliothek Adolf von
Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft stellte eine zukunftsweisende Form der Wissenschaftsorganisation dar, die strukturelle Offenheit wissenschaftlicher Gestaltung mit der Durchsetzungsfähigkeit institutioneller Entscheidungen auf neue Weise verband. Im Gegensatz zu anderen zeitgenössischen Institutionen, wie den Universitäten, den Akademien, den Reichsanstalten und den Labors der Industrie, konnten in ihrem Rahmen insbesondere interdisziplinäre Forschungsschwerpunkte unter maßgeblicher Mitwirkung der Wissenschaft gesetzt werden, die in den tradierten Strukturen der Universität keinen Raum hatten, oder nicht unter einer unmittelbaren Auftrags- und Anwendungsperspektive standen. Dabei konnten Politik und Gesellschaft zugleich so einbezogen werden, dass eine erfolgreiche Realisierung neuer Perspektiven erreicht werden konnte. Auch die Entwicklung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Ganzes wurde dabei von wissenschaftlicher Prioritätensetzung mitbestimmt. Die Möglichkeit der Autonomie von Wissenschaft innerhalb der Institute wurde zumindest prinzipiell ermöglicht, war jedoch naturgemäß stets gefährdet durch den Umstand, dass gesellschaftliche Kontexte Bedingungen und Spielräume für Wissenschaft setzten.5
Die genannten Hintergründe waren jedoch nicht nur ein deutsches Problem, sondern müssen im Zusammenhang mit der „Genese des Industrie- und modernen Interventionsstaats“6 als internationale Entwicklung – mit idiosynkratrischen Unterschieden – gesehen werden. Doch spielte die nationalistische Stimmungsmache gerade auch in Deutschland eine große Rolle. Man schürte Befürchtungen, dass man der internationalen Konkurrenz trotz der bisher international hoch angesehenen deutschen Lehr- und Forschungsanstalten in der Zukunft nicht mehr standhalten könnte. „Unsere Führung auf dem Gebiete der Naturforschung ist nicht nur bedroht, sondern wir haben dieselbe bereits in wichtigen Teilen an das Ausland abgeben müssen“, bediente
Zur innovativen Gründungsidee gehörte,
daß die zu schaffenden selbständigen, nicht den Universitäten und Akademien inkorporierten Forschungsinstitute auf den Gebieten, in denen intensive und aufwendige Grundlagenforschung nötig erschien, zwar mit Hilfe und, nach preußischer Tradition, unter der Aufsicht des Staates zustande kommen und arbeiten, aber doch weithin von privater Seite finanziert werden sollten.8
In seiner ausführlichen Denkschrift für Wilhelm
Forschungsinstitute brauchen wir, nicht eins, sondern mehrere, planvoll begründet und zusammengefaßt als Kaiser-Wilhelm-Institut für naturwissenschaftliche Forschung. [...] Es muß zu allgemeiner Anerkennung bei den Einsichtigen, in dem Staate und in dem ganzen Volke kommen, daß unser Betrieb der Naturwissenschaften eines neuen Hilfsmittels bedarf [...], nämlich der Forschungsinstitute, die rein der Wissenschaft dienen sollen.9
Sehr wichtig sei es,
die Zwecke der zu gründenden Institute nicht von vornherein zu spezialisieren, sondern in den weitesten Grenzen zu halten. Die besondere Arbeitsrichtung sollen die Institute durch die Persönlichkeit des sie leitenden Gelehrten erhalten sowie durch den Gang der Wissenschaft selbst. Die Institute müssen so angelegt und ausgestattet sein, daß sie die verschiedensten Untersuchungen ermöglichen; wenn man ihnen aber von vornherein spezielle Zwecke vorschreiben würde – sei es auch solche, die heute im Mittelpunkt des Interesses stehen –, würde man leicht auf einen toten Strang geraten, da auch in der Wissenschaft ein Acker sich oft überraschend schnell erschöpft und erst nach Jahrzehnten wieder mit Erfolg in Angriff genommen werden kann.10
Um den Wissenschaftlern die volle Konzentration auf diese Aufgaben zu ermöglichen, sollten sie frei von Lehrverpflichtungen sein (wobei es natürlich ihnen selbst überlassen bliebe, zu speziellen Themen Vorlesungen oder Seminare abzuhalten).
Die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft trug die typischen Züge ihrer Zeit und ihres Umfeldes. Sie resultierte aus Vorschlägen einzelner renommierter Gelehrter, Plänen der preußischen Staatsverwaltung und Interessen der Wirtschaft. Sie trat unter dem Protektorat des Kaisers ins Leben, ein Aspekt durch den sich die beteiligten Verantwortlichen zu Recht hohes gesellschaftliches Ansehen erhofften, dem sich auch die in Betracht kommenden Förderer aus Industrie- und Finanzkreisen nicht entziehen könnten.11 Dass
War die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft von vornherein durchaus als Institution des Reiches gedacht – auch das Protektorat des Kaisers sprach dafür – so war Wissenschaftspolitik im Reichsinnern nach wie vor Ländersache und blieb es auch in der Weimarer Zeit. Immerhin hatte sich Preußen, insbesondere durch die weitsichtige Politik des preußischen Ministerialdirigenten und einflussreichen Wissenschaftspolitikers Friedrich
1.3 Die Gründungsjahre
Die Umsetzung der Pläne zur Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft erfolgte mit erstaunlicher Geschwindigkeit: Drei Monate nach der feierlichen Ankündigung des Kaisers auf der 100-Jahrfeier der Friedrich-Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-Universität zu Berlin, fand am 11. Januar 1911 die konstituierende Sitzung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in der Königlichen Akademie der Künste am Pariser Platz statt. Am 23. Januar 1911 wurde Adolf von
Bereits im Gründungsjahr hatte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ihr Wirkungsfeld über die Grenzen Deutschlands hinaus verlagert und mit dem Kauf der Zoologischen Station Rovigno in Istrien am 1. Oktober 1911 die erste Institution im Ausland übernommen,15 die – trotz kriegsbedingter Schließung – bis 1921 von dem Breslauer Zoologen und Taxonomen Thilo
Im Oktober 1913 folgte mit der Eröffnung des KWI für experimentelle Therapie das erste biologische Institut in Dahlem. Institutsdirektor wurde August von
Als erstes Institut außerhalb Berlins wurde 1914 Franz
1.3.1 Administration und Finanzen
Die Institutsleitung setzte sich aus den Direktoren, dem Kuratorium und dem wissenschaftlichem Beirat zusammen. An der Spitze der Gesellschaft stand der Präsident und ihm zur Seite ein Generalsekretär. Der Senat, der Verwaltungsausschuss, die Haupt- bzw. Mitgliederversammlung bildeten die Organe der Gesellschaft. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war die Präsidententätigkeit ehrenamtlich. Der Sitz der Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft befand sich zunächst in der Königlichen Bibliothek24 und von 1922 bis 1945 im Berliner Schloss.
Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde man aufgrund einer – natürlich möglichst hohen – finanziellen Zuwendung, die im Allgemeinen einen Aufnahme- und zumindest einen jährlichen Mitgliedsbeitrag umfasste: die Aufnahmegebühr betrug mindestens 20.000 Mark (was heute etwa 100.000 Euro entspricht), der Jahresbeitrag 1.000 Mark.25 Bis zum Ersten Weltkrieg zählte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft etwa zweihundert, in den 1920er Jahren dann an die tausend Mitglieder. Die jährliche Mitgliederhauptversammlung bildete das höchste Beschluss fassende Gremium. Zu den 79 Gründungsmitgliedern, die sich im Januar 1911 zur Gründungsversammlung eingefunden hatten, gehörten solch illustre Persönlichkeiten wie der Berliner Unternehmer und Kunstmäzen Eduard

Abb. 1.2: Hilde
Selbst aus dieser Gruppe schwerreicher Mäzene ragte das finanzielle Engagement des Bankiers Leopold
Entscheidend für die Leitung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft waren aber Senat, Verwaltungsausschuss/-rat und die zunehmend ihren Einfluss ausbauende Generalverwaltung. Anfangs bestand der Senat aus 20 Mitgliedern, von denen zehn von der Mitgliederversammlung gewählt und zehn vom kaiserlichen Protektor ernannt wurden. In den 1920er Jahren wuchs die Mitgliederzahl auf 44 an, inzwischen bestimmte der preußische Staat die Hälfte der Mitglieder, außerdem wurden zwei, später drei Institutsdirektoren in dieses Gremium berufen. Der Verwaltungsrat wurde aus Mitgliedern des Senats bestimmt. Für die Verwaltung der einzelnen Institute war ein Kuratorium zuständig, das ebenfalls aus Vertretern von Staat, Finanzwesen und Wissenschaft bestand. Zum Wissenschaftlichen Mitglied der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde man aufgrund wissenschaftlicher Leistungen durch den Senat ernannt.28 Institutsdirektoren und Wissenschaftliche Mitglieder waren formal gleichgestellt.
Als Rechtsform war der „eingetragene Verein“ gewählt worden. Man versuchte in den Anfangsjahren, mit einem Minimum an Verwaltungsaufwand auszukommen. Der Verwaltungsausschuss bestand aus dem Präsidenten, zwei Vizepräsidenten, zwei Schriftführern und zwei (ab 1925 drei) Schatzmeistern, und diese Tätigkeiten waren ehrenamtlich. Zunächst war Ernst von
Nachdem der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit dem Untergang der Monarchie der kaiserliche Schirmherr abhanden gekommen war, trugen Satzungsänderungen – weniger von den mehrheitlich konservativen Mitgliedern der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft betrieben als vom Reichs- sowie Preußischen Staatsministerium – Ende 1921 der neuen politischen Situation Rechnung; der Name wurde jedoch beibehalten. Sowohl wuchs durch die neue Satzung die Einflussmöglichkeit des Staates als auch der Wissenschaftler.34 Das neue Mitgliederabzeichen, auf dem das Konterfei des Kaisers durch die
Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft glich eher einem Dachverband unterschiedlich strukturierter Institute als einem straff geleiteten Großunternehmen. Das war nicht zuletzt den unterschiedlichen Finanzierungsverhältnissen der einzelnen Institute geschuldet, wie auch der weitgehenden Eigenverantwortung, die man den Direktoren zugestand. Ab 1929 gab es auf Anregung
Von Anfang an stellte die Finanzierung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ein Problem dar. Zwar sollte sie außerhalb traditioneller Bahnen erfolgen – das heißt vornehmlich auf privatem Wege durch Mäzene wie den Bankier Leopold
Die neue politische Situation nach dem Krieg und die zunehmende Inflation bewirkten schließlich, dass auch das Reich einen beachtlichen Zuschuss gewährte (Preußen und das Deutsche Reich sicherten die Finanzierung des laufenden Betriebes der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft etwa im Verhältnis 50:50). Hinzu kamen unter anderem Mittel aus der neu entstandenen Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft42 und ab Mitte der 1920er Jahre von der Rockefeller-Stiftung. So konnte die Leitung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in einem internen Papier Ende 1923 feststellen, dass „kaum daran gezweifelt werden [könne], dass Reich und Staat auch in Zukunft die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihre Institute in ausreichendem Maße unterstützen werden.“43 Und 1930 formulierte
Die Finanzierungsprobleme der Gesellschaft in den 1920er Jahren veranlassten Präsident und Generaldirektor sowohl dem Preußischen Staat als auch dem Reich gegenüber zu taktieren. Einerseits bemühte man sich, möglichst hohe Zuwendungen vom Staat zu erhalten – andererseits pochte man auf den Status einer privaten Gesellschaft, wenn der Staat, zugunsten einer einheitlichen Kultur- und Wissenschaftspolitik, mehr Einfluss in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft verlangte. Durch gezielte Mitgliederwerbung vor allem unter Politikern und Industriellen war es
Dessen ungeachtet konnte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nach dem Krieg bis zum Höhepunkt der Inflation noch erheblich wachsen. Sechs neue Institute kamen in diesem Zeitraum dazu: die bereits 1915 unter Beteiligung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gegründete Modellversuchsanstalt für Aerodynamik in Göttingen unter Ludwig
1.3.2 Selbstverständnis
Ein wesentlicher Grundsatz der Forschungsorganisation wurde – und ist bis heute – das Harnack-Prinzip. Mutmaßlich wurde es von
Zum Selbstverständnis der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zählte ebenso das heute als Subsidiaritätsprinzip bezeichnete Bestreben, Forschungsinstitute auf den neuen Gebieten zu gründen, die abseits der auch an anderen Einrichtungen – vor allem an den Universitäten – verfolgten Hauptströmungen lagen und nur wenig in deren Strukturen passten. So konnten auch komplexe Institutsstrukturen entwickelt werden, mit denen die organisatorischen Möglichkeiten der Hochschulen überfordert gewesen wären. Zudem gehörten in diesen Bereich Gebiete, die wegen eines hohen Ausrüstungsaufwandes nicht an Hochschulen betrieben werden können. In der späteren Entwicklung der Max-Planck-Gesellschaft wurde die Frage, inwieweit die Großforschung zu ihrem genuinen Aufgabenbereich gehöre, immer wieder kontrovers diskutiert – eine Kontroverse, die in engem Zusammenhang mit einem sich zunehmend ausdifferenzierenden Wissenschaftssystem stand, wie es erst in der Bundesrepublik etabliert werden sollte.56 Die Wissenschaftler der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft sollten frei von Lehrverpflichtungen und Hochschulzwängen forschen können. Allerdings sollten sie durch vielfältige personelle sowie auch organisatorische Verflechtungen mit den Hochschulen und anderen Einrichtungen in die Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses eingebunden sein. Naturgemäß musste das Subsidiaritätsprinzip in einer sich differenzierenden akademischen Landschaft stets neu definiert werden. Bereits in der Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft spielte dieses Prinzip auch eine Rolle als Chance für Wissenschaftler/innen, die nicht im Mainstream tätig waren oder für die es an anderen akademischen Institutionen Aufstiegsbarrieren gab, wie etwa jüdische Forscher und Frauen.
Charakteristisch für die Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war ferner die Forschung auf vielversprechenden Grenzgebieten, in denen die fruchtbaren Konflikte zwischen verschiedenen Bereichen der Wissenschaft angesiedelt sind. Das Harnack-Prinzip, die Subsidiarität und die Interdisziplinarität der institutionell geförderten Grundlagenforschung sind bis heute wesentliche forschungspolitische Grundsätze der Max-Planck-Gesellschaft, auch wenn es immer wieder Versuchungen gab und gibt, politischen Wünschen nach einer stärker programm-orientierten Forschung nachzugeben. Allerdings gehört auch die – jedenfalls dem Selbstverständnis nach – ausschließliche Konzentration auf die Grundlagenforschung zu den Charakteristika der Max-Planck-Gesellschaft, die noch nicht in gleichem Maße für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft galten und sich erst im Zusammenhang der Entstehung des hochdifferenzierten und arbeitsteiligen Wissenschaftssystems der Bundesrepublik entwickelten.
Die außerordentliche Langfristigkeit, in der institutionell geförderte Grundlagenforschung wirksam werden kann, wird eindrucksvoll durch die Kontinuität der Katalyseforschung am KWI für Physikalische Chemie und Elektrochemie, dem heutigen Fritz-
1.4 Ausbau in einer Situation des Umbruchs
Der Erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien. Vorausgegangen war die Julikrise, deren Auftakt der „Blankoscheck“ von Wilhelm
Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hatte sich zu diesem Zeitpunkt gerade einigermaßen konsolidiert. Auch die Mehrheit ihrer Mitarbeiter stimmte in die damalige patriotische Begeisterung ein. Führende Vertreter der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft60 gehörten zu den Unterzeichnern des Aufrufs an die Kulturwelt61 mit dem sich 93 prominente Wissenschaftler, Künstler und Schriftsteller im Oktober 1914 mit dem deutschen Militarismus solidarisierten und Kriegsgräuel leugneten. Das so genannte Manifest der 93 hatte katastrophale Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen der deutschen Wissenschaft, die weit über deren Trübung durch den Krieg hinausgingen (zumal die meisten der unterzeichneten Wissenschaftler auch nach dem Kriege nicht bereit waren, sich davon zu distanzieren). Die von Georg Friedrich

Abb. 1.3: In der Zwischenwelt von Militär und Wissenschaft: Fritz
Der Krieg zeigte unterschiedliche Auswirkungen auf die einzelnen Institute, von denen viele infolge des Kriegs große Teile ihres Personals verloren. Anderen hingegen bot der Krieg Gelegenheit zum weiteren Ausbau. So konnte beispielsweise
Auch andere Institute waren am Krieg beteiligt. Die chemische Abteilung des KWI für experimentelle Therapie arbeitete beispielsweise an der Entwicklung von Ersatzstoffen für Seife. Am KWI für Kohlenforschung wurde ebenfalls an Rohstoffersatzverfahren gearbeitet, unter anderem an synthetischen Treibstoffen. Am KWI für Arbeitsphysiologie befasste man sich mit Fragen der Kriegsernährung und Ersatzfutterstoffen. Insgesamt fielen die Beiträge der einzelnen Kaiser-Wilhelm-Institute zur Kriegswirtschaft und Rüstung sehr unterschiedlich aus. Das lag zum einen daran, dass die meisten Institute ihre Arbeit überhaupt erst kurz vor Kriegsbeginn aufgenommen hatten, zum anderen, dass kein klares kriegswirtschaftliches Gesamtkonzept bestand. Doch mehrheitlich folgten die einzelnen Institutsleiter bereitwillig der
Nach Kriegsende befürchtete
Die Orientierung an großen technischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Herausforderungen konnte dennoch produktiv sein, denn sie zwang zur Mobilisierung und Bündelung von Forschungsmethoden auch jenseits traditioneller Disziplingrenzen. Die Einbindung der Wissenschaft in kurzfristige Erwartungshorizonte von Wirtschaft und Politik wirkte sich dagegen meist hemmend und auch zerstörerisch auf die Grundlagenforschung aus. So regten während des Kriegs zutage getretene Rohstoffprobleme die Gründung weiterer Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft an. Beispielsweise wurde 1919
Auch außerhalb Berlins beziehungsweise Preußens wurden neue Institute gegründet, um eine stärkere Verankerung im Reich zu erreichen und finanzielle Mittel auch aus anderen Ländern zu erschließen, wie zum Beispiel 1921 das KWI für Lederforschung in Dresden und 1924 das KWI für Strömungsforschung in Göttingen. Eine Stiftung zu Ehren des schlesischen Unternehmers Fritz von
Um dennoch eine gewisse Planmäßigkeit in die Institutsgründungen zu legen, unterschied Generalsekretär
Etwas anders lagen die Verhältnisse beim KWI für Metallforschung, das 1920 zunächst in Neubabelsberg bei Berlin gegründet und 1923 in Gebäude der Staatlichen Materialprüfungsanstalt in Berlin-Dahlem überführt wurde. Es arbeitete vor allem auf dem Gebiet der Nichteisenmetalle und leistete Pionierarbeit in der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (unter anderem mit Röntgenstrukturuntersuchungen). Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten stand es allerdings Anfang der 1930er Jahre vor der Schließung. Es gelang der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft jedoch, die Unterstützung der Nichteisenmetall-Industrie im süddeutschen Raum zu gewinnen und das KWI in Stuttgart anzusiedeln, wo es 1935 neu eröffnet wurde.71
Dank des ökonomischen Aufschwungs nach Inflation und Überwindung der internationalen Isolation infolge des Ersten Weltkriegs setzte Mitte der 1920er Jahre auch in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft eine neue Entwicklungsphase ein, die mit neuen Institutsgründungen einherging. Dabei wandte sich die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft verstärkt auch der medizinischen Forschung zu. So erhielten die bereits bestehenden Institute für Arbeitsphysiologie, Psychiatrie und Hirnforschung Neubauten, und 1927 wurde in Berlin-Dahlem ein KWI für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenik unter Leitung des Mediziners und Rassenhygienikers Eugen
Insgesamt folgten aber die Neugründungen ab Mitte der 1920er Jahre keiner längerfristigen wissenschaftspolitischen Strategie, sondern waren eher von finanzpolitischem Opportunismus geprägt. So ging die Gründung des KWI für Hirnforschung unter der Leitung von Oskar
Ungeachtet der fehlenden langfristigen Forschungsplanung –
Der Erfolg der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bei ihren Personalentscheidungen zeigte sich auch in Emil
Die Weltwirtschaftskrise 1929 brachte auch die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in finanzielle Schwierigkeiten, selbst wenn diese nicht so stark von Kürzungen betroffen war wie andere gesellschaftliche Bereiche.76 Dennoch stieß die seit Mitte der 1920er Jahre verfolgte Wachstumsstrategie erneut an Grenzen. In dieser finanziellen Situation sprang die Rockefeller-Stiftung ein, die unter anderem Otto
Die Einweihung des ersten, genuin von vorneherein interdisziplinär angelegten Instituts der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, des KWI für medizinische Forschung,79 anlässlich der 18. Hauptversammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft konnte
Die ersten Amtsjahre Plancks standen im Zeichen der Weltwirtschaftskrise. Nach einem Höhepunkt in den öffentlichen Zuschüssen im Haushaltsjahr 1929/30 sanken diese zum Geschäftsjahr 1932/33 um knapp 40 Prozent.83 Insofern konzentrierten sich die Bemühungen von
1.5 Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus
1.5.1 Die historische Verantwortung der Max-Planck Gesellschaft
1997 setzte der damalige Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Hubert
Das Forschungsprogramm der Präsidentenkommission „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“ wurde im März 1999 mit einer viertägigen internationalen Konferenz unter dem Titel „Bestandsaufnahme und Perspektiven der Forschung" eröffnet. In den folgenden sechs Jahren erforschte ein Team aus unabhängigen Historikerinnen und Historikern so vollständig und vorbehaltlos wie möglich das Verhältnis der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zum NS-System, das wissenschaftliche, politische und wissenschaftspolitische Handeln ihrer Repräsentanten und Wissenschaftler während der Zeit des Nationalsozialismus sowie die Folgen und Auswirkungen dieses Handelns auf die Max-Planck-Gesellschaft. Die aus dieser Forschungsleistung hervorgegangen 18 Monographien und Sammelbände sowie 28 Preprints88 haben neue Standards in der historischen Forschung gesetzt, auf die wir in unseren Ausführungen dankbar zurückgreifen.89
Im Juni 2001 fand im Fritz-
1.5.2 Machtwechsel und „Selbstgleichschaltung“: Die Ära Planck
Ich hoffe sehr, dass die bevorstehende Jahresversammlung der K.W.G. Veranlassung geben wird, die persönlichen Beziehungen zu den Ministern des Reiches und der Länder womöglich noch enger zu gestalten als sie es bei den früheren Regierungen waren.93
Auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 reagierte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft unter ihrem Präsidenten Max

Abb. 1.4: Albert
Das am 7. April 1933 erlassene „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“, das die Entfernung jüdischer und politisch missliebiger Beamter zum Ziel hatte, wurde innerhalb der Gesellschaft zügig und rückhaltlos umgesetzt. Im Herbst 1933 legte die Generalverwaltung dem Reichsministerium des Inneren eine „Nachweisung aller Angestellten [...] über ihre arische oder nichtarische Abstammung“ vor.98 Demnach waren von den 1.061 Mitarbeitern 54 „nichtarisch“.99 Insgesamt betraf dies jedoch überhaupt nur 18 Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, weder im
Albert
Solange mir eine Möglichkeit offensteht, werde ich mich nur in einem Lande aufhalten, in dem politische Freiheit, Toleranz und Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz herrschen. [...] Diese Bedingungen sind gegenwärtig in Deutschland nicht erfüllt. Es werden dort diejenigen verfolgt, die sich um die Pflege internationaler Beziehungen besonders verdient gemacht haben, darunter einige der führenden Künstler.111
Bei seiner Rückkehr nach Europa verzichtete er am 28. März in der deutschen Botschaft in Brüssel auf die deutsche Staatsbürgerschaft und erklärte auch am gleichen Tag seinen Austritt aus der Akademie der Wissenschaften. Am 1. April erklärte der Beständige Sekretar der Akademie, Ernst
Akademien haben in erster Linie die Aufgabe, das wissenschaftliche Leben eines Landes zu fördern und zu schützen. Die deutschen gelehrten Gesellschaften haben aber – so viel mir bekannt ist – es schweigend hingenommen, dass ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Gelehrten und Studenten sowie aufgrund einer akademischen Ausbildung Berufstätigen ihrer Arbeitsmöglichkeit und ihres Lebensunterhaltes in Deutschland beraubt wird. Einer Gesellschaft, die – wenn auch unter äusserem Druck – eine solche Haltung annimmt, möchte ich nicht angehören.116
Im Zuge der „Selbstgleichschaltung“ wurde auch der KWG-Senat auf seiner Jahresversammlung im Mai 1933 neu gebildet: Mit Ausnahme von Franz von
1.5.3 Im Zeichen des Erfolgs: Die Netzwerke von Glum und Telschow
Wie die folgenden Abschnitte zeigen werden, ist die Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im NS-Staat die eines bemerkenswerten wissenschaftspolitischen Erfolges und weniger – wie häufig und insbesondere gerne von Zeitzeugen kolportiert – die eines Kampfes um das institutionelle Überleben.119 Diese Darstellung folgte der Logik, dass aufgrund des anti-intellektuellen Charakters des
Überlegungen der neuen Regierung in den Jahren 1933/34, die Gesellschaft aufzulösen und die einzelnen Institute anderen interessierten Einrichtungen zu übergeben, hingen unter anderem damit zusammen, dass die Kompetenzen der Länder im Reich zusammengeführt werden sollten und die Verantwortung für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vom Reichsinnenministerium auf das von Bernhard
In den Jahren 1937 bis 1945 bescherte
Anders als
1.5.4 Kriegsrelevante Forschung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
im Nationalsozialismus
Mit der NS-Aufrüstungspolitik erlebten Agrar- und Rüstungsforschung in Deutschland nach dem Machtwechsel 1933 einen erheblichen Aufschwung. Die bis dato 29 Institute und Forschungsstellen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wuchsen in den folgenden Jahren auf 42 an, unter anderem nahmen 1937 das KWI für Biophysik in Frankfurt am Main unter Boris
Die Bewertung der kriegsrelevanten Forschung in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, dieser „Interessenskoalition zwischen Wissenschaft und Macht“126, stellt eine besondere Herausforderung für die Wissenschaftsgeschichte dar und war ein inhaltlicher Schwerpunkt der Präsidentenkommission zur „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“. Dabei konnte es nicht um das bloße Abarbeiten eines Institutionenrasters gehen,127 vielmehr standen Aspekte wie „Gemeinschaftsforschung“ und Forschungsorganisation, Ressourcenaustausch und Wissenstransfer zwischen Wissenschaft, Militär und Industrie im Vordergrund.128 Auf der Grundlage der Forschungen dieser Kommission verfügen wir heute über ein detailliertes Bild, das das ganze Ausmaß zeigt, in welchem die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, ihre Präsidenten
Vierjahresplan, Autarkiepolitik und Ostexpansion
Im September 1936 wurde Hermann
Die nationalsozialistische Autarkiepolitik verfolgte als eines ihrer Hauptziele, Deutschland unabhängig von Nahrungsmittelimporten aus Übersee zu machen, ein Ziel das auch aus der Weltwirtschaftskrise resultierte.133 Neben der Kriegsfähigkeit stellte die Autarkie der deutschen Wirtschaft den anderen zentralen Programmpunkt des Vierjahresplanes dar. Die Nahrungsmittelsicherheit für Deutschland sollte u.a. mit Hilfe der Züchtungsforschung im Kontext militärischer Ostexpansion geschaffen werden. Die noch in den Anfängen steckende Genetik sollte dazu beitragen, „Obst, Gemüse und Getreide sowie Faserpflanzen widerstandsfähiger gegen Pflanzenkrankheiten, Frost und Dürre zu machen“134– und Deutschland mit dieser Produktivitätssteigerung der Pflanzenzüchtung unabhängig von Importen.
Die deutsche Autarkieforschung nutzte die Eugenik, um auch Pflanzen und Tiere „vor Degeneration zu schützen“, wobei es sich jedoch um kein NS-Spezifikum handelte, denn auch die USA und die Sowjetunion griffen in ihrem Streben nach Autarkie auf die Rassenhygiene zurück. Die Wissenschaftler/innen begriffen den Krieg als Möglichkeit, ihre Forschung weiterzuentwickeln, da dieser ihnen mit der Ostexpansion die Möglichkeit bot, Zugriff auf Gebiete oder auch osteuropäische Forschungsstationen, und damit beispielsweise botanisches Material, zu erlangen, die ihnen lange nicht zugänglich gewesen waren. Wilhelm
Rüstungsforschung
Bereits
Im Dezember 1938 eröffnete die unerwartete Entdeckung der Urankernspaltung am KWI für Chemie nicht nur die völlig neue Perspektive der nuklearen Energiegewinnung. Sie bereitete auch den Weg für neuartige militärische Technologien mit ungeahnten Konsequenzen. Otto
Bereits kurz nach Kriegsbeginn wurde mit Unterstützung aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ein Uranprojekt ins Leben gerufen, um die technischen und militärischen Anwendungen dieser Entdeckung auszuloten und umzusetzen. Das KWI für Physik, das Physikinstitut im KWI für medizinische Forschung und das KWI für Chemie waren daran beteiligt. Abweichend von oft anders lautenden Nachkriegsdarstellungen – in denen gerne die „reine Luft der wissenschaftlichen Forschung“140 besungen wurde –, widmeten sich die beteiligten Forscher durchaus zielbewusst ihrer Arbeit und nutzten jedenfalls die Chance, auf diesem Wege unter anderem an modernste Ausrüstungen zu gelangen.
Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die Geschichtsforschung mit der umstrittenen Rolle von Werner
Nach den Plänen des Heereswaffenamtes sollte das KWI für Physik zum Zentrum der Forschungen des Uranvereins werden, allerdings sollte die Forschung dezentral auf mehrere Institutionen verteilt bleiben. Der Institutsdirektor
Das KWI für Physik war unter die formelle Leitung des Heereswaffenamtes gestellt worden, als dessen Vertreter der Physiker Kurt
In der Diskussion um die Frage, wie weit die Wissenschaftler bereit waren, für
Was wollte WernerHeisenberg mit seinem Besuch bei Niels Bohr im September 1941? Ist sein Besuch ein Beweis dafür, daß Heisenberg mit den Nationalsozialisten kollaborierte, daß er die Absicht hatte, Bohr auszubeuten und dessen eventuelles Wissen über ein Atombombenprojekt der Alliierten abzuschöpfen? Oder wollte Heisenberg – ganz im Gegenteil – Hitler Widerstand leisten, indem er über Bohr die Alliierten vor der Möglichkeit einer deutschen Atombombe warnte?“142
Die Nachkriegserinnerungen von
Nach
Als Katalysator für diese jahrzehntelange kontroverse Debatte betrachtet
Die Geschichte wird festhalten, daß die Amerikaner und die Engländer eine Bombe bauten und daß zur selben Zeit die Deutschen unter demHitler-Regime eine funktionsfähige Maschine [sc. einen Reaktor] herstellten. Mit anderen Worten, die friedliche Entwicklung der Uranmaschine fand in Deutschland unter dem Hitler-Regime statt, während die Amerikaner und die Engländer diese gräßliche Kriegswaffe entwickelten.147
Ein Beispiel für die frühe Remilitarisierung der Forschung, die im Zuge der nationalsozialistischen Aufrüstung forciert wurde, stellt das Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie dar. Anders als in der historischen Forschungsliteratur lange angenommen, beschränkten sich das Preußische Kultusministerium und das Reichswehrministerium in ihrem Vorgehen gegen das
1939 erhielt
Auch bei
Richard
Als prominente Wissenschaftsorganisatoren hatten
Internationale Beziehungen: Die Rockefeller-Stiftung
Trotz Selbstgleichschaltung, Vertreibung der jüdischen Wissenschaftler/innen und zunehmender Rüstungsforschung blieben bis zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die internationalen Kontakte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, insbesondere zur anglo-amerikanischen scientific community, noch erstaunlich ungestört. Dies belegen die Annalen des
Doch Plancks Befürchtungen, dass sich die Entlassungen auf die Beziehungen zur Rockefeller-Stiftung auswirken könnten, sollten sich zumindest zum Teil bewahrheiteten. Die Stiftungsvertreter waren unsicher in Bezug auf die Vorgänge 1933 in Deutschland und reagierten sehr unterschiedlich darauf. Um sich ein Bild der wissenschaftspolitischen Ziele der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft machen zu können, waren sie auf die Informationen der Wissenschaftsfunktionäre angewiesen. Während manche, wie unter anderem von Oskar
Dennoch zog sich die Rockefeller-Stiftung nur allmählich aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Deutschland zurück, noch 1935 finanzierte sie den Bau des KWI für Physik mit 1,5 Mio. Reichsmark.174 Dafür und für die damit einhergehende implizite Billigung der Wissenschaftspolitik der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft geriet die Stiftung in den USA zunehmend in die Kritik.175
1.5.5 Industriekapitäne: Bosch und Vögler
Carl
1936 feierte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ihr 25-jähriges Bestehen, und Max
Aus Sorge um die künftige wirtschaftspolitische Absicherung der Treibstoffsynthese im Falle eines Regierungswechsels ließ
Den Antisemitismus der NSDAP und die gegen Juden gerichteten Verfolgungsmaßnahmen des NS-Staates lehnte
Im ersten Halbjahr seiner Präsidentschaft hatte
Wie sehr
Interregnum
Zum Zeitpunkt des Todes von
Diese Machtakkumulation erlaubte es
Doch ungeachtet des reibungslosen Ablaufs der Amtsgeschäfte unter
Albert Vögler, der starke Mann aus dem Revier
Die Kandidaten, die bei der neuerlichen Präsidentensuche zur Diskussion standen, waren
Eine scheinbar greifbare Übergangslösung, die
Der Industriemagnat
Eine enge Beziehung verband ihn hingegen mit Albert
1.6 Von der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Max-Planck-Gesellschaft
1.6.1 Weichenstellungen
Aus den Trümmern der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft entstand die Max-Planck-Gesellschaft. Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war weitgehend Teil des NS-Systems geworden, mit dem sie faktisch auch zugrunde ging. Doch ihr Modell einer maßgeblich durch die Wissenschaft selbst bestimmten Schwerpunktsetzung institutioneller Forschungsförderung sowie vor allem ihre einzelnen Institute bestanden fort. Das Modell Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft galt allgemein als Erfolgsmodell, das sich in ihren Instituten manifestierte, nicht zuletzt belegt durch die vergleichsweise hohe Zahl an Nobelpreisen (25 bis 1945), mit denen KWG-Wissenschaftler ausgezeichnet worden waren.207 Die ausschließliche Konzentration auf die Grundlagenforschung hingegen stellte keine fest gefügte Tradition der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft dar. Ihre nunmehr dezidierte Betonung ergab sich zunächst eher aus dem Nachkriegsbestreben, sich von der militärischen Forschung insbesondere der NS-Zeit abzugrenzen und damit zugleich ein Argument für den Erhalt dieser Forschungsgesellschaft zu liefern. Erst durch die Differenzierung des Wissenschaftssystems in der Bundesrepublik wurde die Grundlagenforschung zu einem Proprium der Max-Planck-Gesellschaft, zu deren Selbstverständnis heute der Leitsatz von Max
Zum Erbe der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gehörten vor allem die personellen und sachlichen Forschungskapazitäten, die sich nach den Zerstörungen des Krieges erhalten hatten. Viele der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die überlebt hatten, erinnerten sich an die Qualität und Freiheit der Forschung, die ihnen die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in besseren Zeiten ermöglicht hatte und setzten sich auch deshalb für den Erhalt dieser besonderen Form der Forschungsförderung ein. Der Selbstverständlichkeit, mit der viele von ihnen sich in den Dienst eines totalitären Staates, zu dessen Teil die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft geworden war, gestellt hatten, war jedoch der Boden entzogen worden, und neue Selbstverständlichkeiten zunächst noch nicht in Sicht.
Die Kontinuität zwischen Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war jedenfalls keineswegs eine Selbstverständlichkeit, sie ging aus einem Ringen um die Rolle von Wissenschaft in einem tiefgreifend veränderten Kontext hervor, und kam nur mit der Unterstützung der Alliierten, insbesondere der britischen Besatzungsmacht, zustande. Die Kontinuität, die letztlich das Ergebnis dieses Ringens war, bedeutete die „Chance für einen Neubeginn“, genau wie es Richard von
Weichen für die spätere Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft waren bereits in den letzten beiden Kriegsjahren gestellt worden. Infolge der Luftangriffe ab 1943 wurden Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vor allem aus Berlin, aber auch aus anderen Ballungsräumen an vermeintlich kriegssichere Standorte verlegt. So wurden das KWI für Physik mit seinem Uranprojekt nach Hechingen und Haigerloch auf der Schwäbischen Alb ausgelagert,210 das KWI für Biochemie sowie das KWI für ausländisches und internationales Privatrecht nach Tübingen und das KWI für Chemie (das im Februar 1944 einen Bombentreffer erhalten hatte) nach Tailfingen in Württemberg, aber auch das KWI für Eisenforschung von Düsseldorf nach Clausthal im Harz, um nur einige Beispiele zu nennen.211 In den letzten Kriegsmonaten ging es bei diesem Auszug nach Südwesten auch darum, im Fall einer deutschen Niederlage nicht im Bereich der sowjetischen Armee zu verbleiben. Diese Institute bildeten nach Kriegsende im Mai 1945 weitgehend die Keimzellen für den Wiederaufbau der Gesellschaft.
Mit der Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945 übernahmen die Siegermächte durch ihre Oberbefehlshaber die Regierungsgewalt in den vier Besatzungszonen. Mitte 1949 gingen die drei Westzonen in der Bundesrepublik Deutschland auf, während aus der sowjetischen Besatzungszone im Oktober 1949 die Deutsche Demokratische Republik wurde. Beide Staaten waren jedoch damit noch nicht souverän; das Besatzungsrecht wirkte in unterschiedlicher Ausprägung mindestens bis Mitte der 1950er Jahre weiter.212 Bei der Betrachtung der deutschen Wissenschaftspolitik nach 1945 muss dieser Aspekt ebenso berücksichtigt werden wie die unterschiedlichen wissenschaftspolitischen Interessen der Alliierten, und zwar nicht nur in Bezug auf Differenzen zwischen den Westalliierten und der Sowjetunion, sondern auch der Westalliierten untereinander. Das beste Beispiel dafür ist die Entnazifizierung, die in den einzelnen Besatzungszonen mit unterschiedlicher Intensität verfolgt wurde und beim Wiederaufbau des Wissenschaftsbetriebs eine wichtige Rolle spielte.213
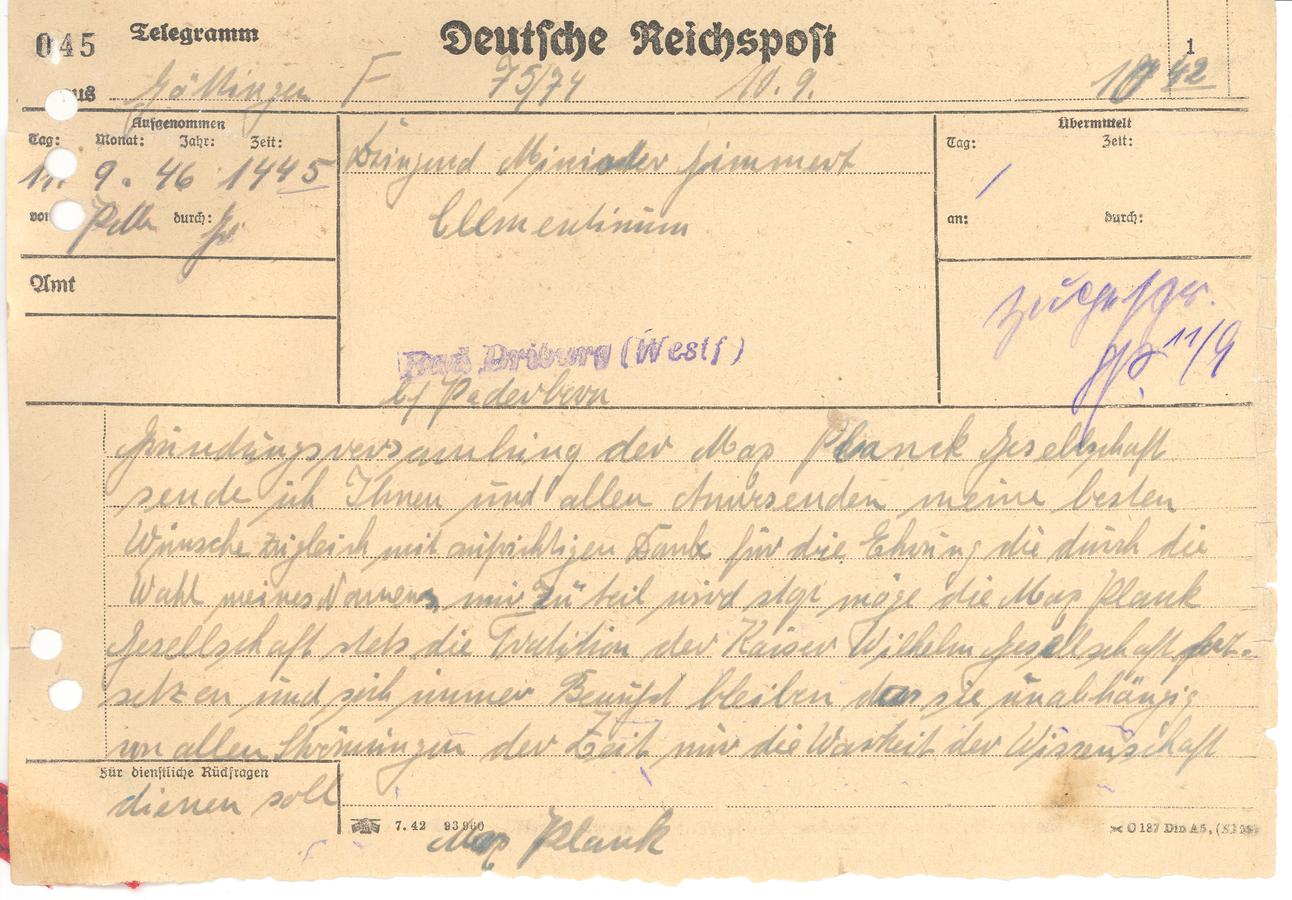
Abb. 1.5:
Die USA wollten die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Institution des „Dritten Reichs“ auflösen und ihre Institute zum Teil in die Universitäten überführen.214 Die Briten hingegen waren von Anfang an bereit, eine entmilitarisierte Forschung auch im Rahmen einer erneuerten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu ermöglichen. Die Franzosen unternahmen ebenso wie die anderen Militärregierungen zunächst einmal Schritte, neuartige Produktionsverfahren und Waffensysteme sowie die dazugehörigen deutschen Forschungsteams für sich selbst sicherzustellen.215 Doch mit Beginn des Kalten Kriegs änderte sich dies: War noch im April 1946 im Alliierten Kontrollrat von einer Auflösung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft die Rede, so wurde ein entsprechender Beschluss danach nicht mehr aktenkundig. Und mit dem wachsenden Bestreben der Westalliierten, ihre Besatzungszonen wirtschaftlich und politisch als Bollwerk gegen das sowjetische Einflussgebiet aufzubauen, war man zunehmend auch bereit, die (west-)deutsche Wissenschaft wieder zu stärken.
Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der deutschen Nachkriegsforschung spielte das von den Alliierten am 29. April 1946 erlassene Kontrollratsgesetz Nr. 25, das unter anderem festlegte:
Um naturwissenschaftliche Forschung für militärische Zwecke und ihre praktische Anwendung für solche Zwecke zu verhindern, und um sie auf anderen Gebieten, wo sie ein Kriegspotential schaffen könnten, zu überwachen und sie in friedliche Bahnen zu lenken, hat der Kontrollrat das folgende Gesetz beschlossen: [...]
Artikel II. 1. Angewandte naturwissenschaftliche Forschung ist untersagt auf Gebieten, welche a) rein oder wesentlich militärischer Natur sind; [...]
Artikel III. 1. Grundlegende naturwissenschaftliche Forschung, rein oder wesentlich militärischer Natur, ist verboten.216
Das Kontrollratsgesetz bildete den neuen Rahmen, innerhalb dessen sich auch die weitere Entwicklung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und später der Max-Planck-Gesellschaft vollziehen sollte. Die von den Alliierten gesetzten Randbedingungen sorgten von vorneherein für eine größere Distanz zwischen der Wissenschaft und ihrem staatlichen und gesellschaftlichen Umfeld. Daraus entstanden letztlich auch die neuen Selbstverständlichkeiten, unter denen sich das Wirken der Max-Planck-Gesellschaft in der jungen Bundesrepublik vollzog, unter anderem die Bereitschaft zur Zurücknahme der Politik zugunsten der Autonomie von Wissenschaft, sowie das Selbstverständnis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Max-Planck-Gesellschaft, die eine solche Zurücknahme als ihr gutes Recht ansahen. Alles in allem entwickelte sich aus den Nachkriegskonflikten, auch den Spannungen zwischen den westlichen Besatzungszonen, ein zunächst der Wissenschaft von außen auferlegter, dann aber zunehmend von ihr selbst angenommener und weiterentwickelter Lernprozess, für den dieses Denkmuster prägend wurde.217 Aber wir greifen der Geschichte voraus.
Die Institute befanden sich in verschiedenen Besatzungszonen. Verbindungen zwischen ihnen wie auch eine gemeinsame Entwicklung wurden nicht nur dadurch erschwert, dass Reisen zwischen diesen Zonen nicht ohne weiteres möglich waren, sondern, wie bereits angedeutet, auch durch die unterschiedlich gelagerten Interessen der Besatzungsmächte. Eine Besonderheit stellte der Standort Berlin dar, wo seit Sommer 1945 der Viermächte-Status galt. Demzufolge lagen der ehemalige Standort Berlin-Buch im sowjetischen und der Standort Berlin-Dahlem im amerikanischen Sektor. Dennoch galt unter dem Viermächte-Status auch für Bildung und Wissenschaft noch bis 1948 eine einheitliche Verwaltung durch den Berliner Magistrat. In Berlin-Dahlem wurden bis zum Einzug der Westalliierten alle verbliebenen Einrichtungen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft von sowjetischen Truppen weitgehend demontiert, allen voran das KWI für Physikalische Chemie und Elektrochemie sowie die verbliebenen Einrichtungen des KWI für Physik.218
Trotz der erschwerten Umstände der Nachkriegszeit, versuchten viele Forscher/innen ihre wissenschaftliche Arbeit weiterzuführen, auch wenn dies bedeutete, wieder von vorne anzufangen. Dies war ein Stück gelebter Kontinuität, in der, wie in anderen Zeiten ebenfalls, vielen die Wissenschaft als Chance zur Selbstverwirklichung ebenso wie zum Broterwerb erschien, in der Hoffnung, nach Zusammenbruch und Kapitulation wieder ein Auskommen zu finden. Für einige verband sich damit aber wohl auch das vermeintlich unpolitische Ziel, Deutschland wieder zu hohem Ansehen in der Wissenschaft zu verhelfen. Dazu gehörte es, Fragen nach dem persönlichen Verhalten während der NS-Zeit zu verdrängen. Stattdessen wurde ein geschöntes Bild von der Wissenschaft im „Dritten Reich“ gezeichnet, das darauf hinauslief, dass Forschung reines Erkenntnisstreben gewesen und die Mehrzahl der KWG-Wissenschaftler/innen von der NS-Politik unbefleckt geblieben sei. Auch diese Überzeugung, aus der Bedrängnis und dem Verdrängen der ersten Nachkriegsjahre geboren, sollte für lange Zeit zu den neuen Selbstverständlichkeiten gehören, unter denen sich der Wiederaufbau der Wissenschaft vollzog.
Ein Teil der Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war noch Anfang 1945 auf

Abb. 1.6:
Ungeachtet der vorgenommenen Demontagen und sogenannten Einladungen an deutsche Wissenschaftler, in der Sowjetunion an strategisch wichtigen Problemen zu arbeiten, verfolgte die sowjetische Besatzungsmacht zunächst durchaus die Absicht, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft weiterbestehen und ihre Arbeit in dem von ihr kontrollierten Gebiet – also insbesondere Berlin – wieder aufleben zu lassen. Noch im Mai 1945 wurde
1.6.2 Ein eingespieltes Team: Hahn und Telschow
Anfang Juni 1945 gelangte Max
In Göttingen drängte
Bereits im April 1945 waren zehn am deutschen Uranprojekt beteiligte Wissenschaftler (darunter die KWG-Wissenschaftler Otto
Nach Ansicht von Gerhard
Planck leistete in dieser Übergangszeit sowohl bei den Besatzungsmächten als auch bei den neuen deutschen Politikern vor allem Lobbyarbeit für die Erhaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und ihrer Institute. Im September 1945 bevollmächtigte
Die ersten Monate nach Kriegsende waren vor allem dadurch kennzeichnet, die Arbeitsfähigkeit der Institute und die Lebensmöglichkeiten der Mitarbeiter am neuen oder gegebenenfalls alten Standort zu erhalten oder wiederherzustellen. Zudem wurden beispielsweise im Oktober 1945 das KWI für Tierzuchtforschung von Dummerstorf bei Rostock auf das Remontegut Mariensee verlegt, also von der sowjetischen in die britische Besatzungszone, oder das noch 1943 in Wien begründete KWI für Kulturpflanzenforschung nach Gatersleben in der sowjetischen Besatzungszone. Nicht zuletzt, um die führenden Forschungskräfte bis zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit der Institute sinnvoll zu beschäftigen, wurde von der britisch-amerikanischen Field Information Agency, Technical (FIAT) im Mai 1946 beschlossen, deutsche Wissenschaftler Übersichtsartikel über die während des Krieges durchgeführten Forschungsarbeiten auf den Gebieten der naturwissenschaftlichen und medizinischen Forschung erarbeiten zu lassen, und damit zugleich den beteiligten Wissenschaftlern ein Einkommen zu verschaffen. An den 1947/48 erscheinenden FIAT Reviews of German Science 1939–1946 – es erschienen 88 entsprechende Berichte – waren auch zahlreiche KWG-Wissenschaftler beteiligt.
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland übernahm
Das masslose Disaster in Deutschland das den masslosen Verbrechen einigermassen adäquat ist, […] muss allen denen die unschuldig hineingerissen sind schwer auf der Seele liegen. Ich hoffe dass Sie Vert[r]auen aus dem Umstand schöpfen, dass Ihr wissenschaftliches und moralisches Ansehen in der ganzen Welt hochgeachtet geblieben ist und dass alle wissen, dass Sie nicht „mit den Wölfen geheult haben“. […] Ausser Ihnen und vonLaue ist keiner da, der solches Vert[r]auen bei den ausländischen Fachgenossen geniesst, und für alle Reconstruction scheint mir das entscheidend ins Gewicht zu fallen.243
Auch Lise
Wenn jetzt nicht die besten Deutschen verstehen, was geschehen ist und nicht wieder geschehen darf, wer soll der heranwachsenden Jugend beibringen, daß der versuchte Weg ein Unglück für die Welt und ebenso für Deutschland war? In den Berichten über den Nürnberger Prozeß war jedesmal, wenn sichtbare Beweise für die Grausamkeiten in den Konzentrationslagern vorgeführt wurden, zu lesen: Herr [Hjalmar]Schacht schaut weg. Die ungeheuerlichen Probleme unserer Zeit, die die Nazi-Wirtschaft heraufbeschworen hat, erlaubten nicht wegzuschauen. Das darf man über aller Alltagsnot nicht vergessen.244
Doch konnte oder wollte
Es ist wohl doch nicht vielen Menschen außerhalb Deutschlands wirklich klar, unter welchem Druck die meisten während der letzten 10 oder 12 Jahre gelebt haben; und ich darf noch einmal sagen, wie viele meiner deutschen Kollegen sich trotz aller äußerlichen Hemmnisse bemüht haben, auch die reine Wissenschaftsforschung, soweit es irgend möglich war, während der Kriegszeit fortzusetzen.246
Diesen Opfermythos kommentierte
Sieht man einmal ab von der erschütternden Rolle, die die Kaiser-Wilhelm-Institute für Anthropologie, Hirnforschung und Psychiatrie bei den unmenschlichen medizinischen Experimenten in Konzentrationslagern und Einrichtungen des NS-Gesundheitswesens direkt und indirekt spielten, läßt man ferner die hohe Qualität der militärischen Forschung an den Kaiser-Wilhelm-Instituten für Metallforschung, für Aerodynamik etc. außer Betracht und berücksichtigt auch nicht die biologisch ausgerichteten Institute, die eingerichtet wurden, um sich die deutsche Vorherrschaft in Osteuropa und die eroberten Gebiete der westlichen Sowjetunion zunutze zu machen, dann bleibt dennoch festzuhalten, daßHahn sich daran hätte erinnern müssen, daß das deutsche Uranprojekt, einschließlich der involvierten Kaiser-Wilhelm-Institute für Chemie, für Physik und für medizinische Forschung, angewiesen war auf die in den eroberten Ländern erbeuteten Rohstoffe und Apparate – Uran, schweres Wasser, Teile von Nuklearreaktoren etc. – und daß es die Entwicklung neuer Energiequellen und Waffen zum Ziel hatte.248

Abb. 1.7: Lise
Anfang Juli 1946 hatte
Der angekündigte Auflösungsbeschluss führte dazu, dass am 11. September 1946 in Bad Driburg unter
Die neue Gesellschaft sollte zunächst lediglich im Fall einer tatsächlichen Auflösung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft als Auffanggesellschaft dienen, um den Instituten dann einen neuen Träger bieten und verhindern zu können, dass auch sie infolge der KWG-Auflösung geschlossen werden müssten. Den vorläufigen Vorstand der neuen Gesellschaft bildeten
1.6.3 Territorialansprüche: Neugründung mit Hindernissen
Der neuen Gesellschaft gehörten zunächst dreizehn bisherige Kaiser-Wilhelm-Institute an: Arbeitsphysiologie (Dortmund), Landwirtschaftliche Arbeitswissenschaft und Landtechnik (Gut Imbshausen), Bastfaserforschung (Stammbach, dann Bielefeld), Eisenforschung (Düsseldorf), Hirnforschung (Göttingen), Hydrobiologische Anstalt (Plön), Instrumentenkunde (Göttingen), Kohlenforschung (Mülheim/Ruhr), Physik (Göttingen), Deutsches Spracharchiv/Phonometrie (Braunschweig), Strömungsforschung (Göttingen), Tierzucht und Tierernährung (Remontegut Mariensee), Züchtungsforschung (Gut Voldagsen). Als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft konnte
Unklar war zunächst auch die Zukunft der in Berlin zurückgebliebenen Institute beziehungsweise Teilinstitute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.258 Das KWI für physikalische Chemie und Elektrochemie hatte nur wenige Kriegsschäden davongetragen und konnte die Arbeit bald wieder aufnehmen. Vom KWI für Physik waren zwar das Kälte- und das Hochspannungslaboratorium in Dahlem verblieben, die aber nach Kriegsende von der sowjetischen Besatzungsmacht demontiert wurden. Auch das KWI für Silikatforschung war mit einigen Abteilungen noch in Berlin verblieben; Luise
Die frühe Geschichte der Berliner Institute zeigt auf ihre Weise, wie wenig selbstverständlich die Kontinuität zwischen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und der Max-Planck-Gesellschaft war. Die Diskussionen über eine mögliche Schließung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft durch die Besatzungsmächte führte dazu, dass
Der von Göttingen abgelehnte
Die politischen Veränderungen zu Beginn des Kalten Krieges hatten zu einem Umdenken in der anglo-amerikanischen Politik geführt: Das ursprüngliche Ziel der Alliierten, Sicherheit vor Deutschland zu erlangen, wandelte sich zum Ziel der Westalliierten, Sicherheit mit (West-)Deutschland zu erreichen.264 Und es bedeutete nicht nur eine Förderung der Wirtschaftsentwicklung, sondern auch der Wissenschaftsentwicklung.265 Am 4. August 1947 führte Otto
Bereits zum 24. Februar 1948 wurde die erst anderthalb Jahre zuvor in der britischen Zone gegründete Max-Planck-Gesellschaft wieder aufgelöst, um den Weg für eine weitere Neugründung zu ebnen. Mit Zustimmung der jeweiligen Militärregierungen wurde am 26. Februar 1948 die „Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.“ in Göttingen zunächst nur für die britische und die amerikanische Zone gegründet. Das Gründungsstatut der Max-Planck-Gesellschaft bestimmte als gemeinnützigen Zweck, „die Wissenschaften zu fördern, insbesondere durch Unterhaltung von Forschungsinstituten“. Anders als zuvor bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurde auf die ausdrückliche Hervorhebung der naturwissenschaftlichen Forschung verzichtet. Dennoch wurden zunächst nur eine chemisch-physikalisch-technische Sektion unter dem Vorsitz von
Damit war die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft de facto aufgelöst. Die Liquidation der Gesellschaft wurde am 6. April 1951 beschlossen und schließlich am 21. Juni 1960 vollzogen – drei Wochen nachdem
1.6.4 Gewollte Brüche und konstruierte Kontinuitäten
Man kann wohl davon ausgehen, dass die Teilnehmer der Gründungsversammlung der Max-Planck-Gesellschaft im Februar 1948 der Auffassung waren, im Wesentlichen nur eine Namensänderung vorzunehmen, gemäß dem von
Unter den Aspekten „Wiederaufbau der wissenschaftlichen Forschung“ sowie „Wiederherstellung des Anschlusses an die internationale Wissenschaftsentwicklung“ ließen sich zunächst auch alle Kräfte in diesem Sinne bündeln. Noch 1961 erklärte
Ein besonderes Kapitel der Nachkriegsgeschichte der Gesellschaft stellt die Wiedergutmachung oder Entschädigung der durch den Nationalsozialismus verfolgten und vertriebenen Forscherinnen und Forscher dar.273 An alliiertes Recht anknüpfend waren diese Leistungen grundsätzlich durch die Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland geregelt. Doch wo „die Setzung von Recht die Verpflichtungen und Erwartungen von Antragstellern und Antragsgegnern in erschöpfender Form regeln will, kann die Auseinandersetzung mit moralischen Fragen zu einer hermeneutischen Tätigkeit verkümmern,“274 zumal das Gesetz so gefasst war, dass die Beweislast bei den Geschädigten lag.
Schwer tat sich die MPG auch mit der Wiedergewinnung – als einer Möglichkeit der Wiedergutmachung – von durch die Nationalsozialisten in die Emigration gezwungenen Wissenschaftlern. Das Verhalten der Verantwortlichen in der MPG ist kaum zu entschuldigen, auch wenn man berücksichtigt, dass in der Regel mehr als 15 Jahre vergangen waren und viele der betroffenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler folglich eher am Ende ihrer Laufbahn standen und dass andererseits Wissenschaftler, die einigermaßen in ihren Gastländern Fuß fassen konnten und entsprechende Positionen bekleideten, wenig Interesse an der Rückkehr zeigten, zumal die Arbeits- und Lebensbedingungen im Nachkriegsdeutschland nicht die besten waren. Im Dezember 1948 hatte
Eine Rückkehr der Vertriebenen in die Max-Planck-Gesellschaft gab es nur in sehr wenigen Fällen.275 Die alten Seilschaften, die die Kontinuität der Generalverwaltung sicherten, wirkten hier auf unrühmliche Weise.
Das zeigt insbesondere das Beispiel des ehemaligen Direktors des KWI für Biochemie Carl
Die Max-Planck-Gesellschaft ist nicht Rechtsnachfolgerin der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und hat infolgedessen an sich nicht für die Ansprüche früherer Angehöriger der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft einzustehen. Trotzdem bemüht sich die Max-Planck-Gesellschaft bei den die Gesellschaft zurzeit finanzierenden 11 westdeutschen Ländern, die erforderlichen Beträge zu erhalten.278
Der hier betonte Mangel an Kontinuität steht in starkem Gegensatz zu dem sonstigen Bemühen der Max-Planck-Gesellschaft, ihre Kontinuität zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft herauszustellen. Gerade die Frage der Pensionsansprüche spielte für ältere Wissenschaftler eine große Rolle, auch wenn sie im Ausland eine Anstellung gefunden hatten, wie das Beispiel
1.6.5 Die Max-Planck-Gesellschaft bis 1960
Trotz der problematischen Kontinuität zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wuchs die Max-Planck-Gesellschaft allmählich in eine demokratische Gesellschaftsordnung hinein und veränderte dabei auch ihre Strukturen. Dies war Teil eines Lernprozesses, der durch die von den Alliierten gesetzten Randbedingungen und die neuen politischen Konstellationen angelegt war, sich aber nachhaltig auf die Strukturen der Max-Planck-Gesellschaft und auf das Selbstverständnis ihrer Träger auswirken sollte. Auch die oft nur als Verdrängung der Vergangenheit spürbare Präsenz der Erinnerung an die Verbrechen und Katastrophen der NS-Ära wirkte sich langfristig wohl doch im Sinne einer größeren Zurückhaltung in Bezug auf Opportunitäten staatlicher und wirtschaftlicher Indienstnahme der Gesellschaft aus. So konnte auf neuer Grundlage versucht werden, den bereits in der Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft angelegten Anspruch auf die Selbstbestimmung wissenschaftlicher Schwerpunktsetzung zu realisieren und ihn in Richtung einer weiter gehenden Entkoppelung der Forschung von Anwendungsinteressen und äußeren Einflussnahmen sowie in Richtung auf ein arbeitsteiliges Wissenschaftssystem zu entwickeln. Der damit verbundene Balanceakt durch die notwendige Einbindung der gesellschaftlichen Kräfte, die erst eine solche Forschung ermöglichen konnten, war zwar stets prekär, wurde aber durch die demokratischen Strukturen der Bundesrepublik begünstigt.
In der Tat hatten Staat und Wirtschaft wohl einen weitaus geringeren Einfluss auf die Gründung und Ausrichtung von Instituten der Max-Planck-Gesellschaft als dies bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft der Fall gewesen war. Ausnahmen bildeten allerdings, insbesondere hinsichtlich der Finanzierung, etwa die industrienahen Max-Planck-Institute für Kohlenforschung und für Metallforschung. Insgesamt jedoch lässt sich festhalten, dass die Wirtschaft und andere starke gesellschaftliche Kräfte vor allem über die Gremien der Max-Planck-Gesellschaft wie den Senat, den Verwaltungsrat, aber auch die Kuratorien in die Gestaltung der Gesellschaft eingebunden waren und weitaus weniger direkten Einfluss ausüben konnten, als das bei der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft üblich war. Einflussreiche Persönlichkeiten brachten gewiss auch partikulare Interessen in diese Beratungen ein, ebenso aber ihre soziale Kompetenz und Lebenserfahrung. Wie weit darüber hinaus Netzwerke von Führungseliten die Geschicke der Max-Planck-Gesellschaft prägten und für welche Entscheidungen am Ende doch Einzelinteressen, auch wirtschaftlicher, politischer oder militärischer Natur, ausschlaggebend waren, muss der weiteren Forschung vorbehalten bleiben. Die Unabhängigkeit der Max-Planck-Gesellschaft von staatlicher Einflussnahme wurde jedenfalls insbesondere durch den Finanzierungsmodus der Gesellschaft begünstigt.
Die Grundlage dafür bildete 1949 das Königsteiner Staatsabkommen, in dem die künftigen Bundesländer unter anderem finanzielle Regelungen für die Finanzierung überregionaler Forschungseinrichtungen verabredeten.282 Für die Max-Planck-Gesellschaft bedeutete dies, dass sie fortan zu gleichen Teilen von Bund und Ländern finanziert und damit auch administrativ zu einer „Säule des deutschen Wissenschaftsbetriebs“ wurde. Die durch die Finanzierung aus Mitteln von Bund und Ländern bedingte Komplexität stellte einerseits eine Herausforderung an das Verhandlungsgeschick der jeweiligen MPG-Leitung dar, schützte die Gesellschaft andererseits aber auch vor einseitigen Indienstnahmen. Als politischer Imperativ verblieb so vor allem der Anspruch auf eine angemessene Verteilung von Max-Planck-Instituten über die Länder. Wegweisend für die unabhängige Forschung innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft war insbesondere die Tatsache, dass die finanziellen Zuwendungen sowohl von staatlicher als auch von privater Seite im Wesentlichen frei von Auflagen erfolgten und von der Max-Planck-Gesellschaft proaktiv verteilt werden konnten. Das erlaubte der Max-Planck-Gesellschaft ab Mitte der 1950er Jahre erstmals wieder ein über einen längeren Zeitraum angelegtes eigenes wissenschaftliches Konzept zu realisieren.283
Die fünfziger Jahre waren durch eine Reorganisation der Gesellschaft charakterisiert, in deren Rahmen zahlreiche Forschungsstellen und Institute umbenannt, umgewidmet, umgesiedelt, zusammengeschlossen, ausgegliedert, gegründet oder in die Max-Planck-Gesellschaft übernommen wurden. Diese Mutationsfähigkeit und Fertilität erlaubte die Fokussierung der Max-Planck-Gesellschaft auf die Grundlagenforschung zu schärfen und neuen Forschungsrichtungen institutionelle Unterstützung zu gewähren. Ausschlaggebend für den Erfolg war oft gerade eine Kombination aus Themenwahl und institutioneller Effizienz. Bei der Themenwahl haben sich verschiedene Strategien als erfolgreich erwiesen, etwa die Reflexion auf den Stand des Faches, insbesondere auch im internationalen Kontext. Dies konnte etwa zu dem Schluss führen, dass die Aufgabe eines Instituts darin bestehen sollte, eine Katalysatorfunktion für bereits existierende innovative Perspektiven auszuüben. Schließlich bedürfen wissenschaftliche Durchbrüche auch einer nachhaltigen Umsetzung.
Zahlreiche Beispiele belegen die Fähigkeit von Instituten, neue Themen hervorzubringen, und die Fähigkeit der Max-Planck-Gesellschaft, diesen eine angemessene institutionelle Grundlage zu gewähren. So wurde beispielsweise 1950 unter Konrad
In dieser Zeit gelangen der Max-Planck-Gesellschaft auch wissenschaftliche Durchbrüche mit überragenden, wenn auch so nicht vorhersehbaren wirtschaftlichen Konsequenzen. Ein Beispiel dafür ist die Entdeckung der metallorganischen Mischkatalysatoren für die Polymerisation von Olefinen am MPI für Kohlenforschung, die um 1953 zur Entwicklung des Niederdruckpolyethylen-Verfahrens durch Karl
Mit der wachsenden Bedeutung der Max-Planck-Gesellschaft wurde diese auch zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, ihre besondere Rolle im bundesrepublikanischen Forschungssystem zu klären, aber auch ihre Zuwächse und ihre wissenschaftlichen Schwerpunktsetzungen gegenüber der Gesellschaft insgesamt zu rechtfertigen. Die Öffnung der Max-Planck-Gesellschaft zu einem solchen gesellschaftlichen Diskurs hatte eine Reihe von Konsequenzen: Sie schärfte ihr Profil, in Ergänzung zur Hochschulforschung nach dem Subsidiaritätsprinzip Schwerpunkte in der Spitzenforschung zu setzen, nach dem Harnack-Prinzip herausragenden Forschern die Gelegenheit zur langfristigen Umsetzung innovativer Forschungsprogramme zu bieten, in Grenzgebieten interdisziplinäre Forschung zu unterstützen und gemeinsam mit anderen Wissenschaftsorganisationen apparativ aufwändige Projekte zu unterstützen. Gegenüber der Gesellschaft insgesamt musste sie dabei in der Lage sein, die erheblichen Investitionen in einzelne Personen und Projekte und insbesondere auch die durch die institutionelle Förderung langfristig gewährte Forschungsfreiheit durch hohe Qualitätsansprüche und deren Umsetzung zu garantieren.
Transformationen
Keineswegs alle Institute der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wurden von der Max-Planck-Gesellschaft übernommen, dafür kamen andere hinzu, die keine Kaiser-Wilhelm-Institute gewesen waren. Eine optimale Auswahl aus der Vielzahl von den in den Westzonen bzw. der jungen Bundesrepublik liegenden Instituten zu treffen und daraus den Kern der damaligen Max-Planck-Gesellschaft zu formen, ist sicher die Leistung ihres Präsidenten
In der Phase von 1949 bis 1960 kamen insgesamt zwanzig neue Institute zur Max-Planck-Gesellschaft. Überwiegend handelte es sich dabei um ehemalige Abteilungen von Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Instituten, die jetzt mit neuem Forschungsziel selbständig wurden, oder durch Zusammenlegungen verschiedener solcher Abteilungen neu ausgerichtet wurden. Mit anderen Worten, die Aufbauarbeit in den 1950er Jahren konzentrierte sich neben der Wiederherstellung oder dem Neubau von Gebäuden vor allem auf eine Neustrukturierung und Erweiterung vorhandener Kapazitäten. Die nachfolgend beschriebenen Transformationen sollen kursorisch diese Entwicklung veranschaulichen.
So entstand beispielsweise 1957 das MPI für Physik der Stratosphäre und der Ionosphäre durch die Zusammenlegung des ehemaligen Regener
Das MPI für Kernphysik wurde 1958 in Heidelberg unter der Leitung von Wolfgang
Eines der wenigen klassischen geisteswissenschaftlichen Institute der Gesellschaft war das MPI für Geschichte, das 1955 in Göttingen als Nachfolgeinstitut des 1944 geschlossenen KWI für Deutsche Geschichte gegründet wurde, und zwar auf Grundlage einer Denkschrift des Historikers Hermann
Das MPI für Arbeitsphysiologie war 1948 aus dem 1928/29 von Berlin nach Dortmund verlegten KWI für Arbeitsphysiologie hervorgegangen. Obwohl Teile des Instituts 1944 durch Kriegshandlungen zerstört wurden, konnte es seine Arbeit fortsetzen, da die luftkriegsbedingt nach Bad Ems und Diez an der Lahn ausgelagerten Abteilungen sukzessive wieder zurückkehrten.289 1956 wurde Heinrich
Das KWI für Physik, das von Ende 1939 bis Mitte 1942 unter der formellen Leitung des Heereswaffenamtes gestanden hatte, dann aber Mitte 1942 mit seinem Uranprojekt wieder in die „zivile Forschung“ entlassen wurde, war ab Mitte 1943 teilweise von Berlin nach Hechingen in Süddeutschland verlagert worden. Seit Mitte 1942 war Werner
Im Frühjahr 1948 wurde für Karl Friedrich
Demokratisierung: Mainauer Kundgebung und Göttinger Erklärung
Die Max-Planck-Gesellschaft fügte sich, wie bereits ausgeführt, immer mehr in das föderative Staatswesen der Bundesrepublik Deutschland ein und entwickelte zugleich demokratische Strukturen. Im Selbstverständnis der Max-Planck-Gesellschaft stand stets die Sicherung der Autonomie der Grundlagenforschung im Vordergrund, doch gab es auch Raum für Diskussionen um die gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Bedeutung der Forschung.
Kernphysikalische Forschungen waren von den Alliierten untersagt. Dennoch versuchten die Wissenschaftler um

Abb. 1.8: Otto
Ende 1956 zeigte sich der Arbeitskreis „Kernphysik“ beim damaligen Bundesministerium für Atomfragen tief beunruhigt über das Bestreben der Bundesregierung, Verfügungsgewalt über Atomwaffen zu erlangen und schrieb einen Brief an den Bundesverteidigungsminister Franz Josef
Die Göttinger Erklärung und eine entsprechende kontroverse Bundestagsdebatte am 10. Mai 1957 waren der Katalysator für eine breitere Anti-Atomwaffenbewegung in der Bundesrepublik. Mit der Mainauer Kundgebung, und mehr noch mit der Göttinger Erklärung traten führende deutsche Wissenschaftler erstmals aus ihrem unmittelbaren wissenschaftlichen Wirkungskreis in eine breite politische Öffentlichkeit heraus und überschritten damit eine wichtige Schwelle ihres bisherigen Selbstverständnisses. Politische Überzeugung und eigennützige Motive vermischten sich dabei, schufen aber ein neues Wissenschaftsbild, das bald seine eigene Dynamik entfalten sollte.303
Internationaler Dialog: Israel und die Minerva GmbH
Als der zukünftige israelische Ministerpräsident David Ben
Bei einem Besuch in New York 1960 versprach
1.7 Wissenschaft im Wirtschaftswunderland: Die Ära Butenandt
Seit Beginn der 1960er Jahre griff die Max-Planck-Gesellschaft verstärkt gesellschaftliche Herausforderungen auf und nutzte zugleich geschickt politische Gegebenheiten für die Etablierung neuer Forschungsperspektiven. Das 1960 in Garching gegründete MPI für Plasmaphysik, inzwischen das größte Zentrum für Fusionsforschung in Europa, war eine Ausgründung aus dem MPI für Physik und Astrophysik. Ging man damals noch davon aus, in etwa 20 Jahren die Kernfusion zu beherrschen, so wird heute erwartet, dass es entsprechende Kraftwerke nicht vor 2050 geben wird. Die Fusionsforschung ist sicherlich ein charakteristisches Beispiel für ein Forschungsgebiet, das einen langen Atem erfordert, aber auch weiterreichende institutionelle Kooperationen, wie etwa zwischen Max-Planck-Gesellschaft und Helmholtz-Gesellschaft. Heute ist das Institut dem von Euratom koordinierten Europäischen Fusionsprogramm assoziiert und an europäischen Gemeinschaftsprojekten wie dem Joint European Torus (JET) beteiligt. Es ist eine besondere Stärke der Max-Planck-Gesellschaft, solchen Herausforderungen durch Einzelfalllösungen zu begegnen, die ein besonderes Maß an institutioneller Flexibilität voraussetzen, oft jenseits traditioneller Denkhorizonte von Politik und Verwaltung.
Ein weiteres Beispiel für das Aufgreifen gesellschaftlicher Herausforderungen und politischer Gelegenheiten ist die Gründung des MPI für extraterrestrische Physik unter Reimar
Zu den erfolgreichen Strategien der Themenfindung innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft gehört offensichtlich auch die Besinnung auf bereits vorhandene Stärken. Für die Geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften bietet ihre Position in einer naturwissenschaftlich dominierten Gesellschaft zweifellos einen einzigartigen Forschungskontext. Dieser ermöglichte es den in diesen Gebieten arbeitenden Instituten nicht nur Brücken zwischen den so genannten zwei Kulturen zu schlagen, sondern auch die traditionelle Zersplitterung innerhalb der Humanwissenschaften zu überwinden. Zugleich befähigte dieser Kontext die Max-Planck-Gesellschaft in den sechziger und siebziger Jahren in besonderem Maße, auch gesellschaftliche Herausforderungen aus diesem Bereich aufzugreifen.
Wegweisend für diesen Modernisierungskurs war der neue Mann an der Spitze der Gesellschaft: Im November 1959 wurde Adolf
Es steht außer Frage, dass Adolf
1.7.1 Modernisierungskurs
Auf der Jahreshauptversammlung 1961 in Berlin beschwor
Obwohl die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vor etwa Jahresfrist endlich aufgelöst wurde, feiert die Max-Planck-Gesellschaft dieses Jubiläum, weil sie selbst die alleinige Aufgabe übernahm, die Tradition der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu erhalten und zu mehren und aus dieser Tradition nach den Erfordernissen unserer Tage die Wissenschaft zu fördern.311
Zugleich hielt er fest:
Die Feststellung, daß die Grundprinzipien unserer Gesellschaft seit 50 Jahren unverändert geblieben sind und sich bisher ganz offenbar bewährt haben, entbindet uns aber nicht von der Frage, ob sie wirklich den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen und vor allem den zukünftigen Bedürfnissen einer so gründlich veränderten Welt voll entsprechen.312
Letzteres war allerdings rein pragmatisch gemeint, eine Frage nach politischer Verantwortung wurde dabei nicht einmal angedeutet. Durch den Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 war aus Sicht der Max-Planck-Gesellschaft die Option Berlin als zukünftiger Sitz der Max-Planck-Gesellschaft nicht mehr adäquat.
Im Juni 1964 wurde das seit 1969 im Grundgesetz verankerte Königsteiner Abkommen zur Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft durch das „Verwaltungsabkommen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung“ abgelöst, das die gemeinsame Bund-Länder-Finanzierung im Wissenschaftsbereich von MPG, DFG und Studentenförderung neu regelte. Dazu kamen nach wie vor private Mittel, etwa aus Stiftungen, die zwar im Gesamthaushalt einen geringeren Teil ausmachten, aber für Flexibilität bei der Realisierung einzelner Projekte von nicht zu unterschätzender Bedeutung waren, wie
Nach sechs Jahren Vorlauf – bereits
Ebenso wurden die Aufgaben des Verwaltungsrats und der Generalsekretäre im Sinne eines Vorstandes der Gesellschaft sowie die Rechte und Pflichten der Mitglieder und Direktoren neu formuliert. Im April 1965 trat die neugefasste Satzung in Kraft. Werner
1.7.2 Wissenschaftswunderzeit
War die Amtszeit
Die zunächst nur aus vier Instituten bestehende geisteswissenschaftliche Sektion erlebte einen Aufschwung.324 Die Gründung des MPI für Bildungsforschung 1963 in Berlin mit seinen Schwerpunkten Entwicklung und Bildung des Menschen war in gewisser Weise eine Reaktion auf den Sputnikschock von 1957, der nicht nur in den USA, sondern auch in der damaligen Bundesrepublik die Bildungskrise drastisch offenbarte.325 Sie stand aber ebenso in engem Zusammenhang mit dem langjährigen bildungspolitischen Engagement des Juristen Hellmut
Auch in den Rechtswissenschaften wurden drei neue Institute gegründet: das MPI für europäische Rechtsgeschichte, das von 1964 bis 1979 unter der Leitung seines Gründungsdirektors Helmut
Zu den ersten neugegründeten Instituten in den weiterhin dominanten Naturwissenschaften gehörten 1961 das MPI für Immunbiologie in Freiburg im Breisgau unter der Leitung von Otto
Die Gründung des MPI für Radioastronomie 1966 ist ein Beispiel dafür, wie sich Synergien zwischen außeruniversitären und universitären Forschungseinrichtungen entwickeln können. Das seit Anfang der 1950er Jahre bestehende Astronomische Institut der Universität Bonn betrieb ein eigenes Radioteleskop von 25 Metern Durchmesser. Ausbaupläne, die den Bau eines 100-Meter-Radioteleskops vorsahen, hätten den Etat eines einzigen Universitätsinstituts gesprengt. Doch durch die Zusammenlegung der bestehenden Vorhaben, sprich: Gründung eines MPI und Ausbau des Universitätsinstituts, konnte 1966 das MPI für Radioastronomie unter Otto
Ausdruck für Fertilität und Mutationsfähigkeit der Gesellschaft war die Überführung von mehreren kleineren Forschungseinheiten in eine größere, wie beispielsweise
Die mit den Erfolgen des Wirtschaftswunders einhergehenden Expansionspläne erhielten durch die Konjunkturdelle Mitte der 1960er Jahre einen Dämpfer.332 Folglich verneinte
Auch den internationalen Beziehungen räumte
Aber auch bilaterale Abkommen mit den (ehemaligen) westlichen Kriegsgegnern sind in dieser Zeit durchaus hervorzuheben, wie etwa mit dem französischen Centre National de la Recherche Scientific (C.N.R.S.) im Jahre 1971. Dieses Abkommen führte dann im Dezember 1971 zu einem Vertrag, ein gemeinsames Hochfeld-Magnetlaboratorium in Grenoble zu gründen.
1.7.3 Aufbruch in eine neue Ära
Der Übergang von
Mehr Mitbestimmung, weniger Einfluss der Wirtschaft
Zwei Forderungen standen im Zentrum der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschaft: zum einen mehr Mitbestimmung und zum anderen weniger Einfluss der Wirtschaft auf die wissenschaftliche Forschung. Das hierarchische direktorale Prinzip sei überholt, argumentierten vor allem jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, nur eine sachverständige Diskussion aller Beteiligten der Forschungsbedingungen, Forschungsergebnisse und forschungspolitischen Präferenzen schaffe die Kompetenz, eine wirksame Kontrolle der Forschung einzuführen. Insofern forderten sie die gleichberechtigte Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an künftigen Entscheidungen hinsichtlich Forschungsarbeit und Strukturplanung der Gesellschaft und die Umsetzung der bereits in der Satzungsänderung 1964 beschlossenen kollegialen Leitung.
Anfang Juni 1971 fand in Arnoldshain der „Erste konstituierende Delegiertentag der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschaft“ statt, der die regionalen Delegiertenversammlungen der Max-Planck-Gesellschaft repräsentierte. Die gewählten Vertreter der etwa 4.000 wissenschaftlichen Mitarbeiter und Stipendiaten forderten „die Beseitigung des bestehenden Klassensystems unter den Wissenschaftlern und des Mißbrauchs von Zeitverträgen“. In der ersten der dort ausgearbeiteten und beschlossenen insgesamt 14
In der Hauptversammlung, dem obersten Vereinsorgan der Max-Planck-Gesellschaft, das die Senatoren wählt und über Satzungsänderungen beschließt,341 verfügten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über kein Stimmrecht, sondern ausschließlich die Mitglieder.
Von den 1287 Mitgliedern der Max-Planck-Gesellschaft waren 1970 allein 818 Firmenmitglieder; von den 469 Einzelmitgliedern standen viele ebenfalls der Wirtschaft nahe. Hingegen stammen von den 275 Millionen Mark des Haushalts 1970 nur rund 1,2 Millionen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Zuschüssen der Wirtschaft, dazu noch 1,6 Millionen vom Stifterverband. So kommen annähernd 99 Prozent der Mittel von der öffentlichen Hand, also von der Allgemeinheit. Für nur rund ein Prozent hat die Wirtschaft einen massiven Einfluß auf die Max-Planck-Gesellschaft erlangt.342
Auch für den Staat galt: „geringer personeller Einfluss und freizügige Mittelvergabe ohne Kontrollinstanzen“343 oder wie es der Physiker Rudolf
Bereits bei Ihrer letzten Hauptversammlung in Saarbrücken habe ich darauf hingewiesen, daß die bisher oft postulierte Wertefreiheit der Forschung heute mindestens modifiziert betrachtet werden muss. Denn die Forschung darf bei all ihren Arbeiten die gesellschaftspolitischen Bezüge und die Folgerungen für das Zusammenleben der Menschen nicht außer Betracht lassen.345
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dietrich
Strukturreform: Ändern, damit alles so bleibt, wie es ist?
Wie reagierte also die Max-Planck-Gesellschaft auf diesen Druck von innen und von außen? Nach Ansicht ihres Präsidenten musste sie keine Diskussion scheuen.347 Bereits im Herbst 1968 hatte
Im Frühjahr 1970 legte die Präsidentenkommission ihre ersten Berichte vor. Dass es sich dabei jedoch um keine Reformpapiere handelte, verdeutlicht die Ansprache des Präsidenten auf der Festversammlung der Max-Planck-Gesellschaft 1970.

Abb. 1.9: Generationswechsel: Reimar
Reimar
Am 27. April 1972 fand in Frankfurt am Main eine Sondersitzung des Wissenschaftlichen Rats zur Diskussion und Abstimmung des neuen Strukturkonzepts statt.354 Obwohl bereits im Vorfeld feststand, dass die Wissenschaftlichen Mitglieder in den entscheidenden Fragen das letzte Wort behalten und die wissenschaftlichen Mitarbeiter in den Gremien in der Minderheit sein würden, zeichnete sich die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht ab. Um zu vermeiden, dass der Reformprozess dadurch noch weiter aufgehalten würde, entwickelte
Der Versuch der unterlegenen Minderheit (24 Gegenstimmen, eine Enthaltung), auf der Hauptversammlung am 22. Juni 1972 im Bremer Rathaus doch noch eine Sperrminorität zu erzielen, scheiterte. Bei seiner Antrittsrede am folgenden Tag wendete
1.8 Ausblick
Die Gründung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Jahr 1911 schuf ein neues Modell der institutionellen Forschungsförderung, durch das interdisziplinäre, an grundlegenden Fragen orientierte Forschung überwiegend im Rahmen mittelgroßer, stark durch einzelne Forscherpersönlichkeiten geprägter Institute langfristig realisiert werden konnte. Diese Tradition konnte die 1948 gegründete Max-Planck-Gesellschaft noch erfolgreicher als ihre Vorgängerin fortsetzen, da sie nunmehr in einen neuen politischen und wirtschaftlichen Kontext eingebunden war, in dem diese Art der Forschungsförderung zum Teil eines differenzierten Forschungsförderungssystems geworden und in seinen Autonomiebedürfnissen und -ansprüchen weitgehend anerkannt war. Aus diesem Kontext ergab sich auch eine stärkere Fokussierung auf Grundlagenforschung in einem nun auch institutionell abgrenzbaren Sinne.
Wissenschaftssysteme können und müssen zwar – wenn sie erfolgreich sein wollen – solche Autonomieansprüche entwickeln, hängen aber dennoch weitgehend von gesellschaftlichen Randbedingungen ab, die letztlich ihre Handlungsspielräume und auch das Bewusstsein der Handelnden bestimmen. Das Selbstverständnis der Wissenschaftseliten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war in drei verschiedenen gesellschaftlichen Systemen, dem Kaiserreich, der Weimarer Republik und im NS-System durch die Überzeugung geprägt, dass Wissenschaft jeweils dem Staate zu dienen habe, reine Wissenschaft aber zugleich unabhängig von ihrer Indienstnahme durch diesen an sich dem Fortschritt und damit der Menschheit diene. Diese Konstellation blieb auch durch die Katastrophen des Zweiten Weltkrieges hindurch eine unhinterfragte Handlungsmaxime vieler Wissenschaftler.
Gerade eine Wissenschaftsgesellschaft, die in so hohem Maße auf eine Vernetzung mit der sie tragenden Gesamtgesellschaft angewiesen war wie die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, wurde deshalb anfällig für deren politische Verwerfungen, gerade weil sie sich dagegen immun wähnte. Nach der militärischen Niederschlagung des NS-Systems und der Aufdeckung seiner Verbrechen kam es zu im Wesentlichen von außen induzierten Lernprozessen, die erst einen Neubeginn auch des Wissenschaftssystems ermöglichten. Die 1948 gegründete Max-Planck-Gesellschaft mit ihrer Kontinuität und ihren Brüchen gegenüber der Vorgängergesellschaft steht für diesen Neubeginn. Zu diesen zunächst erzwungenen, dann aber an Eigendynamik gewinnenden Lernprozessen gehörte auch die Einsicht in die Notwendigkeit einer eigenständigen Positionierung von Wissenschaften in gesellschaftlichen und politischen Kontexten. Dieses konnte selbst zu einer bis dahin unbekannten Opposition von Wissenschaftlern gegenüber Wünschen der politischen Klasse führen, wie dies am Beispiel der Göttinger Erklärung deutlich geworden ist.
Während in der von uns hier behandelten Frühphase der Max-Planck-Gesellschaft weder die Forderung nach Wiedergutmachung allgemein anerkannt wurde, noch eine aktive Remigrationspolitik verfolgt wurde oder die Aufarbeitung der NS-Verbrechen eine Rolle spielte, positionierte sich die Max-Planck-Gesellschaft dennoch zunehmend als eine auf internationale Kooperationen angelegte, weltoffene Wissenschaftsgesellschaft. Dies galt in besonderem Maße für die Initiative zu wissenschaftlicher Kooperation mit Israel, der die Max-Planck-Gesellschaft gemeinsam mit dem Weizmann-Institut den Weg bahnte.
Auch nach innen entfaltete sich, wenn auch zunächst unter der Ägide von Wissenschaftlern, deren Karrieren noch durch das NS-System entscheidend geprägt worden waren, ein Modernisierungsprozess, der nicht nur die Neuausrichtung der wissenschaftlichen Tätigkeit betraf, sondern auch die Schaffung neuer, stärker auf Kollegialität und Mitwirkung angelegter Strukturen. Parallel dazu etablierte sich ein differenziertes Wissenschaftssystem, dessen Arbeitsteilung unter Einschluss einer besonderen Rolle für die an reiner Erkenntnis orientierte Forschung, nicht nur das Ergebnis wissenschaftspolitischer Aushandlungsprozesse war, sondern zunehmend auch zu einem wesentlichen Teil des Selbstverständnisses der Wissenschaftler sowie ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung wurde.
Mit diesen Bemerkungen lässt sich allerdings noch kein Schlussstrich unter eine historische Betrachtung, selbst nur der frühen Phase der Max-Planck-Gesellschaft, setzen. Zu wenig ist noch bekannt über die Wechselwirkungen zwischen ihrer institutionellen und personellen Entwicklung und ihren Forschungsleistungen. Wie erfolgreich war die Max-Planck-Gesellschaft letztlich als Katalysator für wissenschaftliche Durchbrüche? Hat sie es wirklich stets vermocht, anders als ihre Vorgängerorganisation, Wissenschaft zu betreiben, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und der Folgen ihres Tuns bewusst ist? Auf solche Fragen können erst zukünftige historische Forschungen Antworten geben.
Danksagung
Die Autoren sind insbesondere den ehemaligen Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Reimar
Widmung
Dem Andenken an Lorenz
Bibliographie
Albrecht, Helmuth (1993). Max Planck „Mein Besuch bei Adolf Hitler“: Anmerkungen zum Wert einer historischen Quelle. In: Naturwissenschaft und Technik in der Geschichte Ed. by Helmuth Albrecht. Stuttgart: GNT Verlag 41-63
Albrecht, Helmuth und Armin Hermann (1990). Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Dritten reich(1922–1945). In: Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft Ed. by Rudolf Vierhaus, Bernhard vom Brocke. Stuttgart: DVA 356-406
Aly, Götz (1984) Bericht, 4. Juli 1984, Archiv der MPG, II. Abt., Rep. 1F, Az-A-II-1a, Besondere Aufgaben Hirnschnittsammlung.
Beck, Lorenz Friedrich (2008). Max Planck und die Max-Planck-Gesellschaft: Zum 150. Geburtstag am 23. April 2008 aus den Quellen zusammengestellt vom Archiv der Max-Planck-Gesellschaft. Berlin: Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft.
Bergemann, Claudia (1990). Mitgliederverzeichnis der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Berlin: Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft.
Beyler, Richard (2004). „Reine Wissenschaft“ und personelle Säuberung: Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft 1933 und 1945 (Ergebnisse: Vorabdrucke aus dem Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“, Nr. 16). Berlin: Max-Planck-Gesellschaft.
Birkenfeld, Wolfgang (1964). Der synthetische Treibstoff 1933–1945: Ein Beitrag zur nationalsozialistischen Wirtschafts- und Rüstungspolitik. Göttingen, Berlin, Frankfurt am Main: Musterschmidt-Verlag.
Bödeker, Hans Erich (2010). Das Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften. In: Denkorte: Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft; Brüche und Kontinuitäten 1911–2011 Ed. by Peter Gruss, Reinhard Rürup. Dresden: Sandstein Verlag 306-315
Boenke, Susan (1991). Entstehung und Entwicklung des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik 1955–1971. Frankfurt am Main, New York: Campus Verlag.
Bortfeldt, J., W. Hauser, W. H. (1987). 100 Jahre Physikalisch-technische Reichsanstalt/Bundesanstalt 1887–1987. Weiheim: Physik-Verlag.
Bosch, Carl (1933). Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Informationsdienst: Amtliche Korrespondenz der Deutschen Arbeitsfront
Braunthal, Gerard (1992). Politische Loyalität und öffentlicher Dienst: der „Radikalenerlaß“ von 1972 und die Folgen. Marburg: Schüren.
Brocke, Bernhard vom (1985). ‚Wissenschaft und Militarismus`: Der Aufruf der 93 ‚An die Kulturwelt!` und der Zusammenbruch der internationalen Gelehrtenrepublik im Ersten Weltkrieg. In: Wilamowitz nach 50 Jahren Ed. by William III Chandler, Hellmut Flashar, H. F.. Darmstadt: Wiss. Buchges. 649-719
- (1990). Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Kaiserreich: Vorgeschichte, Gründung und Entwicklung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. In: Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft Ed. by Rudolf Vierhaus, Bernhard vom Brocke. Stuttgart: DVA 17-162
Butenandt, Adolf (1961). Über den Standort der Max-Planck-Gesellschaft im Wissenschaftsgefüge der Bundesrepublik Deutschland: Ansprache des Präsidenten bei der 12. Hauptversammlung der MPG am 8.6.1961 in Berlin. In: 50 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 1911–1961: Beiträge und Dokumente Göttingen: Max-Planck-Gesellschaft 7-19
- (1964). Ansprache in der Festversammlung der MPG in Hamburg am 11. Juni 1964. In: MPG-Jahrbuch 1964 Göttingen: Max-Planck-Gesellschaft 24-38
- (1970). Ansprache in der Festversammlung der MPG in Saarbrücken am 12. Juni 1970. In: MPG-Jahrbuch 1970 Göttingen: Max-Planck-Gesellschaft 30-42
- (1971). Ansprache in der Festversammlung der MPG in Berlin am 25. Juni 1971. In: MPG-Jahrbuch 1971 Göttingen: Max-Planck-Gesellschaft 29-42
- (1981). Ansprache zur Jahreshauptversammlung 1964. In: Das Werk eines Lebens Ed. by Adolf Butenandt. München, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
Cahan, David (1992). Meister der Messung: die Physikalisch-Technische Reichsanstalt im Deutschen Kaiserreich. Weinheim: Wiley-VCH.
Carson, Cathryn (1999). New Models for Science in Politics: Heisenberg in West Germany. Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 30(1): 115-171
- (2010). Heisenberg in the Atomic Age: Science and the Public Sphere. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
Cassidy, David C. (2002). „Kopenhagen“ und die Geschichtswissenschaft. In: Kopenhagen: Stück in zwei Akten: Mit zwölf wissenschaftlichen Kommentaren Ed. by Michael Frayn. Göttingen: Wallstein-Verlag 163-165
Castagnetti, Giuseppe, Hubert Goenner (2004). Directing a Kaiser-Wilhelm-Institute: Albert Einstein - Organizer of Science?. Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte.
Deichmann, Ute (2001). Flüchten, Mitmachen, Vergessen: Chemiker und Biochemiker in der NS-Zeit. Weinheim: Wiley-VCH.
Ebersold, Bernd (1998). 50 Jahre im Dienste der Gesellschaft: Zur Entwicklung der Max-Planck-Gesellschaft als Forschungsorganisation. In: Forschung an den Grenzen des Wissens: 50 Jahre Max-Planck-Gesellschaft 1948–1998 Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 155-173
Eckart, Wolfgang U. (2010). Das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg. In: Denkorte: Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011 Ed. by Peter Gruss, Reinhard Rürup. Dresden: Sandstein Verlag 174-183
Eibl, Christina (1999) Der Physikochemiker Peter Adolf Thiessen als Wissenschaftsorganisator (1899–1990): Eine biographische Studie. phdthesis. Historisches Institut der Universität Stuttgart, Abteilung für Geschichte der Naturwissenschaften und Technik
Einstein, Albert (1975). Über den Frieden: Weltordnung oder Weltuntergang?. Bern: Lang.
Engel, Michael (1984). Geschichte Dahlems. Berlin: Berlin-Verlag Spitz.
Epple, Moritz (2002). Rechnen, Messen, Führen: Kriegsforschung am Kaiser-Wilhelm-Institut für Strömungsforschung, 1937–1945. In: Rüstungsforschung im Nationalsozialismus: Organisation, Mobilisierung und Entgrenzung der Technikwissenschaften Ed. by Helmut Maier. Göttingen: Wallstein 305-356
Ertl, Gerhard (2010). Die Geschichte als Ansporn nutzen. In: Denkorte: Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011 Ed. by Peter Gruss, Reinhard Rürup. Dresden: Sandstein Verlag 92-95
Frank, Charles (1993). Operation Epsilon: Die Farm-Hall-Protokolle oder Die Angst der Alliierten vor der deutschen Atombombe. Berlin: Rowohlt.
Frayn, Michael (2002). Kopenhagen: Stück in zwei Akten: Mit zwölf wissenschaftlichen Kommentaren. Göttingen: Wallstein-Verlag.
Gausemeier, Bernd (2003). Natürliche Ordnungen und politische Allianzen: Biologische und Biochemische Forschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten 1933–1945 (Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, Bd. 12). Göttingen: Wallstein.
Generalverwaltung der MPG (1961). 50 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: Beiträge und Dokumente. Göttingen: Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft.
Gerwin, Robert (1996). Im Windschatten der 68er ein Stück Demokratisierung: Die Satzungsreform von 1972 und das Harnack-Prinzip. In: Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute. Studien zu ihrer Geschichte: Das Harnack-Prinzip Ed. by Bernhard vom Brocke, Hubert Laitko. Berlin, New York: De Gruyter 211-224
Glum, Friedrich (1928). Die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. In: Handbuch der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften Ed. by Adolf von Harnack. Berlin: Reimar Hobbing 11-37
- (1930a). Das geheime Deutschland: Die Aristokratie der demokratischen Gesinnung. Berlin: Stilke.
- (1930b). Die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: Ihre Forschungsaufgaben, ihre Institute und ihre Organisation. In: Forschungsinstitute: Ihre Geschichte, Organisation und Ziele Ed. by Ludolph Brauer, Albrecht Mendelssohn-Bartholdy, A. M.. Hamburg: Topos Ruggell 359-373
- (1964). Zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik: Erlebtes und Erdachtes in vier Reichen. Bonn: Bouvier.
Goebel, Wolfgang (1996). Max Bergmann und das Kaiser-Wilhelm-Institut für Lederforschung in Dresden. In: Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute: Das Harnack-Prinzip Ed. by Bernhard vom Brocke, Hubert Laitko. Berlin 303-318
Goudsmit, Samuel Abraham (1996 (1947)). ALSOS. New York: Woodbury.
Groeben, Christiane (2010). Das Deutsch-Italienische Institut für Meeresbiologie in Rovigno, Istrien. In: Denkorte: Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–201 Ed. by Peter Gruss, Reinhard Rürup. Dresden: Sandstein Verlag 196-203
Gruss, Peter, Reinhard Rürup (2010). Das Max-Planck-Institüt für Dynamik und Selbstorganisation, Göttingen. Dresden: Sandstein Verlag.
Hachtmann, Rüdiger (2004). Eine Erfolgsgeschichte? Schlaglichter auf die Geschichte der Generalverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im „Dritten Reich“. Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte.
- (2007a). Der Ertrag eines erfolgreichen Wissenschaftsmanagements: Die Entwicklung wichtiger Kaiser-Wilhelm-Institute 1929 bis 1944. In: Gemeinschaftsforschung, Bevollmächtigte und der Wissenstransfer: Die Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im System kriegsrelevanter Forschung des Nationalsozialismus Ed. by Helmut Maier. Göttingen: Wallstein 561-598
- (2007b). Wissenschaftsmanagement im „Dritten Reich“: Geschichte der Ge-neralverwaltung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, 2 Bde.. Göttingen: Wallstein.
Hahn, Otto (1955). Cobalt 60 - Gefahr oder Hoffnung?. Göttingen: Musterschmidt.
- (1960). Ansprache in Festversammlung der MPG, Bremen 19. Mai 1960. Jahrbuch der MPG
- (1968). Mein Leben. München: Bruckmann.
- (1979). Otto Hahn: Begründer des Atomzeitalters. Eine Biographie in Bildern und Dokumenten. Mit einem Geleitwort von Reimar Lüst, einem Vorwort von Paul Matussek und einer Einführung von Walther Gerlach. München: List Verlag.
- (1986). Mein Leben. München: Piper.
Hahn, Ralf (1999). Gold aus dem Meer: Die Forschungen des Nobelpreisträgers Fritz Haber in den Jahren 1922–1927. Berlin: Verlag für Geschichte der Naturwissenschaften und der Technik.
Harnack, Adolf (1909/1961). Denkschrift von Harnack an den Kaiser: Berlin, den 21. November 1909. In: 50 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, 1911–1961 Göttingen 80-94
Harnack, Adolf von (2001). Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. In: Wissenschaftspolitische Reden und Aufsätze Ed. by Bernhard Fabian. Hildesheim u. a.: Georg Olms Verlag 75-86
Hayes, Peter (1987). Industry and Ideology: IG Farben in the Nazi Era. Cambridge: Cambridge University Press.
- (1992). Zur umstrittenen Geschichte der I.G. Farbenindustrie AG. Geschichte und Gesellschaft 18(3): 405-417
- (2000). Industry and Ideology: I.G. Farben in the Nazi Era. Cambridge, MA: Cambridge University Press.
- (2005). Die Degussa im Dritten Reich: Von der Zusammenarbeit zur Mittäterschaft. München: C.H. Beck.
Hecht, Hartmut, Dieter Hoffmann, D. H. (1991). Robert Havemann: Dokumente eines Lebens. Berlin: Ch. Links Verlag.
Heim, Susanne (2002a). Autarkie und Ostexpansion: Pflanzenzucht und Agrarforschung im Nationalsozialismus. Göttingen: Wallstein.
- (2002b). „Die reine Luft der wissenschaftlichen Forschung“. Zum Selbstverständnis der Wissenschaftler der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.. Berlin: Ergebnisse 7. Vorabdrucke aus dem Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“.
- (2003). Kalorien, Kautschuk, Karrieren: Pflanzenzüchtung und landwirtschaftliche Forschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten 1933–1945. Göttingen: Wallstein.
Heinemann, Manfred (1990). Der Wiederaufbau der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und die Neugründung der Max-Planck-Gesellschaft (1945–1949). In: Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Gesellschaft Ed. by Rudolf Vierhaus, Bernhard vom Brocke. Stuttgart: Dt. Verl.-Anst. 407-470
- (2001). Überwachung und ‚Inventur` der deutschen Forschung: Das Kontrollratsgesetz Nr. 25 und die alliierte Forschungskontrolle im Bereich der Kaiser-Wilhelm/Max-Planck-Gesellschaft (KWG/MPG). In: Politischer Systemumbruch als irreversibler Fehler von Modernisierung in der Wissenschaft? Ed. by Lothar Mertens. Stuttgart: Duncker & Humblot 167-200
- (2013). Die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) und das Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (1948–1981). In: Physik im Kalten Krieg: Beiträge zur Physikgeschichte während des Ost-West-Konflikts Ed. by Christian Forstner, Dieter Hoffmann. Wiesbaden: Springer Spektrum 175-194
Heinemann, Manfred, Ulrich Schneider (1990). Hochschuloffiziere und Wiederaufbau des Hochschulwesens in Westdeutschland 1945–1952. Hildesheim: Edition Bildung und Wissenschaft im Verlag.
Henning, Eckart (2004a). Althoffs Vermächtnis für Dahlem. Zur Erschließung des Domänenlands für Staatsbauten. In: Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte Dahlems (= Veröffentlichungen aus dem Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft Bd.13) Ed. by Eckart Henning. Berlin: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. 22-37
- (2004b). Max Planck - ‚ein armer Wirrkopf` als Kollaborateur der Nazis?. In: ‚... immer im forschen bleiben`. Rüdiger vom Bruch zum 60. Geburtstag [Festschrift] Ed. by Marc Schalenberg, Peter Th. Walther. Stuttgart: Steiner 351-371
Henning, Eckart, Marion Kazemi (2011). Chronik der Kaiser-Wilhelm-, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: 1911–2011; Daten und Quellen. Berlin: Duncker & Humblot.
Hoffmann, Dieter (1993). Operation Epsilon: Die Farm-Hall Protokolle. Berlin: Rowohlt.
- (2008). Die Entstehung der modernen Physik. München: C.H. Beck.
Hoffmann, Dieter und Ulrich (2006). Wolfgang Gentner: Ein Physiker als Naturalist.. In: Wolfgang Gentner: Festschrift zum 100. Geburtstag Ed. by Dieter Hoffmann, Ulrich Schmidt-Rohr. Berlin/Heidelberg/New York: Springer 1-60
Hoffmann, Dieter, Hermann Simon (2010). Leopold Koppel (1854–1933): Bankier, Philanthrop, Wissenschaftsmäzen. Berlin: Hentrich und Hentrich.
Huebener, Rudolf P., Heinz Lübbig (2008). A Focus of Discoveries. Singapore: World Scientific.
Hughes, Thomas P. (1975). Das ‚technologische Momentum`: in der Geschichte. Zur Entwicklung des Hydrierverfahrens in Deutschland. In: Moderne Technikgeschichte Ed. by Karin Hausen, Reinhard Rürup. Köln 358-383
Jentsch, Volker, Helmut Kopka, H. K. (1972). Ideologie und Funktion der Max-Planck-Gesellschaft. Blätter für deutsche und internationale Politik: Monatszeitschrift 17(5): 476-503
Johnson, Jeffrey A. (1990). Vom Plan einer Chemischen Reichsanstalt zum ersten Kaiser-Wilhelm-Institut: Emil Fischer. In: Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft Ed. by Bernhard vom Brocke, Rudolf Vierhaus. Stuttgart: DVA 486-515
Kant, Horst (2002). Vom KWI für Chemie zum KWI für Radioaktivität: Die Abteilung(en) Hahn/Meitner am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie. In: Dahlemer Archivgespräche Berlin: Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft 57-92
- (2005). Albert Einstein und das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik. In: Albert Einstein: Ingenieur des Universums. Hundert Autoren für Einstein Ed. by Jürgen Renn. Weinheim: Wiley-VCH 166-169
- (2008). Von der Lichttherapie zum Zyklotron: Das Institut für Physik im Heidelberger Kaiser-Wilhelm-Institut für Medizinische Forschung bis 1945. In: Dahlemer Archivgespräche Berlin: Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft 49-92
- (2010). Max Planck-Institut für Physik. In: Denkorte: Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011 Ed. by Peter Gruss, Reinhard Rürup. Dresden: Sandstein Verlag 316-323
- (2011a). Integration und Segregation: Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Medizinische Forschung in Heidelberg zwischen interdisziplinärem Verbund und Ensemble disziplinärer Institute. In: Interdisziplinarität und Institutionalisierung der Wissenschaft: Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2010 Ed. by Klaus Fischer, Hubert Laitko, H. L.. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag 175-197
- (2011b). Peter Debye als Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in Berlin. In: „Fremde“ Wissenschaftler im Dritten Reich: Die Debye-Affäre im Kontext Ed. by Dieter Hoffmann, Mark Walker. Göttingen: Wallstein 76-109
- (2012). Otto Hahn und die Erklärungen von Mainau (1955) und Göttingen (1957). In: Vom atomaren Patt zu einer von Atomwaffen freien Welt. Zum Gedenken an Klaus Fuchs. (= Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften Bd.32) Ed. by Günter und Klaus Fuchs-Kittowski Flach. Berlin: trafo Wissenschaftsverlag 183-197
Kant, Horst, Carsten Reinhardt (2012). 100 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-Institut): Facetten seiner Geschichte. Im Auftrag des Direktoriums des MPI für Chemie. Berlin: Max-Planck-Gesellschaft.
Kant, Horst, Jürgen Renn (2013). Eine utopische Episode: Carl Friedrich von Weizsäcker in den Netzwerken der Max-Planck-Gesellschaft. Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte.
Kazemi, Marion (2006). Nobelpreisträger in der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Berlin: Archiv der MPG.
- (2007). Biologie in Berlin: Die biologischen Institute der Kaiser-Wilhelm- /Max-Planck-Gesellschaft. In: Lebenswissen: Eine Einführung in die Geschichte der Biologie Ed. by Ekkehard Höxtermann, Hartmut H. Hilger. Rangsdorf: Natur & Text 394-423
Kieven, Elisabeth (2010). Bibliotheca Hertziana Rom. In: Denkorte: Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011 Ed. by Peter Gruss, Reinhard Rürup. Dresden: Sandstein Verlag 96-105
Kirsten, Christa, Hans-Jürgen Treder (1979). Einstein in Berlin: Darstellungen und Dokumente,. Berlin: Akademie Verlag.
Klee, Ernst (1985). „Euthanasie“ im NS-Staat: Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. Frankfurt a.M.: Fischer-Taschenbuch-Verl..
- (2003). Das Personenlexikon zum Dritten Reich: Wer war was vor und nach 1945?. Frankfurt a.M.: S. Fischer.
- (2004). Was sie taten - was sie wurden: Ärzte, Juristen und andere Beteiligte am Kranken- oder Judenmord. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Verlag.
Kohl, Ulrike (2002). Die Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus: Max Planck, Carl Bosch und Albert Vögler zwischen Wissenschaft und Macht. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Kreutzmüller, Christoph (2005). Zum Umgang der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit Geld und Gut: Immobilientransfers und jüdische Stiftungen 1933–1945. Berlin: Forschungsprogramm Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Ges. im Nationalsozialismus.
Kunze, Rolf-Friedrich (2005). Ernst Rabel und das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht 1926–1945. Göttingen: Wallstein.
Laitko, Hubert (1991). Friedrich Althoff und die Wissenschaft in Berlin: Konturen einer Strategie. In: Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftspolitik im Industriezeitalter: Das „System Althoff“ in historischer Perspektive Ed. by Bernhard vom Brocke. 69-85
- (2011). Das Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt: Gründungsintention und Gründungsprozess. In: Interdisziplinarität und Institutionalisierung der Wissenschaft: Wissenschaftsforschung Jahrbuch 2010 Ed. by Klaus Fischer, Hubert Laitko, H. L.. Berlin: Wissenschaftlicher Verlag 199-237
Lässing, Volker (2013). Forschung im Schatten der Zollernburg: Die Kaiser-Wilhelm-Institute und ihre Nobelpreisträger in Hechingen, Haigerloch und Tailfingen. Albstadt: CM-Verlag.
Leendertz, Ariane (2010). Die pragmatische Wende: Die Max-Planck-Gesellschaft und die Sozialwissenschaften 1975–1985. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Lewis, Jeffrey (2004). Kalter Krieg in der Max-Planck-Gesellschaft: Göttingen und Tübingen: eine Vereinigung mit Hindernissen, 1948–1949. In: Adolf Butenandt und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft: Wissenschaft, Industrie und Politik im „Dritten Reich“ Ed. by Wolfgang Schieder, Achim Trunk. Göttingen: Wallstein 403-443
Lohff, Brigitee, Hinrick Conrads (2007). From Berlin to New York: Life and Work of the almost forgotten German-Jewish biochemist Carl Neuberg (1877–1956). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Löser, Bettina (1996). Zur Gründungsgeschichte und Entwicklung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Faserstoffchemie in Berlin-Dahlem (1914/19–1934). In: Die Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute: Das Harnack-Prinzip Ed. by Bernhard vom Brocke, Hubert Laitko. Berlin: De Gruyter 275-302
Luxbacher, Günther (2004). Roh- und Werkstoffe für die Autarkie. Berlin: Präsidentenkommission.
Mackrakis, Kristie (1986). Wissenschaftsförderung durch die Rockefeller-Stiftung im Dritten Reich: die Entscheidung, das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik finanziell zu unterstützen. Geschichte und Gesellschaft 12: 348-379
Mahoney, Leo James (1981) A History of the War Department Scientific Intelligence Mission (ALSOS), 1943–1945. phdthesis. Kent State University
Maier, Helmut (2002). Ideologie, Rüstung und Ressourcen: Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung und die „Deutschen Metalle“ 1933–1945. In: Rüstungsforschung im Nationalsozialismus: Organisation, Mobilisierung und Entgrenzung der Technikwissenschaften Ed. by Helmut Maier. Göttingen: Wallstein 357-388
- (2007a). Forschung als Waffe: Rüstungsforschung in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und das Kaiser-Wilhelm-Institut für Metallforschung 1900–1945/48, 2 Bde.. Göttingen: Wallstein.
- (2007b). Gemeinschaftsforschung, Bevollmächtigte und der Wissenstransfer: Die Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im System kriegsrelevanter Forschung des Nationalsozialismus. Göttingen: Wallstein.
Markl, Hubert (1998). Blick zurück, Blick voraus: Über den Gründungsauftrag, in „völliger Freiheit und Unabhängigkeit“ zu forschen. In: Forschung an den Grenzen des Wissens: 50 Jahre Max-Planck-Gesellschaft 1948–1998 Göttingen: Max-Planck-Gesellschaft
Marsch, Edmund (2003). Adolf Butenandt als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft 1960–1972. In: Dahlemer Archivgespräche Berlin: Archiv zur Geschichte der der Max-Planck-Gesellschaft 134-145
Meitner, Lise (1958). Max Planck als Mensch. Die Naturwissenschaften 45: 406-408
Müller-Hill, Benno (1984). Tödliche Wissenschaft: Die Aussonderung von Juden, Zigeunern und Geisteskranken. Reinbek: Rowohlt.
Nickel, Dietmar K. (2006). Wolfgang Gentner und die Begründung der deutsch-israelischen Wissenschaftsbeziehungen. In: Wolfgang Gentner: Festschrift zum 100. Geburtstag Ed. by Dieter Hoffmann, Ulrich Schmidt-Rohr. Berlin/Heidelberg/New York: Springer 147-170
Nolte, Paul (2008). Der Wissenschaftsmacher, Reimar Lüst im Gespräch mit Paul Nolte. München: C.H. Beck.
Oexle, Otto Gerhard (2003). Hahn, Heisenberg und die anderen. Anmerkungen zu ‚Kopenhagen`, ‚Farm Hall` und ‚Göttingen`. Berlin: Forschungsprogramm Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Ges. im Nationalsozialismus.
Osietzki, Maria (1984). Wissenschaftsorganisation und Restauration. Der Aufbau außeruniversitärer Forschungseinrichtungen und die Gründung des westdeutschen Staates 1945–1952. Köln u. Wien: Böhlau.
Ostwald, Wilhelm (1906). Die chemische Reichsanstalt. Leipzig: Akademische Verlagsanstalt.
Pash, Boris T. (1969). The Alsos Mission. NewYork.
Petzina, Dietmar (1966). Autarkiepolitik im Dritten Reich. Stuttgart: DVA.
Pfeiffer, Jürgen (2000). Neuropathologische Forschung an „Euthanasie“-Opfern in zwei Kaiser-Wilhelm-Instituten. In: Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus: Bestandsaufnahme und Perspektiven der Forschung Ed. by Doris Kaufmann. Göttingen: Wallstein 667-698
Pfuhl, Kurt (1959). Das Königsteiner Abkommen. In: Mitteilungen aus der Max-Planck-Gesellschaft H.5
Picht, Georg (1964). Die deutsche Bildungskatastrophe, Analyse und Dokumentation. Oten/Freiburg im Breisgau: Walter Verlag.
Planck, Max (1934). Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. In: Der Kaiser: Wie er war - wie er ist Ed. by Friedrich Everling, Adolf Günther. Berlin: Traditionsverlag Kolk 169-172
Plesser, Theo, Rolf Kinne (2010). Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie, Berlin-Dortmund. In: Denkorte: Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011 Ed. by Peter Gruss, Reinhard Rürup. Dresden: Sandstein Verlag 278-287
Plesser, Theo, Hans-Ulrich Thamer (2012). Arbeit, Leistung und Ernährung: Vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeitsphysiologie in Berlin zum Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie und Leibniz Institut für Arbeitsforschung in Dortmund. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Plumpe, Gottfried (1990). Die I.G. Farbenindustrie AG: Wirtschaft, Technik und Politik 1904–1945. Berlin.
Powers, Thomas (1993). Heisenberg's War: The Secret History of the German Bomb. New York: Alfred A. Knopf.
Proctor, Robert N. (2000). Adolf Butenandt: Nobelpreisträger, Nationalsozialist und MPG-Präsident. Adresse fehlt: Ergebnisse 2: Vorabdrucke aus dem Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“.
Przyrembel, Alexandra, Friedrich Glum, F. G. (2004). Die Generalsekretäre der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft: Handlungsfelder und Handlungsoptionen der ‚Verwaltenden` von Wissen während des Nationalsozialismus. Berlin: Forschungsprogramm Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Ges. im Nationalsozialismus.
Pufendorf, Astrid von (2006). Wie Hitler Planck umbrachte. Cicero
Rasch, Manfred (1989). Geschichte des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Kohlenforschung. Weinheim: Wiley-VCH.
- (1996). Das Schlesische Kohlenforschungsinstitut der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. In: Die Kaiser- Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft und ihre Institute: Das Harnack-Prinzip Ed. by Bernhard vom Brocke, Hubert Laitko. Berlin: De Gruyter 173-210
Rauchhaupt, Ulf von (2000). To Venture Beyond the Atmosphere: Aspects of the Foundation of the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics. Berlin: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte.
- (2002). Coping with a New Age: The Max Planck Society and the Challenge of Space Science in the Early 1960s. Max-Planck-Forum 5: 197-205
Rebenich, Stefan (1997). Theodor Mommsen und Adolf Harnack: Wissenschaft und Politik im Berlin des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Abschnitt III: Die Kirchenväterkommission. Berlin, New York: De Gruyter.
Renn, Jürgen (2006). Auf den Schultern von Riesen und Zwergen: Einsteins unvollendete Revolution. Weinheim: Wiley-VCH.
Renn, Jürgen, Giuseppe Castagnetti, G. C. (1999). Albert Einstein: Alte und neue Kontexte in Berlin. In: Die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften zu Berlin im Kaiserreich Ed. by Jürgen Kocka. Berlin: Akademie Verlag 333-354
- (2001). Adolf von Harnack und Max Planck (1851–1930). In: Adolf von Harnack: Theologe, Historiker, Wissenschaftspolitiker Ed. by Kurt Nowak, Otto Gerhard Oexle. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 127-155
Rose, Paul Lawrence (2001). Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project: A Study in German Culture. Berkeley: University of California Press,.
Rösener, Werner (2014). Das Max-Planck-Institut für Geschichte (1956–2006): Fünfzig Jahre Geschichtsforschung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Rossiter, Margaret W. (1993). The Matthew Matilda Effect in Science. In: Social Studies of Science London: SAGE 325-341
Rürup, Reinhard (2008a). Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften im Nationalsozialismus: Ergebnisse des Forschungsprogramms der Max-Planck-Gesellschaft. In: Dahlemer Archivgespräche Berlin: Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft 171-196
- (2008b). Schicksale und Karrieren: Gedenkbuch für die von den Nationalsozialisten aus der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vertriebenen Forscherinnen und Forscher. Göttingen: Wallstein.
Sachse, Carola (2002). „Persilscheinkultur“: Zum Umgang mit der NS-Vergangenheit in der Kaiser-Wilhelm / Max-Planck-Gesellschaft. In: Akademische Vergangenheitspolitik: Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte der Nachkriegszeit Ed. by Bernd Weißbrod. Göttingen: Zeitgeschichtlicher Arbeitskreis Niedersachsen 217-246
- (2003). Die Verbindung nach Auschwitz: Biowissenschaften und Menschenversuche an Kaiser-Wilhelm-Instituten. Dokumentation eines Symposiums im Juni 2001. Göttingen: Wallstein.
- (2004). Adolf Butenandt und Otmar von Verschuer: Eine Freundschaft unter Wissenschaftlern. In: Adolf Butenandt und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft Ed. by Wolfgang Schieder, Achim Trunk. Göttingen: Wallstein 286-319
- (2009). What Research, to What End? The Rockefeller Foundation and the Max Planck Society in the Early Cold War. Central European History 42: 97-141
Schieder, Wolfgang (2004). Spitzenforschung und Politik: Adolf Butenandt in der Weimarer Republik und im „Dritten Reich“. In: Adolf Butenandt und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft: Wissenschaft, Industrie und Politik im „Dritten Reich“ Ed. by Wolfgang Schieder, Achim Trunk. Göttingen: Wallstein 23-77
Schmaltz, Florian (2005). Kampfstoff-Forschung im Nationalsozialismus: Zur Kooperation von Kaiser-Wilhelm-Instituten, Militär und Industrie. Göttingen: Wallstein.
- (2006). Otto Bickenbach's Human Experiments with Chemical Warfare Agents at the Concentration Camp Natzweiler in the Context of the SS-Ahnenerbe and the Reichsforschungsrat. In: Man, Medicine and the State: The Human Body as an Object of Government Sponsored Research in the 20th Century Ed. by Wolfgang U. Eckart. Stuttgart: Steiner Verlag 205-231
- (2007). Peter Adolf Thiessen und Richard Kuhn und die Chemiewaffenforschung im NS-Regime. In: Gemeinschaftsforschung, Bevollmächtigte und der Wissenstransfer: Die Rolle der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im System kriegsrelevanter Forschung des Nationalsozialismus Ed. by Helmut Maier. Göttingen: Wallstein 305-351
- (2008). Richard Kuhn. In: New Dictionary of Scientific Biography Ed. by Noretta Koertge. Detroit, New York: Thomson Gale 167-170
Schmidt-Ott, Friedrich (1961). Althoffs Pläne für Dahlem. In: 50 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften: Beiträge und Dokumente Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften Göttingen: Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft 64-68
Scholtyseck, Joachim (1999). Robert Bosch und der liberale Widerstand gegen Hitler 1933 bis 1945. München: C.H. Beck.
Schüring, Michael (2004). Der Vorgänger: Carl Neubergs Verhältnis zu Adolf Butenandt. In: Adolf Butenandt und die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft: Wissenschaft, Industrie und Politik im ‚Dritten Reich` Ed. by Wolfgang Schieder, Achim Trunk. Göttingen: Wallstein 369-403
- (2006). Minervas verstoßene Kinder: Vertriebene Wissenschaftler und die Vergangenheitspolitik der Max-Planck-Gesellschaft. Göttingen: Wallstein.
Sime, Ruth Lewin (2001). Lise Meitner: Ein Leben für die Physik. Frankfurt am Main: Insel Verlag.
- (2004). Otto Hahn und die Max Planck-Gesellschaft: Zwischen Vergangenheit und Erinnerung. Berlin.
Smilansky, Uzy und Hans A. Weidenmüller (2006). Die Wirkung des Minerva-Programms. In: Wolfgang Gentner: Festschrift zum 100. Geburtstag Ed. by Dieter Hoffmann, Ulrich Schmidt-Rohr. Berlin/Heidelberg/New York: Springer 171-175
Speer, Albert (2005). Erinnerungen. Berlin: Ullstein.
Staab, Heinz A. (1986). Kontinuität und Wandel einer Wissenschaftsorganisation: 75 Jahre Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft. Max-Planck-Gesellschaft Jahrbuch
Stamm-Kuhlmann, Thomas (1990). Deutsche Forschung und internationale Integration 1945–1955. In: Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft Ed. by Bernhard vom Brocke, Rudolf Vierhaus. Stuttgart: Forschungsprogramm Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Ges: im Nationalsozialismus
Steinhauser, Thomas, Jeremiah James, J. J., Hoffmann Jeremiah (2011). Hundert Jahre an der Schnittstelle von Chemie und Physik: Das Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft zwischen 1911 und 2011. Berlin: De Gruyter.
Stoff, Heiko (2005). Eine zentrale Arbeitsstätte mit nationalen Zielen: Wilhelm Eitel und das Kaiser-Wilhelm-Institut für Silikatforschung 1926–1945. Berlin: Forschungsprogramm Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Ges. im Nationalsozialismus.
Sucker, Ulrich (2002). Das Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie: Seine Gründungsgeschichte, seine problemgeschichtlichen und wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen (1911–1916). Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Szöllösi-Janze, Margit (1998). Fritz Haber 1868–1934: Eine Biographie. München: C.H. Beck.
Tammen, Helmuth (1978). Die I. G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft (1925–1933): Ein Chemiekonzern in der Weimarer Republik. Berlin: H. Tammen.
Thoms, Ulrike (2012). Das Max-Planck-Institut für Ernährungsphysiologie und die Nachkriegskarriere von Heinrich Kraut. In: Arbeit, Leistung und Ernährung: Vom Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeitsphysiologie in Berlin zum Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie und Leibniz Institut für Arbeitsforschung in Dortmund Ed. by Theo Plesser, Hans-UlrichThamer. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 259-356
Toledano, Raphaël (2010) Les Expériences Médicales du Professeur Eugen Haagen de la Reichsuniversität Strassburg. Faits, Contexte et Procès d'un Médecin National-Socialiste, Faculté de Médicine. Diss. med.. Universität Straßburg
Trunk, Achim (2003). Zweihundert Blutproben aus Auschwitz: Ein Forschungsvorhaben zwischen Anthropologie und Biochemie (1943–1945). Berlin: Ergebnisse 12. Vorabdrucke aus dem Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“.
- (2010). Max-Planck-Institut für Biochemie. Berlin-Martinsried. In: Denkorte: Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011 Ed. by Peter Gruss, Reinhard Rürup. Dresden: Sandstein Verlag
Ungern-Sternberg, Jürgen, Wolfgang Ungern-Sternberg (1996). Der Aufruf ‚An die Kulturwelt!`: das Manifest der 93 und die Anfänge der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg ; mit einer Dokumentation. Stuttgart.
Vierhaus, Rudolf (1990). Bemerkungen zum sogenannten Harnack-Prinzip: Mythos und Realität. In: Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft Ed. by Rudolf Vierhaus, Bernhard vom Brocke. Stuttgart: DVA 129-144
Vierhaus, Rudolf, Bernhard vom Brocke (1990). Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft..
Walker, Mark (2003). Otto Hahn: Verantwortung und Verdrängung. Berlin.
- (2005). Eine Waffenschmiede? Kernwaffen- und Reaktorforschung am Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik. Berlin: Ergebnisse 26. Vorabdrucke aus dem Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“.
Weber, Matthias M., Wolfgang Burgmair (2010). Das Max-Planck-Institut für Psychiatrie: Deutsche Forschungsanstalt für Psychiatrie München. In: Denkorte: Max-Planck-Gesellschaft und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Brüche und Kontinuitäten 1911–2011 Ed. by Peter Gruss, Reinhard Rürup. Dresden: Sandstein Verlag 164-173
Weindling, Paul (2009). Virologist and National Socialist: The Extraordinary Career of Eugen Haagen. In: Infektion und Institution: Zur Wissenschaftsgeschichte des Robert-Koch-Instituts im Nationalsozialismus Ed. by Marion Hulverscheidt, Anja Laukötter. Göttingen: Wallstein-Verlag 232-249
- (2012). `Cleansing' Anatomical Collections: The Politics of Removing Specimens from German Anatomical and Medical Collections 1988–92. Annals of Anatomy 194: 237-242
Wirtz, Karl (1988). Im Umkreis der Physik. Karlsruhe: Kernforschungszentrum. Karlsruhe: Kernforschungszentrum.
Witt, Peter Christian (1990). Wissenschaftsfinanzierung zwischen Inflation und Deflation: Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1918/1919 bis 1934/35. In: Forschung im Spannungsfeld von Politik und Gesellschaft: Geschichte und Struktur der Kaiser-Wilhelm-/Max-Planck-Gesellschaft Ed. by Rudolf Vierhaus, Bernhard vom Brocke. Stuttgart: DVA 579-656
Zacher, Hans F. (1993). Forschung, Gesellschaft und Gemeinwesen. Heidelberg: C. F. Müller Juristischer Verlag.
- (1999). Forschung in Deutschland: Strukturen der Vielfalt: Strukturen der Ganzheit?. In: Festschrift für Martin Heckel Ed. by Karl-Hermann Kästner, Knut W. Nörr, K.W. N.. 941-974
Fußnoten
Ostwald (1906); Johnson (1990); Szöllösi-Janze (1998, insbesondere 198–207).
Einer der Autoren (JR) ist Hans F. Zacher dankbar für eine ausführliche kritische Stellungnahme zu einer früheren Fassung des Textes, der diese Gedanken entnommen sind.
Harnack (1909/1961, 82).
Harnack (1909/1961, 87), Hervorhebung im Original.
Ebd., 88.
Ebd., 66 f.
Auf Reichsebene war dagegen hauptsächlich das Reichsministerium des Innern zuständig.
Laitko (1991); Henning (2004a, 22–37).
1891 vom Berliner Aquarium Unter den Linden gegründet. Später als Deutsch-Italienisches Institut für Meeresbiologie von der KWG weitergeführt, siehe Groeben (2010).
Seit 2002 Kunsthistorisches Institut der MPG in Florenz.
Kehr war zugleich seit 1903 Direktor des Preußischen Historischen Instituts in Rom und war ebenso daran interessiert, die Bibliotheca Hertziana in die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zu überführen, wie Harnack selbst, der unter anderem im Beirat des Preußischen Historischen Instituts saß.
Ursprünglich war das KWI für Geschichte für 1913/14 mit Sitz in Rom geplant.
Das Institut wurde 1921 wieder nach Düsseldorf verlegt.
Harnack (1909/1961, 91). Bis Kriegsende waren 17 Kaiser-Wilhelm-Institute gegründet worden, von denen zehn zu diesem Zeitpunkt bereits ihre Arbeit selbständig aufgenommen hatten.
Die Königliche Bibliothek – ab 1918 Preußische Staatsbibliothek – befand sich in der sogenannten Kommode am Opernplatz, bis sie 1913/14 in den von Ernst von Ihne (1848–1917) errichteten Neubau Unter den Linden zog.
Vgl. Paragraf 4 und 5 der am 11. Januar 1911 beschlossenen Satzung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, unter anderem in 50 Jahre Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 1961, 126.
Szöllösi-Janze (1998, 214f.)
Vgl. zu Koppels Bedeutung als Mäzen für die KWG auch Kreutzmüller (2005); Hoffmann und Simon (2010) sowie Szöllösi-Janze (1998, 212–224).
Die Kriterien für eine Mitgliedschaft in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft/Max-Planck-Gesellschaft haben sich im Laufe der Zeit natürlich gewandelt, die Festlegungen in den jeweiligen Statuten sind auch nicht immer ganz eindeutig. Ursprünglich war ein Mitglied ein förderndes Mitglied, d.h. man zahlte einen Aufnahmebeitrag und jährliche Beiträge. Zudem ernannte der Senat Wissenschaftliche Mitglieder der Institute, die dort verantwortlich, d.h. in leitender Position, Forschung betrieben. In der Regel wurden die Direktoren Wissenschaftliche Mitglieder (ohne Beitragspflicht). Erst in der Satzung von 1925 wird festgeschrieben, dass diese Wissenschaftlichen Mitglieder zugleich Mitglieder der Gesamtgesellschaft sind. Zudem gab es auch Auswärtige Mitglieder und Ehrenmitglieder. Die Zuordnungen sind nicht immer eindeutig. Vgl. Bergemann (1990).
Vgl. Hachtmann (2007b, 101f.)
Glum habilitierte sich 1923 an der Berliner Universität für Staats- und Verwaltungsrecht und wurde 1925 aufgrund dieser fachlichen Qualifikation auch zum Wissenschaftlichen Mitglied des KWI für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht ernannt.
Vgl. Kohl (2002, 44f.).
Hachtmann (2007b, Tab. 1.4, 1253).
Gegenüber dem Gründungssenat verfügte beispielsweise der neue Senat nach 1921 über 23 Prozent weniger Mitglieder aus Industrie- und Bankgewerbe, 6,5 Prozent mehr Wissenschaftler, und die Mitgliedergruppe der Staatsbeamten, Politiker und „Sachverständigen“ betrug 20,5 Prozent. Vgl. Vierhaus und vom Brocke (1990, 216).
Niederschrift über die Sitzung des Verwaltungsausschusses der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften vom 10. Februar 1931, Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft (im Folgenden: MPG-Archiv), I. Abt., Rep. 1A, Nr. 91, Bl. 333.
Immerhin wurde Friedrich Ebert (1871–1925) 1922 zur Hauptversammlung eingeladen und nahm anschließend an der Eröffnung des KWI für Faserstoffchemie in Dahlem teil, und seit 1928 erhielt sein Nachfolger Paul von Hindenburg (1847–1934) jährlich von der Hauptversammlung ein Danktelegramm für die Unterstützung durch die Reichsregierung zugesandt.
Lediglich wurde die geisteswissenschaftliche Sektion um die Gebiete Sozial- und Humanwissenschaften erweitert, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch in der Max-Planck-Gesellschaft eine größere Rolle zu spielen begannen.
Zwar vertrat der Kaiser das Reich, doch war aufgrund der vornehmlichen Ansiedlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Berlin der preußische Staat in administrativen Fragen zuständig.
Witt (1990, 579–656).
Vgl. vom Brocke (1990, 284f.).
Der Name der am 30. Oktober 1920 auf Initiative von Fritz Haber und Friedrich Schmidt-Ott gegründeten Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft wurde 1929 in Deutsche Gemeinschaft zur Erhaltung und Förderung der Forschung, kurz Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, geändert.
Harnack (2001, 79). Harnack machte hier auch deutlich, dass diese finanzielle staatliche Unterstützung entsprechende Statutenänderungen nach sich zog, demzufolge preußischer Staat und Reich nun je ein Viertel der Senatoren wählten. Gegenüber dem preußischen Kultusminister Carl Heinrich Becker hatte Harnack 1929 seine Auffassung des Status der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft mit den Worten deutlich gemacht, dass „die Kaiser Wilhelm Institute private Institute und Staatsinstitute zugleich“ seien, zitiert nach Henning und Kazemi (2011, 144f.).
Das private Vermögen der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft war infolge von Krieg und Inflation durchaus nicht so stark geschrumpft, wie zumeist vermittelt wurde, denn dem langjährigen Schatzmeister der Gesellschaft, Franz von Mendelssohn, war es gelungen, zumindest einen Teil dieses Geldes über die Amsterdamer Filiale des Bankhauses Mendelssohn & Co zu retten, vgl. Hachtmann (2007b, 226).
Hachtmann (2007a, 141f.).
Die Förderung der Wissenschaften, in: Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Sonderbeilage der Münchener Neuesten Nachrichten 181(1928)156 vom 10. Juni. Eigentlich geht es jedoch bereits auf Theodor Mommsen (1817–1905) zurück, der bei Harnacks Wahl in die Preußische Akademie der Wissenschaften betont hatte, dass Großwissenschaft zwar nicht von Einem geleistet, aber von Einem geleitet werde. Theodor Mommsen 1890, Antwort auf die Antrittsrede von Adolph Harnack, zitiert nach Rebenich (1997, 72).
Glum (1930b, 360).
Siehe dazu auch den Beitrag von Hubert Laitko in diesem Band.
Siehe dazu den Beitrag von Helmuth Trischler in diesem Band.
Zur KWG/MPG in politischen Umbruchsituationen siehe auch den Beitrag von Mitchell Ash in diesem Band.
So Fritz Haber, Adolf von Harnack, Max Planck, August von Wassermann und Richard Willstätter (1872–1942).
Über Gaskampfstoffe hinaus reichte die Palette kriegswichtiger Forschungen von neuartigen Sprengstoffen über Schädlingsbekämpfungsmittel bis hin zu Gasmasken als Schutz vor Giftgasangriffen, unter anderem auch unter Beteiligung von Willstätter. Die industrielle Zusammenarbeit erfolgte beispielsweise mit den Farbenfabriken Bayer, der BASF und der Auer-Gesellschaft.
Vgl. Szöllösi-Janze (1998, 328f.). Es gab aber auch Wissenschaftler, die sich der Giftgasforschung entzogen, wie beispielsweise Max Born (1882–1970).
„Die chemische Kriegführung im Ersten Weltkrieg konfigurierte die Beziehungen zwischen Wissenschaft, Militär und chemischer Industrie neu.“ Schmaltz (2006, 18).
Zitiert aus Habers Abschiedsschreiben an seine Mitarbeiter vom 1. Oktober 1933, MPG-Archiv, Haber-Sammlung, Va. Abt., Rep. 5, Nr. 1946.
Eine interessante Duplizität der Ereignisse liegt darin, dass 1945 sein in Farm Hall von den Alliierten Streitkräften internierter Kollege Otto Hahn ebenfalls den Nobelpreis für ein Forschungsergebnis erhielt, das eine Kriegswaffe ermöglichen sollte, in diesem Falle die Atombombe.
Stifterin des Instituts mit einer Summe von 3 Millionen Mark war Marianne von Friedländer-Fuld zum Andenken an ihren Vater Fritz, der ein langjähriger Rivale von Eduard Arnhold war.
Glum (1930a, 361–365).
Vgl. dazu auch Maier (2007a, 283–328).
Vogt und seine Frau, die französische Neurologin Cécile Mugnier (1875–1962), die von 1919 bis 1937 eine Abteilung des Instituts leitete, gelten als Mitbegründer der modernen Hirnforschung.
Zur Etatentwicklung der KWG von 1929 bis 1944 vgl. Hachtmann (2007a, 561–598). Anhand detaillierter Tabellen für zentrale Institute der KWG vermittelt Hachtmann einen genauen Einblick in die Entwicklung des Etats der Gesellschaft.
Neben diesen beiden Instituten wurden noch die Neubauten des KWI für Psychiatrie in München sowie des KWI für Hirnforschung in Berlin-Buch von der Rockefeller-Stiftung finanziert.
Bereits die Institute für physikalische Chemie und Elektrochemie (1911) sowie für Biochemie waren innovativ in ihrer Interdisziplinarität: Habers Institut verzahnte Chemie, Physik und Toxikologie eng miteinander, Neubergs Institut Chemie, Biologie und Medizin. Doch die neue Qualität des Heidelberger Instituts machte aus, dass es von Anfang an in vier Teilinstituten gegründet wurde, um Methoden der Physik und Chemie in die medizinische Grundlagenforschung einzuführen.
Zit. nach Ebd., 67.
Vgl. Witt (1990, Tab. 626).
Bericht über die 21. Hauptversammlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. Frankfurt a. M. 1932, 2, zitiert nach Henning und Kazemi (2011, 166). Bereits 1922 hatte es im Zusammenhang mit der Hyperinflation schon einmal rückläufige Mitgliederzahlen gegeben, aber nicht in so gravierender Form, vgl. vom Brocke (1990, 273).
Alys Verdacht erwies sich als richtig, vgl. Aly (1984) sowie Peiffer (2000); Weindling (2012, 237–242); Ernst Klee (1985 und 2004). Diese Gehirne wurden 1990 auf dem Waldfriedhof in München bestattet.
Vgl. dazu auch die Ansprache des scheidenden Präsidenten Professor Dr. Dr. Heinz A. Staab „Die Max-Planck-Gesellschaft in einem sich ändernden politischen Umfeld – Rückblick auf die Jahre 1984 bis 1990“ sowie die Ansprache des neuen Präsidenten Professor Dr. Hans F. Zacher „Herausforderungen an die Forschung“, beide gehalten auf der Festversammlung der Max-Planck-Gesellschaft am 22. Juni 1990 in Lübeck.
Die Reihe „Ergebnisse“: http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/KWG/publications.htmErgebnisse. Einen ausgezeichneten Überblick über die Publikationen vermittelt die Essayrezension von Mitchell Ash, Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus, in: NTM. Zeitschrift für Geschichte der Wissenschaften, Technik und Medizin, 18:1 (2010), 79–118.
Siehe dazu: Die Verbindung nach Auschwitz: Biowissenschaften und Menschenversuche an Kaiser-Wilhelm-Instituten. Dokumentation eines Symposiums. Der von Carola Sachse herausgegebene Band dokumentiert die Rede des Präsidenten und die Ansprachen und Zeugnisse der Überlebenden. Die anschließenden Forschungsberichte zeichnen die historische Entwicklung des medizinischen Menschenversuchs nach und diskutieren ethische Fragen. Einzelne Forschungsprojekte, die von Wissenschaftlern der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem „Lagerarzt“ Josef Mengele in Auschwitz durchgeführt wurden, werden rekonstruiert. Darüber hinaus wird die aktive Rolle der Opfer und die Verfolgung medizinischer Kriegsverbrechen nach dem Ende des Krieges beleuchtet und aus der praxisorientierten therapeutischen bzw. juristischen Arbeit für die Opfer nationalsozialistischer Kriegsverbrechen berichtet. (Wallstein Verlag)
Ebd.
Planck an Glum, 18. April 1933, MPG-Archiv, Va. Abt., Rep. 11, Nr. 1065.
Friedrich Glum hatte diesen Begriff geprägt, um die Anpassungspolitik der KWG zu beschreiben: „Als die Gleichschaltung kam, konnten wir sagen, daß wir davon nicht betroffen würden, da wir uns schon gleichgeschaltet hatten.“ Glum (1964, 443).
Siehe z. B. Planck an Glum, 18. April 1933, MPG-Archiv, Va. Abt., Rep. 11, Nr. 1065.
MPG-Archiv, I. Abt., Rep. 1A, Nr. 375/1, Nr. 375/2, Nr. 376/1, Nr. 376/3, Nr. 406 bis 418 a; BA Berlin, R 1501, Nr. 126784, Bl. 186; Nr. 126785, Bl, 195 und 239; R 2301, Nr. 2312 – zitiert nach Hachtmann (2007a, 50f.).
Es handelte sich um zwei Listen, die erste, am 20. September vorgelegte, betraf die Angestellten der KWI, die mit mehr als 50% aus öffentlichen Mitteln finanziert wurden, die zweite, vom 4. Oktober 1933, die Angestellten der privat oder industriell geförderten KWI. Intern existierte diese Aufstellung bereits seit Juli, MPG-Archiv, I. Abt., Rep. 1A, Nr. 531/3, zitiert nach Rürup (2008b, 9).
Dabei handelt es sich um die Zahlen, die von der Generalverwaltung offiziell weitergeleitet wurden. De facto war die Zahl der betroffenen Personen weitaus höher: 91 Mitarbeiter/innen fielen unter § 3 BBG, bei weiteren 10 ist es sehr wahrscheinlich, dass sie unter denselben Paragrafen fielen, der Techniker Otto Nagel und der Abteilungsleiter Max Ufer (1900–1983) beispielsweise hatten beide jüdische Ehefrauen und bei fünf Personen ist unklar, was der Vertreibungsgrund war. Zahlen basierend auf einer tabellarischen Übersicht bei Schüring (2006, 88–103).
Meitners Mitarbeiter Robert Karl Eisenschitz (1898–1968) emigrierte 1933. Ihr theoretischer Assistent Max Delbrück (1906–1981) nutzte aus den genannten politischen Gründen ein Rockefeller-Stipendium, um 1937 in die USA zu emigrieren. Detaillierte Angaben, darunter tabellarische Übersichten über alle vertriebenen Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, finden sich bei Schüring (2006, 86–10) und Rürup (2008b, 86–109). Vgl. auch vom Brocke (1990, 361).
Planck verfasste seinen berühmten Bericht „Mein Besuch bei Adolf Hitler“ erst 14 Jahre nach dem Ereignis, im März 1947. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits 89 Jahre alt und erholte sich gerade von einer schweren Lungenentzündung. Mutmaßlich hat aber gar nicht Planck selbst, sondern seine Frau Marga den Bericht verfasst. Max Planck: Mein Besuch bei Adolf Hitler. Physikalische Blätter 3(1947)5, 143, zitiert nach Szöllosi-Janze (1998, 659).
Ebd.; Hoffmann (2008, 90); Henning (2004b, 69–93).
Albrecht (1993, 41–63). Der Versuch von Eckart Henning, diese Interpretation zu entkräften, vermag nicht zu überzeugen, da er keine neuen zeitgenössischen Quellen aufführen kann, die zu einer Neubewertung der Quellen führen würden, vgl. Henning (2004b).
Planck an Hitler, 2. Mai 1933, BA Berlin, R 43 II/1227a, fol. 13.
Steinhauser et al. (2011, 96–105); auch Rürup (2008b, 43).
Die Rede von Karl Friedrich Bonhoeffer wurde von Hahn verlesen, da Bonhoeffer als Hochschullehrer Teilnahmeverbot hatte.
Presseerklärung der Akademie der Wissenschaften: Zum Austritt A. Einsteins aus der Akademie, 1. April 1933, in: Kirsten und Treder (1979, 248).
Protokoll der außerordentlichen Sitzung des Plenums der Akademie der Wissenschaften vom 6. April 1933, in: Kirsten und Treder (1979, 250f.) – Nachdem auch Haber hatte emigrieren müssen, schrieb ihm Einstein am 8. August 1933: „Ich freue mich sehr [...] darüber, dass Ihre frühere Liebe zur blonden Bestie ein bisschen abgekühlt ist. [...] Es ist doch kein Geschäft für eine Intelligenzschicht zu arbeiten, die aus Männern besteht, die vor gemeinen Verbrechern auf dem Bauche liegen und sogar bis zu einem gewissen Grade mit diesen Verbrechern sympathisieren.“ Zitiert nach Renn, Castagnetti und Damerow (1999, 351).
Protokoll der Sitzung des Plenums der Akademie der Wissenschaften vom 11. Mai 1933, in: Kirsten und Treder (1979, 267).
Aus der Leitung des KWI für Physik hatte sich Einstein bereits seit Mitte der 1920er Jahre weitgehend zurückgezogen, auch wenn er immer noch als Direktor fungierte. Vgl. Kant (2005).
Einstein an die Bayerische Akademie der Wissenschaften, 21. April 1933, zitiert nach Renn, Castagnetti und Damerow (1999, 333).
BA Berlin, R 1501, Bl. 109, III – zitiert nach Hachtmann (2007b, 408f.).
Zu den jüdischen Mäzenen und Stiftungen vgl. Kreutzmüller (2005). Zur Arisierung des Vermögens von Leopold Koppel vgl. auch das Kapitel „Arisierung“ bei Hayes (2005, 94–126).
Dass dieser Paradigmenwechsel stattgefunden hat, ist auch als Erfolg des Forschungsprogramms zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus zu werten. Lange Zeit hat die historische Forschung die Lesart von „Überlebenskampf“ oder „innerer Emigration“ der Wissenschaft im Allgemeinen und der Grundlagenforschung im Besonderen übernommen, wie etwa der polemische Titel von Kirstie Macrakis Studie Surviving the Swastika: Scientific Research in Nazi Germany illustriert. – Vgl. auch Hachtmann (2004), Eine Erfolgsgeschichte?.
Die bisher umfassendste und komplexeste Analyse der Geschichte der Generalverwaltung der KWG liefert Rüdiger Hachtmann mit seiner 2007 erschienen zweibändigen Monographie Wissenschaftsmanagement im „Dritten Reich“, in der er seinen Untersuchungszeitraum einer überzeugenden Binnenperiodisierung unterzieht, „die je nach Fragestellung politisch, wissenschafts- oder institutionsgeschichtlich begründete Zeiträume definiert“ (Matthias Berg).
Erich Regener war 1937 von den Nationalsozialisten nach §3BBG – seine Frau Viktoria hatte jüdische Vorfahren – von seinem Direktorenposten am physikalischen Institut der TH Stuttgart enthoben worden und gründete daraufhin die zunächst private Forschungsstelle für Physik der Stratosphäre, die er 1938 in die KWG überführte. Regeners Forschungen zur Stratosphäre waren nicht zuletzt für die Raketenforscher um Wernher von Braun (1912–1977)) relevant. Diese Forschungsstelle wurde im Wesentlichen durch das Reichsluftfahrtministerium finanziert. Den ursprünglichen Plan, sie mit dem KWI für Physik zusammenzuführen, ließ man unter anderem auf Wunsch von Debye fallen.
Das wesentlich vom Reichsernährungsministerium finanzierte Forschungsinstitut für Bastfasern sollte bereits 1922 in die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft übernommen werden, wurde aber zugunsten des KWI für Faserstoffchemie zurückgestellt. 1941 wird es nach Mährisch-Schönberg im 1938 besetzten Sudetenland verlagert, vgl. (Heim 2003, 84–86); Luxbacher (2004).
Maier (2007b, 7f.).
Vgl. Hachtmann (2007b, 571); Kohl (2002, 145).
Hachtmann (2007b, 573).
Krauch wurde 1935 Förderndes und Wissenschaftliches Mitglied der KWG, 1937 Senator. Der 1948 im IG Farben Prozess verurteilte Krauch blieb bis 1960 Wissenschaftliches Mitglied. Wie Bosch war Krauch erst bei der BASF und dann der IG Farben tätig und wurde später Nachfolger von Bosch als Aufsichtsratsvorsitzender bei der IG Farben.
Zitiert nach Hachtmann (2007b, 291f.).
Zu Autarkie und Ostexpansion im Nationalsozialismus vgl. unter anderem den gleichnamigen Sammelband von Susanne Heim (2002) sowie Heim (2003).
Heim (2002a, 8f.).
Hachtmann (2007b, 576).
Vgl. dazu und der prekären Situation, in die Eitels eigenmächtiges Handeln im Hinblick auf eine Prager Niederlassung die KWG brachte, auch Heiko Stoff (2005) sowie Kohl (2002, 164–166).
Heim (2002a, 11, 172–175).
Vgl. Albrecht und Herrmann (1990); Vierhaus und vom Brocke (1990, 376); Hachtmann (2007b, 113–116). Nachdem Glum bereits Anfang der 1920er Jahre Kontakte zur Reichswehr geknüpft hatte, schloss Harnack 1926 einen wegen des Versailler Vertrages illegalen Vertrag mit der Reichswehr über Rüstungsforschung, und Max Lucas von Cranach (1885–1945), einer der beiden neuen Geschäftsführer wurde zum Verbindungsmann zur Reichswehr ernannt.
In ihrer Studie über die systematische Verdrängung des Beitrags von Wissenschaftlerinnen in der Forschung zugunsten ihrer männlichen Kollegen bezeichnet die Wissenschaftshistorikerin Margret Rossiter das Beispiel von Lise Meitner und Otto Hahn, als den vermutlich „most notorious theft of Nobel credit“. Rossiter (1993, 329).
Siehe u.a. Kant (2011b, insbes. 99–105).
Wirtz (1988, 38f.).
Frank (1993, 172f.).
Carson (1999), vgl. auch Heisenberg in the Atomic Age: Science and the Public Sphere, Cambridge University Press 2010.
Walker (2005, 37f.).
Schmaltz zeigt, wie die antisemitische Vertreibungspolitik gegenüber jüdischen Wissenschaftlern mit dem Ziel einer verschärften Militarisierung der Forschung im Rahmen der NS-Wissenschaftspolitik in Einklang gebracht wurde, und geht der Frage nach, inwiefern die Direktoren aufgrund ihrer exponierten Stellung als Fachspartenleiter für den Zugriff auf KZ-Häftlinge als Forscher, Sklavenarbeiter oder Versuchsopfer verbrecherischer Menschenversuche mitverantwortlich waren für eine Wissenschaft, die keine ethischen Grenzen mehr kannte, Schmaltz 2005.
Szöllösi-Janze (1998, 652–657); Schmaltz (2005, 66–96).
Thiessen war der NSDAP zunächst 1922 und nach seinem „unfreiwilligen“ Austritt 1926 oder 1928 erneut im April 1933 beigetreten. Bundesarchiv Berlin, BDC, Parteikorrespondenz, R-0023, Peter Adolf Thiessen, geb. 6.4.1899. Zitiert nach Schmaltz (2007, 312).
Als Fachspartenleiter hat Kuhn nachweislich allein von 1943 bis 1944 mindestens acht Forschungsprojekte zu chemischer Kampfstoffforschung unterstützt, vgl. Schmaltz (2008, 168).
Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Stiftung eines Deutschen Nationalpreises für Kunst und Wissenschaft vom 30. Januar 1937, RGBl. I (1937), 305, zitiert nach Schmaltz (2005, 376).
Das Verhältnis von Neuberg und Butenandt ist wiederholt Untersuchungsgegenstand gewesen, vgl. dazu Deichmann (2001) und Schüring (2004). Neuberg, der unter §3 BBG fiel, musste 1934 seinen Rücktritt einreichen und verlor seinen Posten zum 1. Oktober 1934. Dennoch äußerte sich Neuberg nach dem Krieg positiv über seinen Nachfolger, so etwa in einem Brief an Heinrich Wieland im Februar 1949: „Gelacht habe ich aber über Ihren euphemistischen Ausdrucks meines ‚Ruecktritts‘. Ich habe ihn immer als Metathesis, als Tritt in den Ruecken empfunden; diesen hat Butenandt sicher nicht ausgeteilt.“Neuberg an Wieland, 21. Februar 1949, zitiert nach Schüring (2004, 355).
Vgl. Sachse 2004.
Müller-Hill (1984, 71–75). Unter Einbeziehung der Unterlagen aus dem Nachlass Butenandts kam der Historiker Achim Trunk zu dem Schluss, dass Butenandt „nicht als ‚Mittäter‘ des Holocaust angesprochen werden kann“, er aber als „Mitwisser“ gleichwohl „über die entscheidenden Züge des Projekts orientiert war“. Es habe „als sehr wahrscheinlich zu gelten“, dass ihm die Herkunft der „Blutproben aus einem Lager – genauer: aus einem Kriegsgefangenen- oder Konzentrationslager“ bewusst gewesen sein müsse. Trunk (2003, 68). Siehe auch Rürup (2008a, 189).
„Wie weit Dr. Mengele selbst zu der infrage stehenden Zeit – nämlich während der Übersendung von Blutproben – über die Greuel und Morde in Auschwitz orientiert war, lässt sich aus den verfügbaren Unterlagen nicht erkennen“, Adolf Butenandt, Max Hartmann (1876–1962), Wolfgang Heubner (1877–1957)), Boris Rajewsky (1893–1974), Denkschrift betreffend Herrn Prof. Dr. med. Otmar Frhr. v. Verschuer, September 1949, MPG-Archiv, III. Abt., Rep. 84, NL Butenandt, O 357, „Angelegenheit Verschuer“, 8, zitiert nach Proctor (2000, 28). Zum wissenschaftlichen und politischen Wirken von Butenandt im „Dritten Reich“ vgl. Schieder und Trunk (2004).
Vgl. Briefwechsel zwischen Butenandt und Müller-Hill von 1983, MPG-Archiv, III. Abt., Rep. 84/2.
Vgl. dazu Schmaltz (2007, 345–351); Gausemeier (2003, 178–198).
Pietsch war auch nach dem Krieg, von 1948 bis 1967 Direktor des Instituts.
Zu den Fleckfieberversuchen von Eugen Haagen siehe Toledano (2010, 195); Weindling (2009, 232–249) und Schmaltz (2005, 574). Zu den Phosgenversuchen siehe Schmaltz (2005, 251–562, 574 und 2006, 139–156). Besonderer Dank gebührt Florian Schmaltz für differenzierte Hinweise, die Licht in diese diffizilen Angelegenheit brachten.
Kuhn an Rechtsanwalt Eber, 5. August 1947, MPG-Archiv, III. Abt., Rep. 25, Nr. 54 und Schmaltz (2005, 556–557).
Aktenvermerk Telschow, 8. April 1943, MPG-Archiv, I. Abt., Rep. 1A, Nr. 2833; vgl. auch Telschow an Kuhn, 22. April 1943, MPG-Archiv, I. Abt., Rep. 29, Nr. 104, zitiert nach Gausemeier (2003, 191). Siehe auch Schmaltz (2005, 511–514).
Vgl. Hachtmann (2007b, 565f. und Tabelle I.5, 1257).
Vgl. dazu Schüring (2006, 109–119).
Dieses Kalkül wurde jedoch durchschaut, wie die wenig schmeichelhafte Betrachtung von Alain Gregg zeigt, die dieser 1937 über Glum in seinem Tagebuch machte: „A nervous arriviste in science, overactive, and I should say not reliable.“ Zitiert nach Schüring (2006, 114).
Zum KWI für Physik vgl. u. a. Kant (2011a, insbes. 79, 85–86); Macrakis (1986).
Vgl. dazu Hachtmann (2007b, 597–614).
Die neue Satzung wurde am 22. Juni 1937 auf der Hauptversammlung der KWG von ihren Mitgliedern verabschiedet. In einigen Punkten war es der Führung der Gesellschaft, darunter Planck, Glum, Bosch und Vögler, gelungen, ihre Vorstellungen gegenüber dem REM durchzusetzen, so beispielsweise § 3, der in der ursprünglichen Version vorsah, dass nur „Personen arischer Abstammung“ die Mitgliedschaft hätten erwerben können und nun lautete „Personen, welche Anspruch auf das Reichsbürgerrecht besitzen“. In anderen entscheidenden Punkten musste die KWG jedoch den Forderungen des REM stattgeben, etwa §1, dass sie fortan unter der „Aufsicht des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung“ stünde. Das „Führerprinzip“ wurde unter §10 verankert: „Der Präsident der Gesellschaft wird auf Vorschlag des Senats vom Minister ernannt. Der Präsident ist der Führer der Gesellschaft.“ Zitate nach Kohl (2002, 139).
Als Vorwand diente nach § 3 der Satzungsnovelle die jüdische Großmutter von Glums Ehefrau, die eigentlichen Gründe waren jedoch, wie bereits dargelegt, andere. Vgl. dazu auch Kohl (2002, 134–13).
Hachtmann (2007b, 615).
Tammen (1978, 105–112); Hayes (1987, 67); Plumpe (1990, 268 u 540–544); Hughes (1975). Plumpe und Hughes datieren das Treffen erst auf November 1932. Siehe dagegen die von Hayes angeführten Argumente für die Datierung des Treffens auf Juni 1932: Hayes (1992).
Hayes (1987, 91–92) und Kohl (2002, 121–122).
Weltweit war die IG Farben das viertgrößte Unternehmen nach General Motors, United States Steel und Standard Oil, vgl. Hayes (2000, 16).
Hachtmann (2007b, 641).
Vgl. Kohl (2002, 162–164); Hachtmann (2007b, 618–621).
Hachtmann (2007b, 829).
In seinen „erlebten und erdachten“ Erinnerungen erklärt Glum das Ausscheiden von ihm und von Cranach zugunsten von Telschow damit, dass dieser das Vertrauen der NSDAP besessen habe, Glum (1964, 488).
Dabei spielte zunächst eine nur untergeordnete Rolle, dass seine Generalvollmacht mit Boschs Tod erlosch und erst von Vögler wieder erneuert werden konnte.
Vgl. dazu und der weiteren Entwicklung der Patentverwertungsgesellschaft, Hachtmann (2007b, 833f.).
Das entspricht 4,1% – die Zahlenangaben sind der Tabelle 2.1 bei Hachtmann (2007b, 1265) entnommen.
Siehe dazu auch Hachtmann (2007b, 841f.).
Hachtmann (2007b, 866–876), „Kaiser-Wilhelm-“ oder „Hermann-Göring-Gesellschaft“?
Hachtmann (2007b, 843f.).
Anschaulich belegt wird die große Autorität, mit der Vögler der KWG Freiräume verschaffte, etwa durch ein Schreiben, das er am 6. November 1941 an das REM richtete, in dem er Mentzel darauf hinwies, „daß dem Präsidenten der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft nach den Statuten die Gesamtleitung obliegt, und er nicht an die Weisungen eines Ministeriums gebunden ist.“ MPG-Archiv, I. Abt., Rep. 1A, Nr. 233/Bl. 31.
Insgesamt saß Vögler in den Aufsichtsgremien von zwölf Einrichtungen der KWG, vgl. dazu eine detaillierte Übersicht in Kohl (2002, 195).
Maier (2007a, 228).
Um diesem Obligatorium Harnacks nachzukommen, wurde das Institut der Universität Münster angegliedert, vgl. dazu auch Plesser und Kinne (2010, 279).
Während des Kriegs befand sich auf dem Werksgelände der Dortmunder Union (die inzwischen in die Deutsch-Lux bzw. die Vereinigten Stahlwerke übergegangen war) in der Huckarder Straße 111, eines der zahlreichen Außenlager des KZ Buchenwald, in dem Hunderte von jungen Frauen und Mädchen, vorwiegend Russinnen und Polinnen, Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie verrichten mussten.
Joachim Scholtyseck bezeichnet den Reusch-Kreis im Vergleich zu dem Kreis um Robert Bosch (1861–1942) und Carl Goerdeler als „blassen Debattierclub“, Scholtyseck (1999, 302).
Speer (2005, 215f.).
Hachtmann (2007b, 862).
Brüning, Memoiren, 371, zitiert nach Hachtmann (2007b, 859).
Vgl. dazu Hachtmann (2007b, 1038–1040), Verweis auf Hans Mommsen, 1040.
Zur Grundlagenforschung in der Max-Planck-Gesellschaft vgl. auch den Beitrag von Carola Sachse in diesem Band.
Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Herrschaft. Ansprache des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker (*1920) am 8. Mai 1985. http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Richard-von-Weizsaecker/Reden/1985/05/19850508_Rede.html (retrieved 16.1.2015).
Allerdings wurde bis Ende 1944 auch noch im Berliner Institut gearbeitet. So fand das als B-VII bezeichnete letzte Modellexperiment zum Uranprojekt in Berlin noch im November/Dezember 1944 statt.
In bestimmten Zusammenhängen – unter anderem in Bezug auf Berlin – galt es letztlich bis 1990 und wurde erst mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten endgültig aufgehoben.
Hinzu kam die so genannte Aktion „Paperclip“, in deren Rahmen die Amerikaner bereits im Sommer 1945 versuchten, hochqualifizierte Wissenschaftler und Techniker für ihre eigenen Projekte abzuwerben.
Zum Wissenstransfer in der französischen Besatzungszone vgl. Maier (2007a, 936–952).
Das Gesetz wurde zum 5. Mai 1955 für die BRD und zum 20. September 1955 für die DDR außer Wirkung gesetzt. http://www.verfassungen.de/de/de45-49/kr-gesetz25.htm (retrieved 16. Januar 2015).
Diese Einsichten gehen auf Anregungen von Hans F. Zacher zurück (Brief an J.R., 24. 3. 2010).
Die Demontierung des KWI für Physik stand dabei für die sowjetische Seite wegen seiner möglichen Bedeutung für die eigene Atombombenforschung an erster Stelle des von Berija unterzeichneten Befehls Nr.00539 des NKWD vom 16. Mai 1945 [vgl. Dejatel’nost’ upravlenija CVAG po izuceniju dostishenij nemeckoj nauki i techniki v Sovetskoj zone okkupacii Germanii 1945–1949. Moskva 2007, S.339–340]. Allerdings wussten die Sowjets zu diesem Zeitpunkt wohl nicht so genau, dass man das KWI für Physik in seinen Hauptbestandteilen bereits nach Südwestdeutschland verlagert hatte. Aber das KWI für Physikalische Chemie und Elektrochemie war in seinen wesentlichen Teilen nicht verlagert worden und wurde nun demontiert, vgl. Steinhauer et al. (2011, 139f.).
Das KWI für Strömungsforschung wurde zwar zunächst von den Amerikanern geschlossen, dann aber an die Briten übergeben, die der Generalverwaltung die Weiterarbeit ermöglichten.
Abschrift des Ernennungsschreibens in Hecht, Hoffmann und Richter (1991, 101). Havemann setzte unter anderem sofort die Verfügungsgewalt Telschows und weiterer Mitarbeiter der Generalverwaltung über die Konten der KWG außer Kraft. Vgl. Brief Havemann an Deutsche Bank vom 13. Juli 1945, MPG-Archiv, II. Abt., Rep. 1A, Bl. 139. Vgl. hierzu auch Steinhauser et al. (2011, Kap. 4).
Grund für den Vollstreckungsaufschub war nicht zuletzt seine Arbeit an einem Giftgas-Projekt des Heereswaffenamtes.
Vgl. Hachtmann (2007b, 1055–1059). Außerdem: Rundschreiben Plancks an die KWG-Direktoren vom 15. September 1945 und vom 19. November 1945, abgedruckt in: Beck (2008, 193–195, 197).
Zudem sorgte auch Havemanns Veröffentlichung über die Forschungskooperation zwischen Mengele in Auschwitz und Verschuer am KWI für Anthropologie im Zusammenhang mit Verschuers laufendem Entnazifizierungsverfahren in der Berliner „Neuen Zeitung“ am 3. Mai 1946 für großen Unmut. Vgl. Sachse (2002).
Kurzzeitig hatte sich Glum auch Hoffnung gemacht, als Verwaltungsleiter der Dahlemer Institute eingesetzt zu werden, Glum (1964, 555).
Die für die sowjetische Besatzungszone zuständige Deutsche Zentralverwaltung für Volksbildung hatte zunächst den Wiederaufbau der KWG unter Havemann unterstützt, schwenkte ab 1946 aber auf die Linie ein, die Berliner Akademie der Wissenschaften (die ihren Sitz im Ostteil der Stadt hatte) als universitätsunabhängige Forschungsinstitution mit eigenen Forschungsinstituten auszubauen.
Plancks ältester Sohn Karl war am 16. Mai 1916 bei Verdun gefallen. Seine beiden Zwillingstöchter starben bei der Geburt ihres ersten Kindes, Grete am 15. Mai 1917 und Emma, die den Witwer ihrer Schwester geheiratet hatte, am 21. November 1919.
„Mein Führer! Ich bin zutiefst erschüttert durch die Nachricht, dass mein Sohn Erwin vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt worden ist. Die mir wiederholt von Ihnen, mein Führer, in ehrenvollster Weise zum Ausdruck gebrachte Anerkennung meiner Leistungen im Dienste unseres Vaterlandes berechtigt mich zu dem Vertrauen, dass Sie der Bitte des im siebenundachtzigsten Lebensjahr Stehenden Gehör schenken werden. Als Dank des deutschen Volkes für meine Lebensarbeit, die ein unvergänglicher geistiger Besitz Deutschlands geworden ist, erbitte ich das Leben meines Sohnes.“ Planck an Hitler, 25. Oktober 1944, zitiert nach Pufendorf (2006, 462).
Ebd.
Gemäß den Statuten der KWG musste der Präsident eigentlich vom Senat gewählt werden, doch aufgrund der Reiseschwierigkeiten in der Nachkriegszeit konsultierte Planck die verbliebenen Mitglieder des Senats erst im Nachhinein. Während die Generalverwaltung auf diese Tatsache nicht einging, insistierte sie jedoch, dass die Ernennung Havemanns zum kommissarischen Leiter nicht den Statuten entspräche, was jedoch keineswegs zutraf. Vgl. Rundschreiben Plancks an die KWG-Direktoren vom 23. März 1946 und vom 15. September 1945, abgedruckt in: Beck (2008, 200).
Die Alsos-Mission wurde von den US-Geheimdiensten im Schatten der vorrückenden US-Armee durchgeführt um herauszufinden, ob es ein deutsches Atombombenprojekt gegeben habe und wie weit es gediehen sei. Vgl. dazu den Ersten Bericht (noch unter Militärzensur) des wissenschaftlichen Leiters der ALSOS-Mission: Goudsmit (1996 (1947)) und Mahoney (1981) sowie zum militärischen Leiter der ALSOS Mission, Pash (1969).
Wie Ruth Lewin Sime schreibt, kam dies nicht gänzlich unerwartet, da Hahn bereits Mitte November 1944 insgeheim mitgeteilt worden war, „dass die Entscheidung für ihn zwar gefallen, der Preis allerdings zurückzuhalten sei, da man Deutschen, solange das NS-Regime existiere, Nobelpreise nicht zusprechen dürfe“, Sime (2004, 38). Zur kontroversen Diskussion um die Nobelpreisverleihung an Hahn und ihren Einfluss auf die wissenschaftspolitischen Absichten, vgl. u.a. Oexle (2003, 38f.).
Oexle (2003, 38). Vgl. dazu auch Oexle, „Wie in Göttingen die Max-Planck-Gesellschaft entstand“.
Vgl. dazu Sime (2004, 40f.).
Der Zoologe und Genetiker Alfred Kühn (1885–1968) hatte 1937 die Leitung des KWI für Biologie übernommen, nachdem Direktor Richard Goldschmidt (1878–1958) nach §3 BBG gezwungen gewesen war, diesen 1936 niederzulegen.
Planck an Butenandt, Kühn und Telschow am 20. September 1945.
Eine Funktion, die zwar im Statut nicht vorgesehen war, die aber dem Wunsch einiger KWG-Mitglieder entsprechen sollte, Planck gerade in dieser Zeit als „Aushängeschild“ für das Ausland zu behalten. Vgl. Antrag Telschows an die Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Rates der KWG vom 7. Dezember 1945 sowie Brief von Schreiber an Telschow vom 12. April 1946. Beck (2008, 198f., 202).
Otto Meyerhof an Hahn, 25. Juni 1946, MPG-Archiv, III. Abt., Rep. 14, Nr. 2937, Bl. 2, Orthographie des Originals übernommen.
Meitner an Hahn, 20. Oktober 1946, zitiert nach Sime (2001, 436f.).
Vgl. Sime (2004, 43–45).
Hahn (1986, 208, 210).
Allerdings wurde dieser Beschluss wegen des Zusammenbruchs der Viermächteregierung nie offiziell verkündet. Vgl. dazu Heinemann (1990, 408f.).
Erklärung Hahns zu Telschow, 31. Juli 1946, in: Ermittlungsakte Wengler, Bl. 46 Rs, zitiert nach Hachtmann (2007b, 1131). Wilhelm Wengler war von 1933 bis 1938 Referent am KWI für ausländisches und internationales Privatrecht und von 1938 bis 1944 am KWI für öffentliches Recht und Völkerrecht tätig hatte im Dezember 1949 Strafanzeige gegen Telschow wegen „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ erstattet.
Tagebuch Otto Hahn Nr. 5 (Febr. 1947 – Sept. 1955), Bl. 21 (15.10.1949). MPG-Archiv, NL Hahn, III. Abt., Rep. 14A, Nr. 00 421–5.
Hachtmann (2007b, 1126–1131).
Allerdings blieb Hahn bis zum Ende seiner Präsidentschaft weiterhin Wissenschaftliches Mitglied dieses Instituts. Kant und Reinhard (2012, 267f.).
Zur Nachkriegszeit und Neugründung der MPG siehe auch Heinemann (2012, 267f.) sowie Heinemann und Schneider (1990).
Vgl. u. a. Engel (1984, 256–271), Schmidt-Ott (1961); Engel (1984, 271–279).
K. F. Bonhoeffer, Zur Geschichte der Deutschen Forschungshochschule, undatiert (1952), MPG-Archiv, X. Abt., Rep. 7, Deutsche Forschungshochschule, Nr. 33. Siehe auch Schmidt-Ott (1961) und Engel (1984, 271–279).
Vgl. Steinhauser et al.
Archiv der MPG, X. Abt., Rep. 7, Deutsche Forschungshochschule.
Nach einem Zeitungsartikel Havemanns gegen das amerikanische Wasserstoffbombenprojekt 1950 kam es zum Eklat – Havemann wurde auch seines Abteilungsleiterpostens im KWI für Physikalische Chemie und Elektrochemie enthoben und erhielt Hausverbot. Er siedelte daraufhin in die DDR über und übernahm die Direktion des Instituts für Physikalische Chemie an der Berliner Humboldt-Universität.
Ursprünglich hatte bereits Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) seine Akademieüberlegungen mit der Existenz von Forschungsinstituten verknüpft. Mit der Berliner Universitätsgründung 1810 hatte die Akademie dann ihre bestehenden Institute an die Universität verloren und sich seither vergeblich bemüht, wieder Institute anzugliedern – auch im Vorfeld der KWG-Gründung.
Nach Ansicht des Historikers Thomas Stamm-Kuhlmann hatte es in diesem Kontext „absoluten Vorrang, der Sowjetunion deutsche Forscher zu ‚verweigern‘, während möglichst viel vom Potential der deutschen Forschung helfen sollte, die Macht des Westens zu vergrößern, ähnlich, wie eine Erholung der deutschen Wirtschaft für die Stärkung Westeuropas bald als notwendig angesehen wurde“, Stamm-Kuhlmann (1990, 886); Henning und Kazemi (2011, 294).
Vgl. dazu Walker (2003, 33–50).
Vgl. Hahn (1968, 213f.).
Dabei handelte es sich um das gerade von Tailfingen nach Mainz umgezogene KWI für Chemie, die Vogelwarte Radolfzell, die in Tübingen ansässigen Institute für Biochemie, Biologie, ausländisches und internationales Privatrecht sowie die Arbeitsgruppe des KWI für Physik in Hechingen und die Forschungsstelle für Physik der Stratosphäre in Weissenau.
Vgl. Niederschrift über den Auflösungsbeschluss vom 6. April 1951, MPG-Archiv, I. Abt., Rep. 1A, Nr. 14 und 144 und Liquidationserklärung vom 21. Juni 1960. Einer der beiden Liquidatoren war Telschow, MPG-Archiv, I. Abt., Rep. 1A, Nr. 145 und 146.
Manche, wie etwa Lise Meitner oder Ernst Rabel, konnten sich vor dem Hintergrund des Geschehenen nicht dazu entschließen, einige, wie beispielsweise Peter Debye, reagierten gar nicht darauf, anderen, wie beispielsweise Max Ufer, wurde die Möglichkeit der Rückkehr gar nicht gegeben, vgl. dazu auch Schüring, der aktenkundige Fälle von Wiedergutmachungs- / Entschädigungsanträgen auflistet, die von der MPG abgelehnt wurden, Schüring (2006, 138–188).
„Kaum jemand erinnert sich, dass ich 1906 den Begriff ‚Biochemie‘ eingefuehrt habe, aber ich freue mich, dass er in Ihrer Arbeitsstaette verankert und zu hoechstem Ansehen gestiegen ist. Unter normalen Verhaeltnissen waere ich emeritierter Direktor und nicht pensioniert, da ich ein unbescholtener Beamter mit 39 1/2 Dienstjahren gewesen bin, letzteres durch officielle Einberechnung der Kriegszeit, die mir als vielleicht einzigem Deutschen 3 eiserne Kreuze (1. und 2. Klasse an der Front, 2. Klasse am weissen Band wegen der Glycerinarbeiten in der Heimat) eintrug.“ Neuberg an Butenandt, 12.11.1953, in: MPG-Archiv, III. Abt., Rep. 84, NL Butenandt; vgl. auch Lohff und Conrads (2007).
Aktenvermerk vom 23. Dezember 1949, MPG-Archiv, II. Abt., Rep. 1A, PA Neuberg; zitiert nach Schüring (2004, 151).
Lebenslauf Debyes von 1965 (verfaßt im Zusammenhang mit möglichen Pensionsansprüchen an die MPG). [MPG-Archiv II / 1A / PA Debye, Mappe 1, Bl.1–6 (hier: Bl.2)].
Ebd. 12, Geleitwort des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft.
Nationalökonom Bötzkes, ein Vertrauter Trendelenburgs, war von 1924 bis zu seinem Tod 1958 Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der staatsnahen „Bank für Industrie-Obligationen“, die später in „Deutsche Industriebank“ umbenannt wurde, die seit 1936 in großem Umfang die KWG förderte. Bötzkes wurde 1943 Senator der Gesellschaft, zudem saß er im Beirat der Reichsbank. Nach Kriegsende war er von 1945 bis 1948 von den Amerikanern interniert. Danach war er von 1948 bis 1952 Schatzmeister und ab 1952 Vizepräsident der MPG.
Siehe dazu u.a. Kant (2008, 78–82); Hoffmann und Schmidt-Rohr (2006, 19–23)
Heimpels Nachfolger Josef Fleckenstein (1919–2004) und Rudolf Vierhaus (1922–2011) setzten neue Maßstäbe unter anderem auch in der Internationalisierung der Mittelalter- und Neuzeitforschung. Unter seinen beiden letzten Direktoren Oexle (Mittelalter) und Hartmut Lehmann (Neuzeit) erfuhr das Institut eine kulturwissenschaftliche Neuausrichtung, die sich unter dem Begriff „Geschichte als historische Kulturwissenschaft“ (Oexle) manifestierte. Mit diesem Begriff der „historischen Kulturwissenschaften“ waren neue Fragestellungen beispielsweise zur historischen Anthropologie, Alltags- und Erfahrungsgeschichte sowie zur Sozial- und Mentalitätsgeschichte verbunden, die als wegweisend für die spätere Neuausrichtung des Instituts verstanden werden können. Zwei Jahre nach der Emeritierung von Oexle und Lehmann beschloss der Senat der MPG 2006 auf Anraten der zuständigen Geistes-, Sozial und Humanwissenschaftlichen Sektion die Schließung des Instituts für Geschichte, das seit 2007 unter neuer Ausrichtung und neuem Namen als MPI zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften weitergeführt wird.
Zur Geschichte des Instituts vgl. Theo Plesser und Hans-Ulrich Thamer (Hg.) (2012). Darin insbesondere zu Kraut den Beitrag von Thoms (2012, 297–303) sowie zu Krauts Tätigkeit in Afrika, ebd. (2012, 329–342).
Der Chemiker und Ernährungswissenschaftler Heinrich Kraut (1893–1992) leitete die Abteilung seit 1928. 1937 war er der NSDAP beigetreten und wurde unter anderem als Berater des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aktiv. Im Nürnberger Prozess gegen Flick, Krupp und die IG Farben unrühmlich hervorgetreten durch seine eidesstattliche Erklärung, in der er behauptete, dass die Rationen der KZ-Häftlinge ausreichend waren, um Eiweiß- und Fettmangel zu verhindern. Ungeachtet seiner NS-Vergangenheit wurde Kraut 1956–1958 Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und 1968–1973 Präsident der Welthungerhilfe war, vgl. Klee (2003, 337); Heim (2003).
1973 erfolgt die Umbenennung des Instituts in MPI für Systemphysiologie. 1993 werden schließlich beide Institute – das MPI für Systemphysiologie und das MPI für Arbeitsphysiologie – unter kollegialer Leitung zu einem Institut, dem MPI für molekulare Physiologie, zusammengeführt. Vgl. dazu Theo Plesser und Rolf Kinne (2010, 284–286).
Bis zum 31. März 1951.
Im Zuge einer Strukturreform wurde das Institut ab 1974 in drei Teilinstitute gegliedert: Institut für physikalische Chemie, Institut für Strukturforschung und Institut für Elektronenmikroskopie. In einer weiteren Reform wurden 1980 diese Teilinstitute wieder aufgelöst, es entstand ein Gesamt-Institut mit fünf Abteilungen unter kollegialer Leitung. Zwei Direktoren des FHI gewannen Nobelpreise: 1986 erhielt Ernst Ruska eine Hälfte des Nobelpreises in Physik für seine „fundamentalen elektronenoptischen Arbeiten und die Konstruktion des ersten Elektronenmikroskops“ und 2007 Gerhard Ertl den Nobelpreis für Chemie für seine Forschungsarbeiten, „in denen er die chemischen Prozesse erklärt, die sich auf festen Oberflächen abspielen“. Letzteres war der krönende Erfolg in der Entwicklung des FHI zu einem Zentrum der Grenzflächenforschung. Vgl. auch Ertl (2010).
Hahn an Bruno Berneis am 27. November 1953: „Aber Proteste und Aufrufe nützen doch offenbar nichts; wir alle wissen ja, dass sowohl die Amerikaner wie auch die Russen als Völker keinen Krieg wollen. Die Politik ist offenbar stärker als alle Aufrufe und Proteste.“ MPG-Archiv, NL Hahn, Abt. III, Rep. 14A, Nr.00267, Bl. 2.
Heisenberg war seit 1952 Vorsitzender der DFG-Kommission für Atomphysik und beriet in dieser Eigenschaft auch den Bundeskanzler.
Vgl. Hahn (1968, 230). In seinem Notizbuch vermerkte Hahn am 11. Juli 1955: „Nachmittags noch längere Besprechungen mit den anwesenden 16 Nobelpreisträgern. Schließlich gibt auch Lipmann nach.“ Zitiert nach D. Hahn (1979, 249). Von den Erstunterzeichnern waren Arthur H. Compton (1892–1962) und Hideki Yukawa (1907–1981) nicht in Lindau anwesend.
MPG-Archiv, NL Hahn, III. Abt., Rep. 14A, Nr. 06 500, Bl. 3–5. Zehn der späteren Göttinger 18 waren Mitunterzeichner dieses Schreibens.
Vgl. Carson (2010, 320–330); Kant (2012).
Veröffentlicht unter anderem in Physikalische Blätter 13 (1957) 5, 193–194. Es gibt kein offizielles, von allen 18 beteiligten Wissenschaftlern unterzeichnetes Dokument wie im Fall der Mainauer Erklärung.
Neben den Hauptakteuren Born, Gerlach, Hahn, Heisenberg und Weizsäcker hatten auch Fritz Bopp (1909–1987), Rudolf Fleischmann (1903–2002), Otto Haxel (1909–1998), Hans Kopfermann (1895–1963), Max von Laue, Heinz Maier-Leibnitz (1911–2000), Josef Mattauch, Friedrich-Adolf Paneth (1887–1958), Wolfgang Paul (1913–1993), Wolfgang Riezler (1905–1962), Straßmann, Wilhelm Walcher (1910–2005) und KarlWirtz ihre Zustimmung zur Unterzeichnung gegeben.
Vgl. zur Mainauer Kundgebung und Göttinger Erklärung auch Kant und Renn (2013, 22–28). Vgl. auch Kant (2012).
Das Luxemburger Abkommen oder auch „Wiedergutmachungsabkommen“ wurde am 10. September 1952 zwischen Israel und der Jewish Claims Conference sowie der Bundesrepublik Deutschland geschlossen. Darin verpflichtete sich die BRD zu Leistungen im Gesamtwert von 3,5 Milliarden DM, um die Eingliederung mittelloser jüdischer Flüchtlinge zu unterstützen sowie zu einer selbstverpflichteten Rückerstattung von Vermögenswerten. Sowohl die rechte als auch linke israelische Opposition protestierte gegen das Abkommen, da sie die Auffassung vertraten, dass das Annehmen von Reparationszahlungen einem Vergeben der NS-Verbrechen gleichkäme. In der BRD wiederum war Adenauer bei der Ratifizierung des Abkommens auf die Stimmen der SPD-Fraktion angewiesen, da zahlreiche CDU/CSU-Abgeordnete, wie etwa Franz-Josef Strauß, dieses ablehnten, da sie befürchteten, das Abkommen könne das Verhältnis der BRD zu den arabischen Staaten nachhaltig belasten.
Die ebenfalls 1949 gegründete DDR sah sich nicht in der Verantwortung für das Geschehene, da sie für sich in Anspruch nahm, den gesellschaftlichen Zustand, der den NS-Staat erst ermöglicht hatte, überwunden zu haben. Bis zum Ende der staatlichen Existenz der DDR kam es zu keiner Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel. Unter Zugzwang durch die anti-israelische Haltung der Sowjetunion, und ab 1965 quasi entschuldigt durch die Engstirnigkeit der bundesrepublikanischen „Hallstein-Doktrin“, nahm die DDR stattdessen diplomatische Beziehungen zu einer Reihe arabischer Staaten auf.
Seit 1973 sichert der Minerva-Vertrag auch die Zusammenarbeit mit allen israelischen Forschungseinrichtungen. Nach den USA ist Deutschland heute der wichtigste Wissenschaftspartner Israels. Aktuell existieren 34 Minerva-Zentren an israelischen Universitäten und Forschungseinrichtungen, wo in unterschiedlichsten Feldern – von den Geschichtswissenschaften über Umwelttechnologie und Informatik bis zu den Rechtswissenschaften – geforscht wird. Die Zentren finanzieren sich zu gleichen Teilen durch das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Kapital und einen Eigenbetrag der jeweiligen israelischen Universität, die das Zentrum betreibt. Vgl. u.a. Smilansky und Weidenmüller (2006).
Ebd., 24.
Haushalt 1960 insgesamt DM 80.920.015.- vgl. Gesamteinnahmen und -ausgabenrechnung zum 31.12. 1960, MPG-Archiv, II. Abt. Rep. 1A, IV. Abt., Az. 4291. Haushalt 1971 insgesamt DM 540.671.853.- (davon Haushalt A und B: DM 454.084.710.- und Haushalt C (Institut für Plasmaphysik: DM 86.587.143.-), vgl. MPG Jahresbericht 1972 - Jahresrechnung 1971, Bl. 37–38, MPG-Archiv, II. Abt., Rep. 1A, IV. Abt., Az. 4291.
Und zwar in der Niederschrift über die Sitzung der Geisteswissenschaftlichen Sektion des Wissenschaftlichen Rats der MPG am 6. Juni 1961, MPG- Archiv, II. Abt. Rep. 1A, Protokolle der Geisteswissenschaftlichen Sektion, Bl. 2.
Zur Großforschung in der KWG/MPG, siehe den Beitrag von Helmuth Trischler in diesem Band.
Vgl. Carson (2010, 219; 2010, 261f.).
Butenandt (1981, 494–511). Vgl. zur kollegialen Leitung und Mitarbeiterbestimmung auch den Beitrag von Reimar Lüst in diesem Band.
Insgesamt waren in den 1960er Jahren knapp 100 Neuvorhaben an die MPG herangetragen worden, von denen aber letztendlich nur wenige in ihrem Rahmen zum Tragen kamen, vgl. Butenandt (1971, 489–493).
Das Institut existierte zunächst in einer besonderen Rechtsform mit Heisenberg als Gesellschafter und wurde erst 1971 voll in die MPG eingegliedert. Vgl. dazu Boenke (1991) und insbesondere den Beitrag von Helmuth Trischler in diesem Band.
Heisenberg wie Butenandt betrachteten es als Fehler, dass die MPG seinerzeit auf eine führende Mitwirkung beim Kernforschungszentrum Karlsruhe oder beim Hamburger DESY verzichtet hatte, vgl. dazu Carson (2010, 265).
Trotzdem gab es Widerstände sowohl in der nach wie vor stärker naturwissenschaftlich geprägten MPG selbst als auch von außen. So befürchteten die Kultusminister Eingriffe in ihre Kompetenzen und Aushöhlung der geisteswissenschaftlichen Forschung an den Universitäten.
Kant und Renn (2013, 31–34).
Kant und Renn (2013, 34–37).
Die Geschichte des 1970 gegründeten MPI zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt sowie insbesondere der Beschluss zu seiner Schließung nach nur zehn Jahren Forschungsarbeit ist Gegenstand mehrerer kritischer Untersuchungen. Vgl. dazu Leendertz (2010) und Laitko (2011). Siehe insbesondere auch den Beitrag von Ariane Leendertz in diesem Band.
Trunk (2010, 273f.).
Durch Ausgliederung aus dem MPI für Physik war 1950 die Forschungsstelle für Spektroskopie in der MPG zunächst in Hechingen (dem Kriegsverlagerungsort des KWI für Physik) unter Hermann Schüler (1894–1964) entstanden. Im Oktober 1960 war sie nach Göttingen ungezogen.
Als 1965 die Bund-Länder-Kommission den Haushalt für die MPG stark kürzen wollte, spitzten sich unter anderem die Haushaltsverhandlungen für die MPG dramatisch zu. Die Situation veranschaulicht sehr gut der Artikel von Rudolf Leonhardt „Butenandts Zorn. Fünfundzwanzig Millionen retten den Haushalt nicht, ruinieren aber die Max-Planck-Gesellschaft“ in der Zeit (Nr. 34/1965).
Butenandt, Ansprache auf der Festversammlung der MPG, Frankfurt am Main 23. Juni 1966, zitiert nach Henning und Kazemi (2011, 446f.).
Ersteres korrelierte mit einer wissenschaftlichen Neuausrichtung des MPI für Strömungsforschung auf die Untersuchung der Physik der Materie im flüssigen und gasförmigen Zustand. 2004 wurde das Institut in MPI für Dynamik und Selbstorganisation umbenannt, vgl. dazu auch Epple und Schmaltz (2010, 162f.). Das MPI für Silikatforschung wurde 1971 von der Fraunhofer-Gesellschaft übernommen und als Institut für Silicatforschung weitergeführt.
Nach umfangreicher Sanierung wurde 1978 das Archiv der Max-Planck-Gesellschaft in dem ehemaligen biochemischen Forschungsinstitut eröffnet.
„Der Erlaß [vom 28. Januar 1972] wurde zu einem der bekanntesten symbolischen Akte der Unterdrückung; er richtete sich hauptsächlich gegen Kommunisten – man bezeichnete sie als Extremisten oder Radikale –, die Arbeit im öffentlichen Sektor suchten. Obwohl er auch für Neofaschisten galt, waren wenige davon betroffen. Dieser Erlaß vergiftete das innere Klima und läutete ein Jahrzehnt der Proteste, Demonstrationen, politischen Erklärungen und gerichtlichen Entscheidungen ein.“ Braunthal (1992, 9).
Am 11. April 1972, der Anschlag missglückte, da die Bombe nicht detonierte und war auch nicht gegen die MPG, sondern die US-Streitkräfte gerichtet, als deren Offizierskasino das -Haus zu diesem Zeitpunkt fungierte.
Elf Tübinger Institutsdirektoren unter der Ägide von Georg Melchers (1906–1997), Direktor des MPI für Biologie, riefen zu einem Sit-in auf – doch nicht aus Solidarität mit den Forderungen nach mehr Mitbestimmung, sondern aus Protest dagegen. Aus ihrer Sicht gab der designierte Präsident Lüst „kampflos wichtige Positionen“ auf, vgl. dazu Gerwin (1996, 217).
Insgesamt setzt sich die Max-Planck-Gesellschaft aus fünf Organen zusammen: dem Präsidenten, dem Verwaltungsrat (der mit den Generalsekretären den Vorstand bildet und dem damals sieben stimmberechtigte und ein beratendes Mitglied angehörten, deren Amtszeit unbegrenzt war), dem Senat (der den Präsidenten, die Mitglieder des Verwaltungsrats und die wissenschaftlichen Mitglieder wählt) der wiederum von der Hauptversammlung gewählt wird sowie der Wissenschaftliche Rat mit seinen Sektionen, vgl. dazu auch Jentsch, Kopka und Wülfing (1972, 481f.).
„Aufstand der Forscher“, in: Die ZEIT, 18.6.1971 Nr. 25. Zu Einflussbereich und Funktionsverteilung von Staat und Privatwirtschaft in der MPG vgl. Jentsch, Kopka und Wülfing (1972, 478–491).
Ebd., 480.
Der Spiegel 27/1971.
Die ZEIT 25/1971; Der Spiegel 27/1971.
„Die Max-Planck-Gesellschaft braucht keine Diskussion nach innen und außen zu scheuen“. Butenandt (1971).
Zitiert nach Henning und Kazemi (2011, 458). Als Mitglieder der Kommission wurden Generalsekretär Friedrich Schneider, Helmut Coing, Otto Detlev Kreutzfeldt, Hans-Peter Dürr, Hans-Jürgen Engell, Feodor Lynen und Arnulf Schlüter berufen. MPG-Archiv, II. Abt. Rep. 1A, Az. 1 A 3/- Strukturkommission; 61. SP MPG, 10; 62. SP MPG vom 7.3. 1969, 7–12; JB 1969, 5–7.
Butenandt (1970, 38f.).
Bei den neuen Mitgliedern handelt es sich um Dieter Girgensohn (MPI für Geschichte), Rudolf Rass (Fritz-Haber-Institut), Uli Schwarz (Friedrich-Miescher-Laboratorium), Dieter Schwickardi (MPI für Arbeitsphysiologie) und Pölk (MPI für extraterrestrische Physik).Außerdem die Sektionsvorsitzenden Otto Westphal, Albert H. Weller, Heinz Markmann, Gerhard Raspé, Erich Selbach, Jürgen Aschoff, Hermann Mosler. MPG-Archiv, 67. SP MPG vom 24. November 1970, 10.
Reimar Lüst, seit 1963 Direktor des MPI für extraterrestrische Physik, „hatte den Zweiten Weltkrieg als junger Marinesoldat auf einem U-Boot miterlebt, in den 1950er Jahren eine brillante wissenschaftliche Karriere am MPI für Physik in München gemacht und dort die Abteilung für extraterrestrische Physik geleitet. Der Ausbau der MPG setzte sich in seiner Amtszeit fort. Besonders seit Ende der 1970er Jahre stellten stagnierende Haushalte die Entwicklung einer tragfähigen Forschungsstrategie aber vor große Probleme. Die Zeiten des Wirtschaftswunders und des stetigen Aufschwungs waren vorbei.“ Zitiert nach der Website der MPG, Zeitleiste. Zu Lüsts Sicht der Strukturreform und seiner Präsidentschaft in der MPG siehe auch seinen Beitrag in diesem Band.
„Mehr Mitbestimmung für die Forscher – Weniger Geld für die Forschung“ in: Süddeutsche Zeitung, 28. November 1971. Vgl. dazu auch Nolte (2008, 180).
Ein historisches Datum, da am gleichen Tage im Bonner Bundestag versucht wurde, Willy Brandt wegen seiner Ostpolitik durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen.
Becke war seit 1969 Direktorin des Gmelin-Instituts für anorganische Chemie und damit die erste weibliche Direktorin in der Max-Planck-Gesellschaft. Zuvor war sie als erste Frau Rektorin einer westdeutschen Universität geworden: 1966–1968 an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Gerwin (1996, 218). Auf der Hauptversammlung in Kiel 1978 beschließen die Mitglieder die Satzungsänderung hinsichtlich des Stimmrechts der wissenschaftlichen Mitarbeiter in den Sektionen (§25.2), Jahrbuch der MPG 1978.

