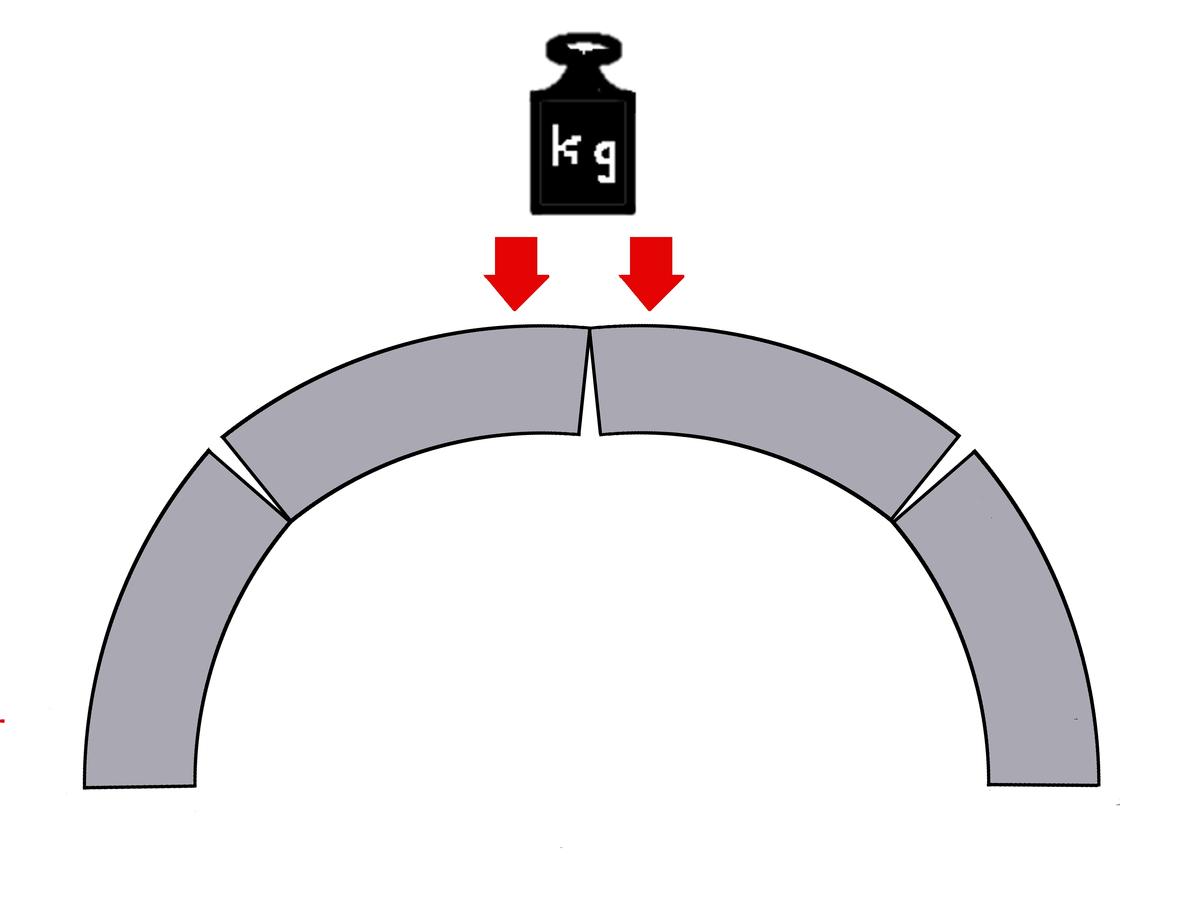Chapter structure
- 3.1 Historische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Entwicklung der römischen Architektur
- 3.2 Bauverwaltung
- 3.3 Planung und Entwurf
- 3.4 Logistik
- 3.5 Materialwissen
- 3.6 Bautechniken
- 3.7 Ingenieurbau
- 3.8 Die Architekten
- 3.9 Das Bauwissen: Quellen, Tradierung und Entwicklung
- 3.10 Innovationen
- Fußnoten
3.1 Historische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Entwicklung der römischen Architektur
Rom
Man kann das alles ablesen an einem der beeindruckendsten Werke der römischen Architektur, dem Pantheon. Die etwa fünfzig Tonnen schweren Säulenschäfte der Vorhalle aus Granodiorit stammen aus Steinbrüchen in der ägyptischen Wüste. Die Formen der Basen, Kapitelle und Architrave der Vorhalle und vieler anderer Bauglieder sind nicht römisch, sondern aus der hellenistischen Architektur übernommen worden. Die Übernahme von Bauformen anderer Kulturen in diesem Umfang, an einem zentralen Bau des Herrscherhauses in der Hauptstadt, wäre in jeder anderen der antiken Hochkulturen vollkommen undenkbar gewesen. Und doch ist die Vorhalle nur der monumentale Eingang zu einem Kuppelsaal, dessen Dimensionen und dessen technische Konstruktion ohne Vorbild in der antiken Welt sind. Wie das Werk, so der Architekt, könnte man meinen, wenn man bedenkt, dass Apollodor
Um die hiermit nur angedeuteten Hintergründe der römischen Architekturentwicklung darstellen zu können, soll im Folgenden zunächst ein kurzer Abriss der staatlichen Entwicklung und Expansion Roms
3.1.1 Gründung der Stadt Rom und Königszeit
Die Gründung Roms
Die archäologisch nachweisbar ältesten, früheisenzeitlichen Siedlungsreste der Stadt stammen aus dem 10. und 9. Jh. v. Chr. Sie liegen auf dem Palatin (die Roma quadrata der antiken Überlieferung). Bezugspunkt der Ansiedlung war sicher, dass der Tiber in der Nähe der Siedlung wegen der Tiberinsel
3.1.2 Die frühe Republik
Im Gefolge der Vertreibung des letzten römischen Königs bildeten sich die Eckpfeiler der römischen Verfassung aus: An der Spitze des Staates standen seither zwei jährlich gewählte Konsuln, zunächst aus dem Kreis der patrizischen Nobilität. In diese Periode fallen die sog. Ständekämpfe zwischen Patriziern und Plebejern, in denen die Rechte der Plebs schrittweise, aber nachhaltig erweitert wurden durch die Einrichtung des Volkstribunats und die Zulassung von Plebejern zu praktisch allen politischen Ämtern. Später folgte die Anerkennung der Beschlüsse der Volksversammlung durch den Senat (Lex Hortensia von 287 v. Chr.).

Abb. 3.1: Expansion Roms
Außenpolitisch fallen in diese Phase die ersten Kämpfe Roms
Wesentlich nachhaltiger als diese spektakulären, existenzgefährdenden militärischen Abwehrkämpfe Roms auf gleichsam internationaler Bühne waren die regionalen Offensivaktionen Roms
3.1.3 Die mittlere Republik
Während die Zeit bis zum Ende der Pyrrhoskriege Rom
Die Kämpfe mit Karthago
Bereits während des zweiten punischen Kriegs begannen die Auseinandersetzungen mit dem griechischen Osten, und zwar wegen eines Bündnisses zwischen Hannibal
Rom
Vor allem die großen Eroberungen Roms
3.1.4 Späte Republik
Die Zeit ab 133 v. Chr. war im wesentlichen die Zeit der inneren ,Krise der Republik‘, die sich zu den großen Bürgerkriegen ausweitete, die nicht auf Rom
Die Krise der Republik war insgesamt gesehen, trotz des Niedergangs der politischen Institutionen und der menschlich wie materiell enormen Kosten, keine Phase der Stagnation oder gar des Rückschritts der Architekturentwicklung. Das hat verschiedene Gründe. Auf die Stadt Rom
Aus der auf die Heere gestützten Macht von Einzelpersonen resultierte noch ein anderer Impuls für das Bauen, der sich außerhalb Roms
Ein dritter Impuls ging von der fortschreitenden Provinzialisierung eroberter Gebiete außerhalb Italiens
3.1.5 Prinzipat
In der ersten Phase der Kaiserzeit erreichte das Imperium seine größte Ausdehnung mit der Eroberung Britanniens
Rom
Die Zeit etwa bis zum Ende des zweiten Jhs. n. Chr. ist zugleich die Phase, in der die römische Kultur und Architektur sich in nahezu allen großen Städten des Reichsgebietes durchsetzte. Das Straßensystem
Das Prinzipat war zudem die Zeit der großen Innovationen
3.1.6 Dominat – die Spätantike
Mit der Ausbildung des Dominats, d. h. mit den gelegentlich als ,Zwangsstaat‘ apostrophierten Reichsreformen unter Diocletian
Bedingt vor allem durch die nahezu permanente Überlastung der Wirtschaft durch die immensen Kosten der Grenzverteidigung gegen die beginnende Völkerwanderung, ist in vielen Bereichen der inneren Zerfall des spätantiken Reiches beobachtbar. Das gilt jedoch nicht pauschal für die Architekturentwicklung. Zwar ist der Verfall vieler großer Bauwerke, und auch die nicht mehr ausreichende Instandhaltung der Infrastruktur konstatierbar, doch zeigten die Baumeister dort, wo entsprechende Ressourcen aufgewendet werden konnten, noch immer ihr technisches Können. Dem Verfall der alten Tempelbauten stehen die Neubauten christlicher Kirchen- und kaiserlicher Profanbauten gegenüber, die vor allem die Beherrschung des Bauens von Räumen mit großen Spannweiten in Holz und Stein belegen. Fassbar ist die Krise aber auch bei diesen Projekten, denn für deren Ausstattung plünderte man häufig ältere Bauten. Die Verwendung von Baugliedern älterer Gebäude an Neubauten (Spolien), die mit dem Verlust von handwerklichem Wissen und Können einhergingen, wurde auch nach der Auflösung des römischen Reiches noch jahrhundertelang fortgesetzt.
3.2 Bauverwaltung
3.2.1 Öffentliches Bauen – die Republik
Die Organisation staatlicher Bauvorhaben
Vor allem während der frühen und mittleren Republik lagen die meisten großen Bauvorhaben, aber auch die Instandhaltung der öffentlichen Gebäude und der Infrastruktur, in der Hand der beiden Zensoren (censores). Die Zensur als eigenständige Magistratur höchsten Ranges war bereits im 5. Jh. v. Chr. geschaffen worden.5 Sie bestand bis zu ihrer Abschaffung 22 v. Chr. durch das Kaiserhaus unter Augustus
Denn Zensoren bekamen, soweit erkennbar, ein Budget per Senatsbeschluss zugewiesen.8 Die Summen konnten enorm sein: Livius17
In der Verwendung der zugewiesenen Mittel waren die Zensoren relativ frei, doch behielt der Senat sich ein letztinstanzliches Entscheidungrecht vor.13 Das zeigt sich beispielsweise an einem Senatsbeschluss, der dem Zensor Gaius Cassius Longinus
Zu den bekannten frühen Bauprojekten der Zensoren gehört die Errichtung der ersten bekannten Stadtmauer Roms
Die Zuweisung der Bauaktivitäten an die Zensoren war mit verschiedenen Problemen verbunden. Unmittelbar evident ist die Diskrepanz zwischen Amtsperiode und Bauzeit bei Großprojekten, die vor allem für die großen Wasserleitungsprojekte belegt ist. Die rein formal naheliegende Lösung, einen Bau wegen der zwischenzeitlichen Vakanz unter Leitung des Nachfolgers zu vollenden, ist nur ausnahmsweise nachweisbar für den Bau einer Tiberbrücke.19 Stattdessen wurde schon früh improvisiert. Beim Bau der Aqua Appia gelang es dem Zensor Appius Claudius Caecus
Die Probleme des regulären, von den Zensoren geleiteten Bauens beschränkten sich nicht allein auf den Bereich der Organisation. Phasenweise eine erhebliche Rolle spielen Interessenkonflikte. Der naheliegende Gegensatz zwischen staatlichen Repräsentanten, die möglichst wirtschaftlich mit den ihnen zugewiesenen Mitteln umgehen sollten, und den privaten Bauunternehmern, die an möglichst hohen Gewinnmargen interessiert waren, wurde im republikanischen Rom
Zu einem ähnlichen Konflikt kam es 169 v. Chr. in der Amtszeit der Zensoren C. Claudius Pulcher
Die Praxis der Vergabe und Abwicklung von Bauprojekten
Dokumente, die die Vergabepraxis der Zensoren unmittelbar dokumentieren, sind nur in geringer Zahl erhalten. Daraus, und aus diversen anderen Quellen lässt sich aber wenigstens im Umriss das Verfahren beschreiben.31 Das einzige Dokument, das die Vergabepraxis stadtrömischer Beamter in einigen Punkten unmittelbar wiedergibt, ist eine stark fragmentarisierte Inschrift aus dem frühen 1. Jh. v. Chr.32 Der vergebende Beamte war der Stadtprätor Titus Vibius Temuudinus
Sehr viel detailreicher und wesentlich besser erhalten als diese Dokumente aus Rom selbst ist eine Bauinschrift aus Puteoli, die sog. Lex Puteolana aus dem Jahr 109 v. Chr.34 Sie betrifft die Errichtung eines Torbaus in der Umfassungsmauer des Sarapis-Heiligtums. Vergeben wurde der Vertrag von einer Baukommission (duumviri) an den freigeborenen Unternehmer C. Blossius
Einzigartig ist die Inschrift hinsichtlich der Exaktheit der Beschreibung der zu erbringenden Leistung: Sie ist so präzise, dass sie als verschriftlichter Bauentwurf gelten kann. So sind beispielsweise für alle Bauteile aus Holz jeweils die Holzart, die Abmessungen und die Dekoration festgelegt.36 Für das Dach ist selbst die Anzahl der Ziegelreihen angegeben. Die Inschrift entspricht in dieser Hinsicht einer griechischen Syngraphé,37 und man kann daher vermuten, dass in Unteritalien
Aufgrund der präzisen technischen Angaben ist zudem zweifelsfrei, dass mindestens dieser Teil des Vertrages nicht von einem ausschreibenden Beamten, sondern nur von einem Architekten formuliert worden sein kann. Welche Stellung dieser Architekt hatte, bleibt aber unklar. Möglich ist, dass eines der beiden Kommissionsmitglieder selbst Architekt war. Denkbar ist aber auch, dass diese Teile der Inschrift auf ein detailliertes Angebot zurückgehen, das der Unternehmer (und Architekt) Blossius
Die sicherlich vielschichtigste Quelle, die gleichermaßen die formale Seite wie die möglichen Interessenkonflikte des Vertragsverfahrens anschaulich werden lässt, ist ein Abschnitt aus Ciceros
Der Unternehmer Publius Junius
Etwa fünf Jahre nach Vertragsabschluss, im Jahr 80 v. Chr., starb Publius Junius
Die Verwandten und weiteren Vormünder des jungen Iunius versuchten nun zunächst, bei Verres
Das Endergebnis ist, dass das Mündel ruiniert war, da es die zugeschlagene Vertragssumme nicht aufbringen konnte, und entsprechend der Bürge des ursprünglichen Vertrages, Decimus Junius, ersatzweise für die volle Summe haften musste. Decimus bekam allerdings in der Folge, nachdem er massiven Druck auf Verres
Der geschilderte Fall enthält fast die gesamte reguläre Verfahrensweise des römischen Vergaberechts, allerdings immer nur im Spiegel von Verres’
Öffentliches Bauen – die Kaiserzeit
Das Kaiserhaus musste sich also für die Leitung seiner seiner Bauprojekte neue Organisationsformen schaffen, zumal da die Bauaktivitäten phasenweise noch weit größeren Umfang hatten als in republikanischer Zeit. Vor allem die Infrastruktur der Stadt war durch die Bürgerkriege teils vernachlässigt, teils zerstört worden. Rom
Betrachtet man nun sozusagen die Organisationsentwicklung der kaiserlichen Bauaktivitäten, dann zeigt sich ein Prozess schrittweiser Weiterentwicklung, der nur verständlich wird, wenn man neben den funktionalen Erfordernissen bei der Leitung der Bauprogramme zugleich die oben skizzierten politischen Aspekte in Rechnung stellt. Die am besten aus den Quellen in ihrer Entwicklung rekonstruierbare Baubehörde ist die cura aquae, die für die Frischwasser- und Abwassersysteme der Stadt Rom
Die cura aquae und andere staatliche Organisationen
Zur Zeit, als Augustus
Wie bedeutsam die Aufgabe aus Sicht von Augustus
Ein Jahr nach seinem Tod 12 v. Chr. wurde die cura aquae schließlich doch auf eine gesetzliche Grundlage gestellt, indem der Senat das Amt des curator aquae einrichtete und dessen Aufgaben und Rechte bestimmte. Ihm zur Seite gestellt wurden zwei leitende Beamte. Die Besetzung der drei Ämter erfolgte nach dem alten System der Magistraturen, d h. Fachkompetenz war bei der Wahl kein entscheidendes Kriterium, sondern es wurden in anderen Ämtern bewährte Mitglieder der Nobilität periodisch gewählt.48 Auch für den repräsentativen Auftritt der neuen Magistrate im alten Stil wurde gesorgt, in dem ihnen für Inspektionen außerhalb der Stadt Liktoren, Ausrufer und drei staatliche Diener zugestanden wurden.49 Die Amtszeit folgte zumindest anfangs nicht dem normalen Muster der Jahresmagistraturen, sondern entsprach eher dem alten Zensorenamt: Wahlen fanden zunächst mehrfach nur alle zehn Jahre statt, die tatsächliche Amtszeit füllte jedoch nicht den gesamten Zeitraum zwischen den Wahlen aus, sie dauerte vielmehr drei Monate pro Jahr. Das System scheint sich jedoch nicht bewährt zu haben, denn die Wahlen erfolgten später in wesentlich kürzeren Abständen.50 Frontinus beispielsweise, dessen Schrift de aqueductu wir die meisten Informationen zur Arbeit der Cura verdanken, amtierte nur ein Jahr.
Ein weiterer substantieller Schritt beim Ausbau der Cura ergab sich im Gefolge des Baus der Aqua Claudia 52 n. Chr. Die Gesamtzahl der aquarii wurde annähernd verdreifacht, wobei die 460 zusätzlichen Sklaven aus dem Vermögen des Kaiserhauses finanziert wurden.51 Trotz dieser Erweiterung konnte die Behörde nicht alle Arbeiten am Leitungssystem selbst bewältigen. Nicht nur für Neubauten, sondern offenbar auch für größere Reparaturen wurden, wie in den Zeiten der Republik, Werkaufträge an private Unternehmer vergeben.52
Das Organisationsmodell der Cura entsprach mithin zumindest insoweit dem Anspruch des Augustus
Nach dem Muster der stadtrömischen Cura sind in großen Städten des Imperiums ähnliche Behörden aufgebaut worden.54 Im Verlauf der Kaiserzeit verstärkte sich die Tendenz, das alte System von Werkverträgen mit privaten Unternehmern, die von Magistraten beauftragt wurden, durch neu gegründete Staatsunternehmen zu ersetzen. Zu nennen ist in diesem Zusammenhang etwa die ratio marmorum, die ab dem 2. Jh. n. Chr. für den Import von Marmor und anderen Gesteinen aus verschiedenen Steinbrüchen der Provinzen zuständig war,55 und vor allem die opera caesaris, die zentrale und direkt dem Kaiserhauses unterstellte Organisation zur Durchführung von Bauprojekten.56 Ihre Einrichtung erfolgte wohl erst gegen Ende des 1. Jh. n. Chr. im Kontext der Bauprogramme Domitians
Große Bedeutung nicht nur für die Leitung, sondern auch für die Durchführung von öffentlichen Bauprojekten hatte in der Kaiserzeit zudem das Militär. Technische Kapazitäten hatten die Legionen bereits in republikanischer Zeit durch die Pioniereinheiten, die für den Lagerbau sowie den Bau und die Wartung von Kriegsmaschinen zuständig waren und über entsprechendes Personal – unter anderem eigene Architekten – verfügten. Der bekannteste unter ihnen ist wiederum Vitruv
Die Tatsache, dass es aus der Kaiserzeit nahezu keine Inschriften gibt, die Bauvorgänge dokumentieren, ist kaum den Zufälligkeiten der Erhaltung zuzuschreiben, sondern dürfte mit der oben skizzierten Entwicklung direkt zusammenhängen. In der Republik waren die bauleitenden Beamten der Öffentlichkeit gegenüber verantwortlich. Entsprechend war es nur folgerichtig, wenn bauleitende Beamte von ihnen abgeschlossenen Verträge durch Inschriften öffentlich dokumentierten.58 In der Kaiserzeit hingegen waren die bauleitenden Beamten bei Großprojekten in der Regel nicht mehr der Öffentlichkeit, sondern dem Kaiserhaus gegenüber rechenschaftspflichtig, und insofern bestand kein Anlass mehr, Verträge, Zahlungen usw. gegenüber der Öffentlichkeit zu dokumentieren.
3.2.2 Private Bauaufträge
Über die Auswahl von Architekten und Bauunternehmern durch Privatleute ist kaum etwas bekannt. Es gibt lediglich einige Hinweise dazu in den angesprochenen Briefen. Da fast alle Architekten, die Cicero
Zu den wenigen Hinweisen auf den Inhalt eines Bauvertrages, der auf Basis rein geschäftlicher Beziehungen zwischen Bauherr und Architekt geschlossen worden sein könnte, gehört das erwähnte catonische Bauformular. Der Architekt, von Cato
Für die bauhandwerklichen Arbeiten, insbesondere die Anlage der Mauern, werden genaue technische Vorgaben gemacht, etwa für den Kalkanteil des Mörtels, die Fundamentierungstiefe, die Wandstärke, die Verputzung usw. Dabei werden beide seinerzeit üblichen Bautechniken gesondert dargestellt, also in Mörtel gesetzter Naturstein und Lehmziegelbau. Abgerechnet wird die Arbeit nach Bauvolumen oder Menge des verbauten Materials, d. h. pro hundert Fuß Mauer oder pro versetztem Ziegel, nicht nach Bauzeit.
Der Text enthält des weiteren einige rein juristische Klauseln. Die bekannteste ist die bona fide Klausel, die beide Parteien auf den Grundsatz des ,billigen Ermessens‘ verpflichtet.67 Sie bedeutet, dass beide Parteien im Streitfall bei der nicht explizit erwähnten, aber offensichtlich permanent berücksichtigten Abnahme des Baus das Urteil eines Richter nach billigem Ermessen anerkennen werden. Berücksichtigt werden weiterhin nicht vom Auftragnehmer zu verantwortende Bauschäden, etwa durch Blitzschlag, und erschwerte äußere Bedingungen (Zuschlag bei Bau im Hochsommer ein Viertel der vereinbarten Summe). Auch die Haftung des Bauherrn für Qualitätsmängel der von ihm angelieferten Materialien ist vertraglich geregelt.
Allgemeine juristische Bestimmungen enthalten auch die oben angesprochenen Passagen aus der kaiserzeitlichen Rechtsliteratur zum Vertrag vom Typ locatio conductio.68 Sie geben an, dass der Vertrag konsensuell und formfrei ist, so dass beliebig viele Vereinbarungen in dem Vertrag festgeschrieben werden können. Der Bauherr als locator beauftragt den Unternehmer, den conductor, mit dem Projekt, für das letzterer einen einklagbaren Anspruch auf Zahlung (merces, pretium) erwirbt. Letzterer übernimmt damit zugleich die Haftung für die Ausführung bzw. Baumängel. Darauf bezogen ist beispielsweise in den Digesten bestimmt, dass der Unternehmer auch dann für einen Transportschaden an einer Säule haftet, wenn der Schaden von einer Hilfskraft verschuldet worden ist.69 Zu erfahren ist dort auch, dass die Haftung im Fall von Bauschäden, sofern sie auf mangelnde Festigkeit des Baugrunds zurückzuführen sind, anders geregelt war als heute: In diesem Falle haftet der Auftraggeber, weil er gleichsam ein Objekt minderer Qualität für das Projekt gestellt hat.70
3.3 Planung und Entwurf
3.3.1 Architekt, Bauherr und die Kernkompetenz des Architekten
„By his side stood several builders, who had been summoned to construct some new baths and were exhibiting different plans for baths, drawn on little pieces of parchment. When he had selected one plan and specimen of their work, he inquired what the expense would be of completing that entire project. And when the architect had said that it would probably require about three hundred thousand sesterces, one of Fronto’sfriends said, 'And another fifty thousand, more or less'“.
Für moderne Vertreter des Fachs wird sich diese Passage wahrscheinlich kaum überraschend lesen, da es sich auch in der Neuzeit jahrhundertelang quasi von selbst verstanden hat, dass Architekten ihre Ideen in Form von Zeichnungen entwickeln und präsentieren, auch wenn es bei den Zeichnungen auf Pergament, von denen Gellius
Der Bauentwurf, der in den Zeichnungen dokumentiert ist, betrifft aus Vitruv
Nun haben Zeichnungen bei der Arbeit des Architekten unterschiedliche Funktionen. Neben der hier angesprochenen Präsentation von Entwurfsideen dienen sie vor allem der Kommunikation mit den ausführenden Handwerkern in Form von Bauplänen, und sie dienen dem Architekten bei seiner eigenen Arbeit am Entwurf, also der Konzeptionierung und der Formfindung. Betrachtet sei hier nun zunächst einfach, was man über Bauzeichnungen aus römischer Zeit anhand von Funden und Quellen sagen kann.
3.3.2 Römische Architekturzeichnungen und ihre Funktion
Bauzeichnungen dienten bereits in der Antike auch zur Dokumentation bereits fertiggestellter Bauten. So ließ Pompeius
Auch die angesprochene, in Fragmenten erhaltene forma urbis war eine Dokumentation eines Baubestandes. Gefunden haben sich zudem einige Fragmente von Reliefs, die offensichtlich Baupläne dauerhaft dokumentieren sollten, also wohl repräsentative Funktion hatten. Der Unterschied zwischen diesen Reliefs und den anzunehmenden Originalen ist insofern von Bedeutung, als sie nicht von Architekten hergestellt wurden. Ein Steinmetz kann die auf dem Plan verwendeten Symbole falsch oder missverständlich wiedergeben, Elemente der Zeichnung übersehen, da er nicht die Ausbildung zum Architekten hat, und da seine Fehler – im Gegensatz zu Fehlern auf einem auszuführenden Bauplan – folgenlos sind. Zu bedenken ist schließlich auch, dass der Steinmetz im Gegensatz zum Architekten nicht die Möglichkeit hat, Fehler durch Rasur zu korrigieren. Aus diesen Gründen ist es auch nicht möglich, auf Basis der Reliefs zuverlässig zu klären, ob die originale Bauzeichnung maßstäblich war, und wenn ja, in welchem Maßstab sie ausgeführt worden ist. Beobachtungen an einigen der Reliefdarstellungen deuten aber darauf hin. Ein vielleicht gängiger Reduktionsmaßstab könnte beispielsweise 1 : 16 betragen haben, also ein Zoll für einen Fuß. Heisel, der das Material zusammengestellt und ausgewertet hat, sieht Maßstäblichkeit als eine Forderung Vitruv
Vor allem die Darstellung des Plans einer von einer Mauer eingefriedeten Grabanlage auf einem in Perugia
3.3.3 Das Entwerfen: Zeichnen oder Rechnen?
Bei seinem Entwurf für den dorischen Tempel entspricht sein Vorgehen dieser Forderung, denn er gibt alle Maße auf Basis der Triglyphenbreite als Grundeinheit an. Bei seinem ionischen Tempelentwurf ist das jedoch keineswegs der Fall, sondern er wählt dort ein anderes Verfahren. Die (relativen) Bemessungen der Bauglieder erfolgt hier auf Basis von Proportionsketten, d. h. ausgehend von dem Maß eines Bauglieds wird vermittelt durch eine Proportion, die er jeweils angibt, das Maß eines weiteren abgeleitet, und daraus wiederum durch eine weitere Proportion das Maß eines dritten, und so fort.83 Vitruv
Für die römischen Architekten lassen sich beide Methoden sicher belegen. Das Entwerfen anhand von proportionalen Berechnungen ist nicht nur im Werk von Vitruv
Eindeutig zeichnerisch konstruiert, nicht nur dargestellt, sind hingegen viele Formen von Baugliedern. Zum Teil müssen die geometrischen Konstruktionsformen hier geradezu als alternativlos gelten. So ist die Konstruktion der Voluten des ionischen Kapitells, die Spiralen darstellen, in Rom
Was man hingegen für die Entwurfsarbeit nicht belegen kann, sind die perspektivischen Darstellungen, die Vitruv
Es gab auch Mischformen zwischen rechnerischer und geometrischer Konstruktion. Ein einfaches Beispiel dafür ist das schon angesprochene ionische Kapitell. Während nämlich die spiralförmigen Voluten stets mit Zirkelschlägen konstruiert wurden, gab es für die Größenverhältnisse der einzelnen Elemente des Kapitells proportionale, also rechnerisch bestimmte Regeln, etwa im Verhältnis von Volutenhöhe zu Gesamthöhe oder von Gesamthöhe zur Breite des Abacus (der Deckplatte des Kapitells). Strenggenommen waren alle vollständig ausgearbeiteten Bauentwürfe Mischformen von zeichnerischem und rechnerischem Entwerfen, denn selbst wenn die Hauptmaße strikt rechnerisch entwickelt worden waren, gab es doch immer auch eine Vielzahl an Detailformen, die gar nicht anders als zeichnerisch entwickelt und dargestellt werden konnten. Das gilt nicht nur für fast die gesamte Bauornamentik, sondern auch für die Form wesentlicher Bauglieder wie etwa der Säulenschäfte, deren Entasiskurve – die Schwellung des Schafts in der Mitte, durch die sich die Flaschenform der Schäfte ergab – nur graphisch festgelegt werden konnte.86 Es lässt sich auch im Werk von Vitruv
3.3.4 Vitruv und das wissenschaftliche Entwerfen
Für Vitruv
Zu den wissenschaftlichen Disziplinen
Des weiteren bezieht sich Vitruv
Eine weitere Disziplin der antiken Wissenschaften, die der Architekt
Die wissenschaftliche Disziplin, die wohl die größte Bedeutung für Vitruv
Sozusagen der Störfaktor, dem Vitruv
Nahezu alle hier angesprochenen Formen optischer Korrekturen haben sich bei der Analyse von Bauten nicht identifizieren lassen. Man könnte daraus folgern, dass Vitruv
When you find fault with the narrow windows, let me tell you that you are criticising the Cyropaedeia. For when I made the same remark, Cyrus used to answer that the views of the gardens through broad lights were not so pleasant. For let a be the eye, bg the object seen, d and e the rays ... you see the rest. For if sight resulted from the impact of images, the images would be in great difficulties with a narrow entrance: but, as it is, that „effusion“ of rays gets on quite nicely. If you have any other fault to find you won’t get off without an answer, unless it is something that can be put right without expense.
Die Passage zeigt zunächst, dass Cyrus
3.4 Logistik
An Bedeutung verloren hat die Logistik erst in spätantiker Zeit, allerdings nicht, weil nicht mehr in großem Maßstab gebaut wurde, sondern weil bei Neubauten in immer größerem Umfang bereits vorhandenes Material aufgelassener Bauten zweitverwendet wurde. Das gilt für einfache Ziegelsteine ebenso wie dekorativ gestaltete Bauteile aus Marmor. Für letztere steht beispielhaft der Konstantinsbogen, der zu großen Teilen aus Bauteilen anderer Gebäude (Spolien) errichtet wurde.
Baumaterial ist normalerweise ein Massengut, das die Römer – ebenso wie spätere Epochen – wo immer möglich auf Wasserwegen transportierten. Das gilt selbst für vergleichsweise kurze Strecken. So wurde ein großer Teil der in Ostia
Trotz der in einigen Bereichen sehr intensiven Forschungen sind die technische wie die organisatorische Seite der römischen Logistik und die entsprechende Infrastruktur heute nicht mehr vollständig erkennbar. Doch ist das Bild der älteren Forschung, die insbesondere die Leistungsfähigkeit des römischen Landtransports bezweifelt hatte,101 mittlerweile zweifelsfrei revidiert worden.
3.4.1 Transporte auf dem Wasser
Über die alltäglichen, und sicher ältesten Formen des Transports von Baumaterial auf dem Wasserweg, geben die Quellen kaum Aufschluss. Wenn wir Berichte haben, dann über einzelne, spektakuläre Transporte wie die von Obelisken. Sicher ist, dass Holz, wo immer möglich, aus Kostengründen nicht auf Schiffe verladen wurde, sondern mit Flößen über die Flüsse in die Städte gebracht wurde. Vitruv
3.4.2 Häfen und Stapelplätze
Solange die Bevölkerung Rom
In der Stadt selbst gab es bis in spätrepublikanische Zeit nur einen Flusshafen für den Umschlag sämtlicher Arten von Gütern, das Emporium vor der Porta Trigemina
Diese Situation änderte sich nachhaltig, als die Stadt etwa ab Mitte des 1. Jhs. v. Chr. massiv expandierte, was einerseits einen erheblich gesteigerten Bedarf an importierten Nahrungmitteln bedeutete, der nur über den Seeweg abzuwickeln war,109 und natürlich den Bedarf an Baumaterial anwachsen ließ. Hinzukam, dass der Umfang und die Ansprüche an öffentliche Bauten deutlich stiegen. Caesar
Die Bewältigung der entsprechenden Transportvolumia war an eine Reihe von Voraussetzungen gebunden. Man brauchte einen Seehafen, dessen Einfahrt auch bei ungünstigen Winden kontinuierlich angelaufen werden konnte und in dem die Schiffe vor Sturm geschützt waren. Zudem musste das Hafenbecken die für große Schiffe erforderlichen Tiefe haben, und schließlich brauchte man Kaianlagen von erheblicher Länge, um eine große Anzahl von Schiffen gleichzeitig entladen zu können. Da der Umschlag der Güter von den Seeschiffen auf die Flusskähne für den Transport in die Stadt nicht ,just in time‘ erfolgen konnte, war zudem die Anlage von Stapelplätzen und der Bau von Lagerhallen notwendig.
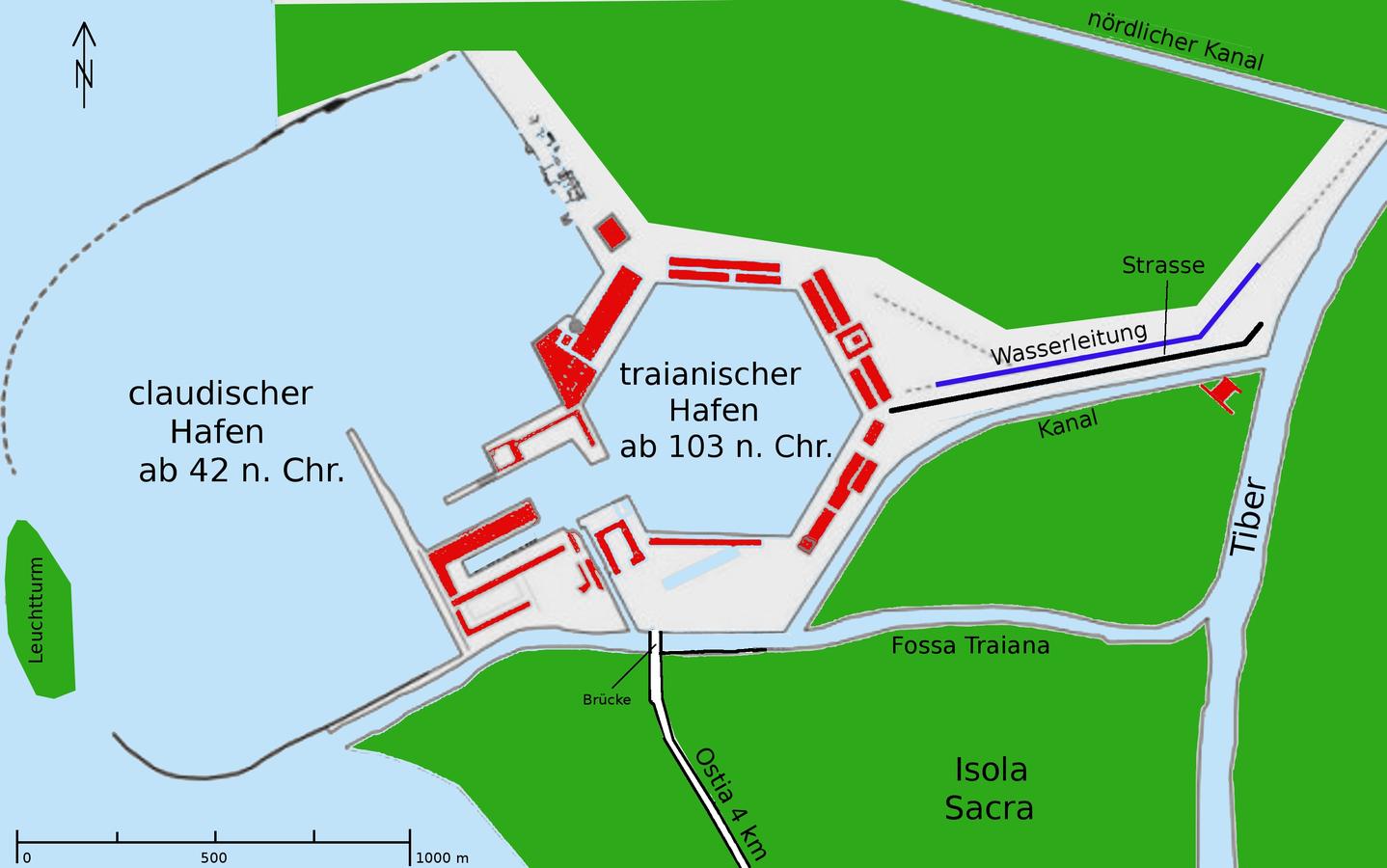
Abb. 3.2: Portus. Unter Claudius und Traian gebaute Hafenanlagen (W. Osthues).
Der Bau einer solchen Infrastruktur hat sich über lange Zeit hingezogen. Erhebliche Erweiterungen der Hafenkapazitäten wurden noch im 2. Jh. vorgenommen. Mit der Anlage eigener Hafenabschnitte für den Umschlag von Baumaterial wurde aber bereits vor der Zeitenwende begonnen, und zwar zunächst in Rom
3.4.3 Landtransport
Da Baumaterialn wegen der Kosten wo immer möglich auf dem Wasser transportiert wurde, dürfte der Ferntransport von Materialien auf dem Landweg nur eine geringe Rolle gespielt haben. Entsprechend hatte auch das – spätestens in der Kaiserzeit hervorragend ausgebaute – Fernstraßennetz für das Bauwesen kaum große Bedeutung.113 Erinnert sei in diesem Zusammenhang nur an die schon zitierte Bemerkung Vitruvs
Vollkommen vermeidbar war der Landtransport der Materialien natürlich nicht, da das Material ja immer zumindest vom Hafen zur Baustelle gebracht werden musste. Die wenigen Hinweise in den Quellen dazu gelten den Problemen des innerstädtischen Transports. Juvenal
Gleichwohl war der Transport auch schwerer Lasten mit von Ochsen oder Maultieren gezogenen Wagen kein grundsätzliches Problem. Hinweise auf die verwendeten Typen von Wagen geben einige bildliche Darstellungen. Hinzukommen in jüngerer Zeit Funde von an Wagen verwendeten Bauteilen aus Eisen, die zeigen, dass die römischen Stellmacher auch fortgeschrittene Techniken beherrschten.117 Zwar gelten nicht die Römer, sondern die Kelten als führend im antiken Wagenbau, doch ist anhand verschiedener technischer Termini gezeigt worden, dass die Römer wesentliche Neuentwicklungen von den Kelten übernommen haben.118
Leichte bis mittelschwere Wagen, die von Pferden oder Maultieren gezogen wurden, waren aus Esche hergestellt, schwere Wagen mit Ochsengespannen als Zugtieren wurden aus Eiche gefertigt.119 Bildliche Darstellungen zeigen fast immer eine Bespannung mit zwei Zugtieren und offene Wagen mit ein oder zwei Achsen.120
Die Römer verbauten relativ große Räder, die auf unebenem oder weichem Boden einen geringeren Rollwiderstand haben als kleinere Räder.121 Scheibenräder, die verglichen mit Speichenrädern ein relativ hohes Gewicht haben und kaum elastisch sind, findet man vereinzelt auf bildlichen Darstellungen.122 Meist sind auf den bildlichen Darstellungen Wagen mit den schon seit dem 2. Jahrtausend aus Mesopotamien
Ein Fundkomplex aus Neupotz
Einachsige Wagen brauchten per se keine Lenkung. Auch zweiachsige Wagen hatten häufig keine Lenkung, obwohl dadurch der Verschleiß an Rädern und Achsen höher war als bei Wagen mit gelenkter Vorderachse. Die Lenkung der Vorderachse (auf einem Drehschemel oder mit einem Bolzen) war aber bekannt. Auf dem Relief eines Transportwagens für Weinfässer aus Langres etwa liegt der Wagenkasten erheblich höher als die Achsen, was konstruktiv nur Sinn macht, wenn die vordere Achse schwenkbar war. Nachweisbar ist die – in der Forschung lange umstrittene – Lenkung der Vorderachse an dem aufgrund von Befunden rekonstruierten Kölner Reisewagen. Ebenfalls nachgewiesen ist dort die Federung des Wagenkastens. Bremsen könnten auf einigen Abbildungen darstellt sein, doch sind sie nicht zweifelsfrei erkennbar.
Konstruktiv nicht gelöst von den römischen Stellmachern ist das Problem, dass Speichenräder, bei denen die Speichen alle in einer Ebene liegen, nur sehr wenig quer zur Fahrtrichtung wirkende Kräfte aufnehmen können.124 Das Prinzip, die Speichen leicht konisch anzuordnen, indem sie auf der Nabe versetzt zu einander befestigt werden (wie bei einem Fahrrad), ist jedenfalls für die römische Antike nicht zu belegen. Berechnungen haben allerdings ergeben, dass die Wagen mit Speichenrädern ein Gesamtgewicht von drei Tonnen hätten haben können, was deutlich über dem liegt, was ein Pferdegespann ziehen kann (ca. 1 to). Mehr als zwei Zugpferde waren selten.125 Noch im Codex Theodosianus war das Maximalgewicht der Ladung für Wagen des cursus publicus (der staatlichen ,Transportorganisation‘) auf knapp fünfhundert Kilogramm beschränkt.126
Da im Bauwesen aber erheblich höhere Lasten transportiert worden sind, muss man mit noch anderen Wagentypen und Bespannungen rechnen. Bei Lasten bis etwa zehn Tonnen dürften die Römer Wagen mit Scheibenrädern verwendet haben, die von zehn oder noch mehr Ochsenpaaren gezogen wurden, wie es aus Griechenland
Nochmals höhere Lasten, wie beispielsweise Bauglieder übergrößer Säulenstellungen, Obelisken, Kolossalstatuen usw., können nicht mit Wagen transportiert worden sein. Möglich waren solche Transporte nur mit Rollen, die – anders als Räder – eine nicht nur punktuelle Aufstandsfläche hatten. Sie mussten jeweils beim Ziehen der Last von hinten nach vorne umgesetzt werden, was den Transport, verglichen mit der Nutzung von Wagen, deutlich langsamer macht. Diese Verfahrensweise war schon im alten Orient bekannt. Schlitten können wegen der großen Auflagefläche der Kufen zwar ebenfalls sehr hohe Lasten bewältigen, durften wegen des enormen Reibwiderstands aber nur dort eingesetzt worden sein, wo der Transportweg durchgehend abschüssig war. Sie werden daher vor allem in Steinbrüchen genutzt worden sein, wo bei steilen Wegen die von der Friktion bewirkte Bremswirkung des beladenen Schlittens das Abseilen erleichterte, wie es für die Steinbrüche im Pentelikon
3.4.4 Organisation: Die ratio marmorum
Über viele Aspekte der organisatorische Seite der Logistik geben die Quellen kaum Aufschluss. So ist über die privatwirtschaftlichen Transportunternehmen fast nichts bekannt. Einigermaßen deutlich nachzeichnen lässt sich nur die ab der frühen Kaiserzeit aufgebaute staatliche Behörde, deren Aufgabe die Beschaffung und Lieferung von Marmor war: die ratio marmorum. Grundlegende Untersuchungen zur Arbeitsweise dieser Behörde hat John Ward-Perkins vorgelegt.129 Dadurch angestoßen, sind eine ganze Reihe von weiteren Forschungen erschienen, die die Ergebnisse von Ward-Perkins erweitert, aber nur in wenigen Aspekten modifiziert haben, so dass hier auf die Kernaussagen seiner Studien mit einigen Ergänzungen zurückgegriffen werden kann.130
Die ratio marmorum war eine zentrale kaiserliche Beschaffungsstelle für Marmor, die wohl 17 n. Chr. unter Tiberius
Primäres Ziel der Einrichtung der Behörde war sehr wahrscheinlich, die kontinuierliche Belieferung der kaiserlichen Bauprojekte mit Marmor sicherzustellen. Daraus lässt sich folgern, dass es bei der älteren Organisationsform mit Aufträgen an Privatunternehmer und einzelnen, direkt staatlich organisierten Beschaffungsaufträgen zu Friktionen für den Baufortschritt in Rom
Die Behörde hatte einen Beamten mit Dienstsitz in Rom
Die Behörde war keine reine Verwaltungsorganisation, sondern verfügte auch über technisches Personal. Diese Fachkräfte vor Ort, die mit den Eigenschaften des im jeweiligen Steinbruch abgebauten Materials vertraut waren, sind teilweise auch projektbezogen an Baustellen der Besteller abgeordnet worden. Die von den Severern wegen ihrer Herkunft besonders geförderte Stadt Leptis Magna
Ein wichtiger Aspekt der ratio marmorum ist, dass sie maßgeblich an der Rationalisierung der Marmorversorgung durch Standardisierung beteiligt war.136 Dadurch konnte die Kommunikation reduziert und die Abarbeitung individueller Bestellmaße vermieden werden. Der Effekt war, dass einerseits die Produktion auf Vorrat ermöglicht wurde (Vorräte wurden auch auf Stapelplätzen, etwa in Ostia, gelagert), und zudem die Lieferzeiten nachhaltig verkürzt werden konnten. Standardisierte Bauglieder, meist schon in den Steinbrüchen vorgefertigt, waren in verschiedenen Größenklassen lieferbar.
3.5 Materialwissen
3.5.1 Holz
Zwar waren reine Holzkonstruktionen sicher zu allen Zeiten recht selten, doch zählen dazu einige Bauten, die zeigen, dass die Römer den Holzbau auch in großem Maßstab beherrschten. Ein Beispiel dafür waren die Theaterbauten, die Tausende von Zuschauern aufnehmen konnten (Abb. 3.19). Sie wurden in der Zeit der Republik aus politischen Gründen aus Holz errichtet, als temporäre Bauten, da der Senat keine dauerhaften Stätten der bloßen Unterhaltung des Volks tolerierte. Erst 55 v. Chr. setzte Pompeius
Dauerhaft große Bedeutung hatte Holz hingegen beim Bau von Brücken.139 Zentrales Material der Baukonstruktion war Holz des weiteren beim Fachwerkbau, einer Skelettbauweise, bei der fast alle tragenden Elemente oberhalb der Fundamente aus Holz hergestellt wurden. Auf diese Bautechnik, die vor allem im stadtrömischen Wohnungsbau bis zum Beginn der Kaiserzeit dominant war, wird im folgenden Abschnitt eingegangen.
Auch wenn Holz bei den anderen Bautechniken nicht als primärer Baustoff diente, so konnte doch kaum ein Bau, und sicher keine Baustelle, ohne Holz auskommen. Holz war der übliche Werkstoff für die meisten Decken und Dachstühle, da es preiswerter war als die Konstruktion von Gewölben, und wurde beim Innenausbau der Rohbauten für Treppen, Türen, Fensterläden, Balkone und Galerien verwendet. In Sonderfällen, beim Bauen auf nicht hinreichend belastbarem Baugrund, diente Holz zudem der Fundamentierung, indem in den Baugrund Holzpfähle eingerammt wurden, auf denen die Stein- oder Betonfundamente aufsetzen. Auf der Baustelle schließlich waren die Werkzeuge und Maschinen, die Wagen, Kräne, Leitern und Baugerüste größtenteils aus Holz gefertigt.
Die Versorgung mit Bauholz war für Rom
Bewaldet waren vor allem die bergigen Regionen der italischen Halbinsel, da die Ebenen landwirtschaftlich genutzt wurden, was auch für das römische Umland galt. Für die Nutzholzgewinnung bestanden hier jedoch Einschränkungen, da einige der Wälder den Göttern geweiht, und damit dem Holzeinschlag entzogen waren.142 Zudem waren bereits in augusteischer Zeit einige Waldgebiete, die hochwertige Qualitäten liefern konnten, und zugleich verkehrsgünstig auf dem Wasserweg erreichbar waren, durch übermäßigen Einschlag für das stadtrömische Bauwesen nicht mehr lieferfähig, wie das ehemals für sein Schiffbauholz berühmte Pisa.143 Die Versorgung mit Bauholz war daher letztlich ein Kompromiss zwischen den zu fordernden Eigenschaften des Holzes und den (Transport-) Kosten. Entsprechend beklagt Vitruv
Da Holz in der Antike ein in sehr vielen Bereichen genutzter Werkstoff war, gab es über die Eigenschaften der verschiedenen Holzarten eine umfangreiche Literatur. Der ältere Plinius hatte in seiner naturalis histora dem Thema nicht weniger als sechs Bücher gewidmet,145 und konnte dabei auf die ebenfalls umfassenden, etwa vierhundert Jahre älteren Arbeiten des griechischen Autors Theophrast
Was Vitruv
3.5.2 Fachwerk: Holz, Lehm und Stein
Das mehrgeschossige Mietshaus mit Fachwerk in Verbindung zu bringen, ist keineswegs evident. Die erhaltenen Reste von mehrgeschossigen Mietshäusern stehen hauptsächlich in Ostia
Die Existenz mehrgeschossiger, sogar sehr hoher Wohnhäuser in Rom
Die Konstruktion dieser mehrgeschossisgen Wohnhäuser war allerdings offensichtlich problematisch. Strabon
Die Frage ist demnach, in welcher Bautechnik in Rom
Augustus Fuß, das mehrgeschossige Bauten in Lehmziegeltechnik faktisch verbot, denn bei einer solchen Wandstärke hätte man in Lehmziegeltechnik allenfalls Häuser mit zwei Geschossen bauen können.162
Fuß, das mehrgeschossige Bauten in Lehmziegeltechnik faktisch verbot, denn bei einer solchen Wandstärke hätte man in Lehmziegeltechnik allenfalls Häuser mit zwei Geschossen bauen können.162
Es bleibt m. E. nur, dass die frühen Hochhäuser mindestens zu großen Teilen, d. h. über einem Sockelgeschoss aus Stein, in Fachwerktechnik errichtet worden sind: Fachwerk lässt bei relativ geringen Wandstärken vergleichsweise große Bauhöhen zu, ist bei solchen Höhen und mangelhafter Ausführung stark einsturzgefährdet, und zudem hochgradig brandgefährdet, entspricht damit also den Aussagen in den Quellen über die mehrgeschossigen Mietshäuser. Da Fachwerk mit Lehmstroh oder Lehmziegeln ausgefacht wurde, und von außen auch mit Lehm verputzt wurde, war der Lehm, und nicht die tragende Holzkonstruktion, bestimmend für den optischen Eindruck solcher Häuser, so dass auch der Satz des Augustus

Abb. 3.3: sog. ‚house of the opus craticium‘, Herculaneum
Bei dem hier angesprochenen Gebäude wurde kein Lehm für die Ausfachung benutzt. Es gibt jedoch einen Anhaltspunkt dafür, dass das dennoch in Rom
Zwischen abgebildeten Haus aus Herculaneum
War also eine mangelnde Beherrschung der Fachwerktechnik die Ursache der Einstürze der frühen römischen Mietshäuser? Bei der Konstruktion wie in Herculaneum
Wenn die hier dargelegte Argumentation zutrifft, dann war die in nachaugusteischer Zeit einsetzende Massenproduktion von Backstein nicht die bautechnische Voraussetzung für den mehrgeschossigen Wohnhausbau, wie man ihn heute v. a. aus Ostia
3.5.3 Lehm: Luftgetrocknete Ziegel und Stampflehm
Die Römer haben das Bauen mit Lehmziegeln (den oben angesprochenenlateres) nicht erfunden – es ist praktisch so alt wie das Bauen selbst.171 Vieles haben die Römer von anderen Kulturen übernommen. In einigen Details haben sie die Bauweise ihren eigenen Bedürfnissen angepasst, und auch weiterentwickelt. Die Bedeutung des Bauens mit Lehmziegeln für die Römer zeigt sich schon daran, dass sich bei Vitruv
Ausgangsmaterial für die Herstellung der Ziegel ist Lehm. Lehm ist eine Mischung aus Sand, Ton und Schluff. Vitruv
Für die Verarbeitung des Materials am Bau kamen zwei Techniken infrage: als Stampflehm, der heute oft Pisé genannt wird, oder als in Rahmen gestrichene Lehmziegel. Beide setzen auf der Baustelle einen Steinsockel voraus (jedenfalls im europäischen Klima), da Lehm bei dauerhafter Bodenfeuchtigkeit seine Form verliert, so dass Mauern ohne Steinsockel absacken würden. Beim Pisé wird der Lehm auf der Sockelmauer schichtweise in stabile Holzschalen eingebracht, und dort durch Stampfen verdichtet, wobei Wasser austritt. Diese Bauweise ist sicherlich in den südöstlichen Provinzen des Reiches praktiziert worden, jedoch archäologisch kaum nachweisbar und bei Vitruv Fuß.176 Die Ziegel wurden auf der Baustelle mit nassem Lehm bestrichen versetzt, und anschließend außen meist mit einem Kalkputz überzogen, der sie auf Außenwänden gegen Schlagregen schützte und innen eine Dekoration der Wände ermöglichte.
Fuß.176 Die Ziegel wurden auf der Baustelle mit nassem Lehm bestrichen versetzt, und anschließend außen meist mit einem Kalkputz überzogen, der sie auf Außenwänden gegen Schlagregen schützte und innen eine Dekoration der Wände ermöglichte.
Um die angesprochenen Probleme der Trocknung zu vermeiden, fordert Vitruv
Interessant bei Vitruv Fuß aufzumauern, und zwar so, dass sich ein vorkragendes Gesims ergibt.179 Dadurch ist die Oberkante der Lehmziegelmauer auch dann geschützt, wenn einzelne Dachziegel fehlen, und zudem die Außenseite der Mauer in gewissem Umfang gegen Schlagregen. Zugleich ergibt sich so ein stabiles und trockenes Lager für die Dachsparren in der Form eines Ringankers. Ob die von Vitruv beschriebene Lösung häufig angewendet wurde, lässt sich mangels Befunden allerdings nicht angeben.
Fuß aufzumauern, und zwar so, dass sich ein vorkragendes Gesims ergibt.179 Dadurch ist die Oberkante der Lehmziegelmauer auch dann geschützt, wenn einzelne Dachziegel fehlen, und zudem die Außenseite der Mauer in gewissem Umfang gegen Schlagregen. Zugleich ergibt sich so ein stabiles und trockenes Lager für die Dachsparren in der Form eines Ringankers. Ob die von Vitruv beschriebene Lösung häufig angewendet wurde, lässt sich mangels Befunden allerdings nicht angeben.
Argumente, wie sie Vitruv
3.5.4 Naturstein
Jenseits der farbigen Marmore und Granite, wegen derer spätere Epochen die römischen Monumente jahrhundertelang geplündert haben, brauchten aber auch die Römer primär Gesteine, die von ihren Eigenschaften her für das Bauwesen geeignet waren und in ausreichender Menge kostengünstig beschafft werden konnten. In diesem Sinne bildeten sieben verschiedene vulkanische Tuffgesteine und der Travertin im Wortsinne die Basis der Architektur Rom
Die Tuffgesteine, die die Römer im Bauwesen zunächst verwendeten, waren naheliegenderweise die Steine, die sie auf dem Gebiet der Stadt selbst brechen konnten. Dazu gehört der Cappellacio, der am Quirinal und am Fuß des capitolinischen Hügels anstand: leicht zu bearbeiten, aber nicht sehr fest. Bereits im 5. Jh. v. Chr. endet der Abbau, denn im Zuge der frühen Expansion erhielten die Baumeister Zugriff auf Steinbrüche in Südetrurien
Vitruv
Da sich unter den Tuffgesteinen keine wirklich harte Variante finden ließ, brauchten die Architekten zumindest ein anderes Gestein, das sie für hochbelastete Bereiche verwenden konnten. Der Stein ihrer Wahl war der Travertin, der nach seinen Vorkommen bei Tivoli
3.5.5 Marmor
Marmor galt in der östlichen Mittelmeerwelt ab dem 6. Jh. v. Chr. als das edelste unter den Baumaterialien. Nach Rom
Beide Überlieferungen stimmten in einem wichtigen Punkt überein: am Anfang stand nicht der Import von rohen Marmorblöcken, sondern von fertig bearbeiteten Baugliedern. Daraus kann man folgern, dass Rom
Die Römer haben sich in der Folge fast alle bekannten Marmorvorkommen der Mittelmeerwelt angeeignet. Es handelt sich um ca. einhundert Abbaustätten in Norditalien
Die wichtigsten Brüche für weißen Marmor waren die neuentdeckten Vorkommen bei Luna
Die wichtigsten Bundmarmorarten waren (mit den modernen Namen):
pavonazzetto aus Docimium
giallo antico aus Smitthus
cipollino aus Karystos
rosso antico vom Cap Tainaros
fior di pesco aus Chalkis
portasanta aus Chios
verde antico aus Thessalien
Hinzukamen im Laufe der Zeit als weitere hochwertige Importgesteine Prophyr aus Sparta
3.5.6 Gebrannte Ziegel
Gebrannte Ziegel (Backsteine) sind eines der bekanntesten Baumaterialien der römischen Antike.196 Als primäres Baumaterial verwendet wurden sie, wie oben schon im Zusammenhang mit dem Fachwerk erwähnt, erst relativ spät, etwa ab dem Ende der Republik, und verstärkt ab der Regierungszeit des Tiberius
Zur Ziegelherstellung197 brauchte man nur wenige Materialien, die in Italien
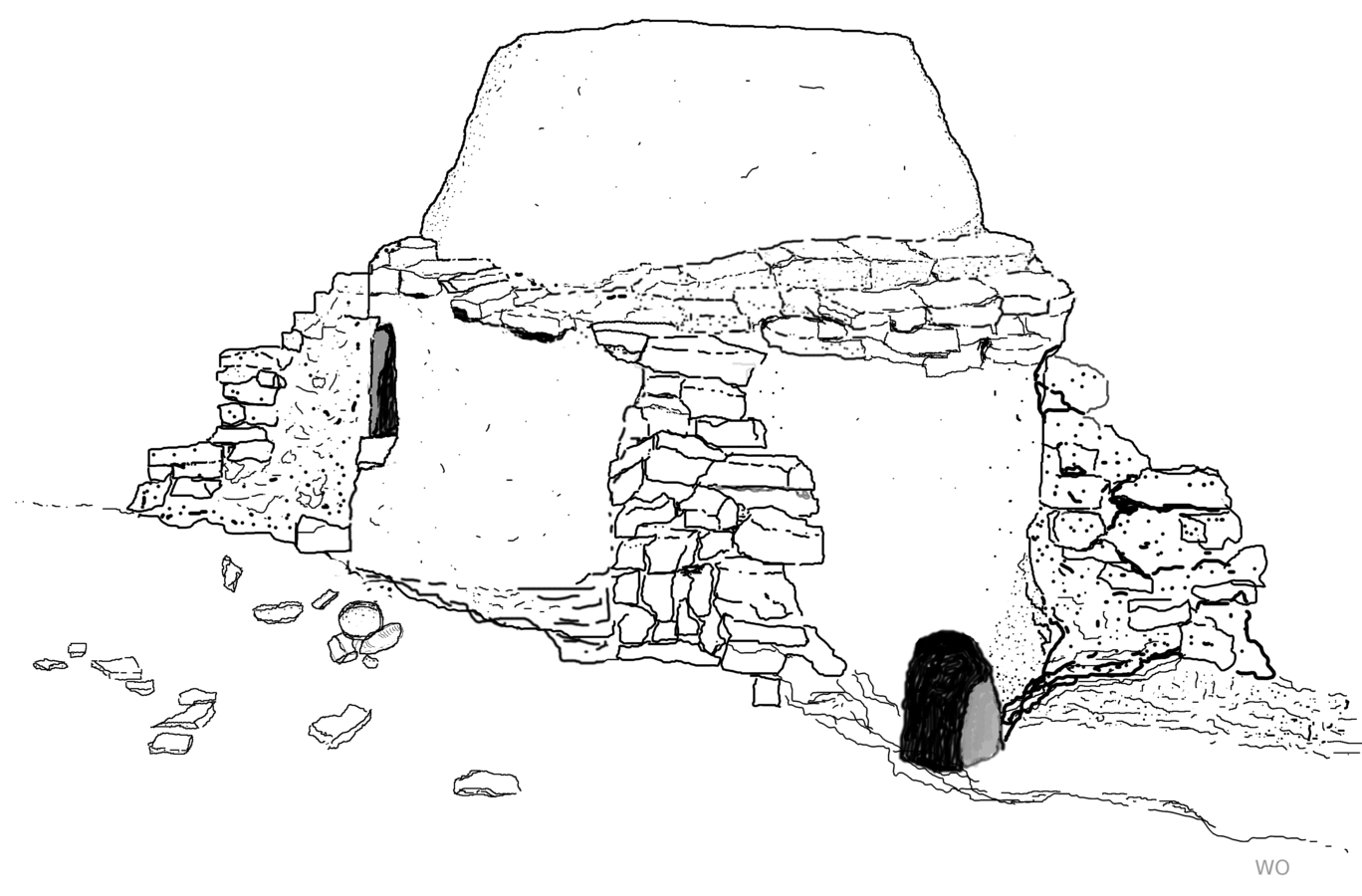
Abb. 3.4: Syrischer Töpferofen vom Typus der antiken römischen Ziegelöfen (W. Osthues).
Solche Öfen erreichten die erforderlichen Brenntemperaturen von etwa 600 bis 1000°, die für die Herstellung von hochwertigen – festen und frostsicheren – Ziegeln erforderlich waren. Die in nahezu allen Teilen des Imperiums gefundenen Brennöfen sind in etwa ähnlich aufgebaut wie der oben abgebildete Ofen aus Syrien
Beheizt wurden die Öfen, wo verfügbar, mit Holz, jedoch kamen auch andere vegetabile Brennstoffe wie Heu, Nussschalen, Pinienzapfen und ähnliches zum Einsatz. Die Brenndauer hing von der Konstruktion des Ofens, der Qualität des Brennmaterials und der Umgebungstemperatur ab. Genaue Angaben lassen sich nicht machen. Zieht man Vergleiche heran aus Ländern, in denen heute noch ähnliche Öfen betrieben werden, so wird man von einer Brenndauer von fünf bis dreißig Stunden ausgehen können. Wegen der ungünstigen Witterungsbedingungen wurden die Öfen in Europa nicht im Winter betrieben.
Für die Beschickung wurden die Ziegel zunächst genauso wie Lehmziegel in Formen gestrichen, so dass neben den unterschiedlichen Standardabmessungen auch spezielle Formziegel hergestellt werden konnten, wie man sie von Hypokausten oder Ziegelsäulen kennt. Einziger Unterschied zur Herstellung von Lehmziegeln war, dass zur Magerung der zu brennenden Ziegel keine vegetabilen Stoffe eingesetzt werden konnten, da diese im Ofen verbrennen würden. Die Formziegel wurden zunächst an der Luft getrocknet, und anschließend in der Brennkammer auf Lücke geschichtet, damit die Rauchgase sie gleichmäßig umfließen konnten. Für die Entnahme des Brenngutes wurde die Brennkammer nach dem Brand geöffnet. Vor einem erneuten Brand mussten häufig Risse in der Ummauerung der Kammer durch Ausstreichen mit Lehm ausgebessert werden.
Zum Betrieb der Brennöfen liegen mittlerweile einige experimentalarchäologische Untersuchungen mit rekonstruierten Öfen vor. Ein erst vor kurzem durchgeführter Versuch mit einem nachgebauten Ofen durch Archäologen und Techniker des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe
Die Herstellung und Verwendung gebrannter Ziegel beginnt im 2. Jh. v. Chr., und zwar nicht in Rom
Für die Forschungen zur Organisation der römischen Ziegeleien gibt die römische Praxis des Stempelns der Ziegel wichtige Informationen. Die Stempel aus Holz, gelegentlich auch aus Metall, wurden vor dem Brand in die an der Luft vorgetrockneten Ziegel gedrückt. Sie sind umfassend dokumentiert202 und erforscht, so dass man heute davon ausgeht, dass nahezu alle in größerem Umfang tätigen Betriebe der römischen Antike – also alle Anlagen, die nicht nur für den Eigenbedarf des Besitzers produzierten – bekannt sind.
Die Informationen, die den Stempeln entnommen werden können, haben unterschiedlichen Umfang. Frühe Ziegelstempel geben lediglich einen Namen an, wahrscheinlich den Namen des Besitzers, auf dessen Grund die Tongruben lagen. Die meisten Informationen enthalten Stempel aus dem frühen 2. Jh. Neben dem Besitzer der Tonvorkommen wird der (leitende) Ziegelbrenner genannt, wobei jedoch nicht eindeutig zu klären ist, ob es sich um einen Unternehmer bzw. Pächter handelte oder um einen Sklaven bzw. Freigelassenen des Landbesitzers. Alternativ wurde, wenn die Ziegelei zum Heer gehörte, der Name der betreffenden Legion angegeben. Ziegelstempel verzeichnen im 2. Jh. zudem häufig eine Datierung durch die Angabe der regierenden Konsuln, so dass sie für die Forschung ein wichtiges Hilfsmittel zur Datierung von Bauten aus dieser Zeit darstellen. Bei Großprojekten ist auf den Stempeln vereinzelt auch der Name des Baus bezeichnet, für den die Ziegel hergestellt wurden.
Aus solchen Angaben ergibt sich, dass im mittelitalischen Gebiet, das insbesondere Rom
Anhand der Ziegelstempel läßt sich, beginnend schon im 2. Jh., ein Rückgang der Produktion nachweisen. Die Stempel illustrieren überdies auch einen der Gründe für diesen Rückgang. Im dritten und vierten Jahrhundert findet man nämlich zunehmend in Neubauten Ziegel, die, wie die Stempel beweisen, weit älter sind als die Bauten selbst. Das gilt im 4. Jh. sogar für öffentliche Bauprojekte. Mit anderen Worten: Es gab ein Recycling von Ziegeln, und zwar in einem so großen Umfang, dass die Neuproduktion massiv eingeschränkt wurde – eines der vielen Zeichen für die krisenhafte Entwicklung des Imperiums. Die Ziegelproduktion endet im Westen mit dem Untergang des römischen Imperiums. Im Osten wurde sie fortgeführt bis zum Untergang des byzantinischen Reiches.
3.5.7 Bautechniken mit Bindemitteln – die Verwendung von Mörtel und Beton
Eine besondere Rolle spielt der Mörtel auch bei den einfachen Mauern. Römische Ziegelmauern beispielsweise, die äußerlich nahezu genauso aussehen wie Ziegelmauern der Neuzeit (Abb. 3.13), haben meist eine andere Struktur: Die Ziegel sind in der Regel nicht wie später durchgeschichtet, sondern die Mauern bestehen in der Regel aus zwei Schalen, die einen Gusskern aus Bruchstein und Mörtel enthalten. Entsprechend ist die Funktion der Ziegel im Sinne der Statik eine andere als bei neuzeitlichen Ziegelmauern: Die Ziegel dienen in Rom
Auf Basis des römischen Mörtels ergaben sich schließlich nicht nur neue bautechnische Möglichkeiten, sondern auch bedeutende Vorteile in anderer Hinsicht. Durch die Verwendung von Guss- und Ziegelmauerwerk emanzipierte sich der römische Baubetrieb zu einem erheblichen Teil von der Abhängigkeit von fachlich qualifizierten Handwerkern. Zwar blieb in allen Abschnitten des Bauprozesses, angefangen vom Kalkbrand bis hin zum Versatz der Steine am Bauwerk, know-how erforderlich, doch konnte der römische Baubetrieb, jedenfalls wenn man ihn mit der griechischen Werksteintechnik vergleicht, mit weitaus weniger qualifizierten Handwerkern auskommen, weil ein Großteil der insgesamt notwendigen Arbeiten, wie etwa das Mischen, Einbringen und Stampfen der Gussmasse, von ungelernten Hilfskräften übernommen werden konnte. Hierin dürfte einer der wesentlichen Gründe dafür liegen, dass römische Großprojekte nahezu immer fertiggestellt worden sind, während in Griechenland eine nennenswerte Zahl gerade der ambitioniertesten Projekte niemals vollendet wurden.205
Die Forschung hat die konstitutive Bedeutung der Bindemittel für die Entwicklung der römischen Architektur seit langem erkannt. Aber erst durch neuere chemische und bautechnische Analyseverfahren in den letzten rund dreißig Jahren ist eine differenzierte Untersuchung der von den Römern verwendeten Materialmischungen und ihrer Eigenschaften möglich geworden. Den praktischen Anstoß für viele dieser Untersuchungen gaben Probleme bei der Sicherung und Restaurierung der erhaltenen Monumente. Insbesondere ältere Restaurierungen, bei denen Materialien aus dem modernen Baubetrieb verwendet wurden, haben zu teilweise schwerwiegenden Schädigungen der antiken Bausubstanz geführt, die auf die Inkompatibilität der modernen mit den antiken Materialien zurückzuführen sind. Das gilt vor allem für die Verwendung von Portlandzement und die Verwendung der heute sehr hart gebrannten und kaum diffusionsoffenen Ziegel. Daher stehen am Beginn praktisch aller umfangreichen Restaurierungen, die gegenwärtig durchgeführt werden, die Analysen der am antiken Gebäude verwendeten Baustoffe. Die Ergebnisse der Materialanalysen insbesondere zu römischen Mörteln und Beton, die inzwischen in sehr große Zahl vorliegen, ausführlich darzustellen, würde den hier gegebenen Rahmen bei weitem überschreiten. Die folgenden Abschnitte haben daher nur das Ziel, die Entwicklungen der römischen Bautechnik in diesem Bereich in etwa zu umreißen.
Mörtel wurde von den Römern einheitlich mortarium genannt. Dahinter verbergen sich jedoch nach Herstellung, Eigenschaften und Verwendung unterschiedliche Materialien, die die besten der römischen Baumeister auf Basis offenbar genauer Kenntnisse nach Funktion differenziert einsetzten. Das wird deutlich, wenn man die heute üblichen Mörtelgruppen den antiken Materialien gegenüberstellt. Heutige Mauermörtel besteht im Grundsatz aus einem Bindemittel auf Kalkbasis, der sog. Gesteinskörnung (in der Regel Sand), Wasser und ggfs. speziellen Zuschlagstoffen. Grundsätzlich unterscheidet man, primär nach der Druckfestigkeit, folgende Mörtelarten:
1Reiner Kalkmörtel. Er besteht aus gelöschtem Kalk, Sand und Wasser. Reiner Kalkmörtel härtet an der Luft aus, indem er Kohlendioxid aus der Luft aufnimmt (daher auch Luftkalk genannt). Reiner Kalkmörtel kann entsprechend nicht unter Wasser aushärten. Der Abbindevorgang – die Karbonatisierung durch das Kohlendioxid aus der Luft – dauert sehr lange, und kann vollständig erst nach Jahren abgeschlossen sein. Kalkmörtel ist vergleichsweise wenig druckfest (ca. 1N/mm²), und ist daher heute nur zugelassen für Gebäude mit maximal zwei Stockwerken. Da der Mörtel gut feuchtigkeitsregulierend ist, wird er meist für Innenputze verwendet.
2Kalkzementmörtel und hydraulische Mörtel. Kalkzementmörtel besteht, wie der Name sagt, aus Kalkmörtel, dem Zement beigemischt wird. Kalkzementmörtel gehören zu den hydraulischen Mörteln. Zu ihnen gehören weiter Mörtel ohne Zementanteil, die aus ,natürlichem hydraulischem Kalk‘ hergestellt werden (NHL, auch Wasserkalk genannt). Sie werden entweder aus Mergelkalk oder Muschelkalk gebrannt, oder dadurch, dass auf der Baustelle reiner Kalkmörtel mit Zusätzen wie Trass gemischt wird, die aus dem nicht-hydraulischen Kalkmörtel einen hydraulischen Mörtel machen. Bei allen drei Typen ist der Abbindevorgang chemisch komplexer als bei einfachem Kalkmörtel: Zunächst erfolgt die Karbonatisierung wie beim Luftkalk, zusätzlich aber noch eine Erhärtung durch die Verbindung des Kalziums im Kalk mit den sog. Hydraulefaktoren [Kieselsäure (SiO2), Tonerde (Al2O3), Eisenoxid (Fe2O3)], die im Zement, im natürlich hydraulischen Kalk und in Zuschlagstoffen wie Trass zusätzlich enthalten sind. Bei dieser Reaktion bilden sich stabile Kristalle, die die Härte des Endprodukts erhöhen und die Wasserundurchlässigkeit bewirken. Die Druckfestigkeit ist deutlich höher als bei reinen Kalkmörteln. Sie liegt je nach Zementanteil bzw. der Menge der in den Zuschlagstoffen enthaltenen Hydraulefaktoren zwischen 2,5 und 5 N/mm2.
3Zementmörtel. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser. Der bekannte Portlandzement wird aus Kalziumsilicat, Ton, Sand und Eisenerz hergestellt. Zement ist ebenfalls ein hydraulisches Bindemittel. Der prinzipielle Unterschied zum eben angesprochenen hydraulischen Kalkmörtel ist, dass Zementmörtel allein durch die Hydration (wie oben beschrieben) abbindet, also kein Kohlendioxid aus Luft aufnimmt. Zementmörtel erhärtet daher auch unter Wasser, dichtet, und hat mit mindestens 20 N/mm2 die höchste Druckfestigkeit der hier genannten Mörtel. Zementmörtel, dem grobe Gesteinskörnung (meist Kies) beigefügt wird, wird als Beton bezeichnet. Da Beton, wie auch die beschriebenen Mörtel, kaum Zugkräfte aufnehmen kann, wird Beton häufig bewehrt, in dem Armierungen aus Eisen eingegossen werden.
Die römischen Mörtelarten sind den modernen von ihren Eigenschaften und der Einteilung her gesehen vergleichbar. Der heutige reine Kalkmörtel bzw. Luftkalk ist, chemisch gesehen, nahezu identisch mit seinem antiken Pendant.
Ausgangsmaterial für die Herstellung war meist Kalkstein. Vitruv
Chemisch gesehen, wird durch den Brennvorgang der Kalkstein (CaCO3) entsäuert, indem das Kohlendioxid entweicht. Zurück bleibt pulverförmiger Brandkalk bzw. Kalziumoxid (CaCO3 = CaO + CO2). Der Brandkalk wurde anschließend in Gruben für mehrere Wochen (oder länger) in der Nähe der Baustelle eingesumpft. Durch dieses sog. Kalklöschen verbindet sich der Brandkalk mit dem Wasser zu Kalziumhydroxid [CaO + H2O = Ca(OH)2]. War der Prozess abgeschlossen, wurde der Löschkalk direkt verarbeitet. Geringere Mengen – etwa für das Kälken von Wänden – wurde auch in Amphoren zur Baustelle transportiert. Löschen mit der exakt erforderlichen Wassermenge, so dass der Löschkalk in Pulverform vorliegt (heute als Weißkalkhydrat bezeichnet), ist aus der Antike nicht bekannt. Wenn zur Verarbeitung auf der Baustelle der Löschkalk mit Sand zu Mörtel vermengt und vermauert wird, bindet der Löschkalk wie angesprochen ab durch Aufnahme von Kohlendioxid aus der Umgebungsluft. Damit vollendet sich der sog. technische Kalksteinkreislauf, denn die Verbindung bewirkt, dass aus dem Löschkalk und dem Kohlendioxid sich ein Kunststein bzw. ein künstlicher Kalkstein bildet, der chemisch identisch ist mit dem Ausgangsprodukt, wobei Wasser zurückbleibt: Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O.
An der ablaufenden Reaktion ist der Sand nicht beteiligt, er wird vielmehr von dem Bindemittel eingebunden und sorgt für die Druckstabilität des Mörtels. Für eine Verarbeitung als Gussmasse wie bei Beton ist ein ein solcher Mörtel nicht geeignet, jedenfalls wenn Druckfestigkeit gefordert wird, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen ist die Druckfestigkeit des Mörtels, wie schon angesprochen, per se nicht sehr hoch. Zum anderen verhindert bei großen Gussmengen die Aushärtung an den Oberflächen des Mörtels die Karbonatisierung im Inneren wegen des Luftabschlusses. Ein Gebäude wie das Kolosseum mit seinen enormen Massen hätte man mit einem Mörtel dieser Art nicht bauen können. Dasselbe gilt für Wasserbauten, da der Mörtel im Wasser kein Kohlendioxid aufnehmen kann.
Die Römer kannten neben dem Luftkalkmörtel auch härtere, hydraulische Mörtel, die man von den Eigenschaften her mit den modernen hydraulischen Kalkzement- und dem Zementmörteln vergleichen kann. Sie konnten die entsprechenden Bindemittel jedoch nicht direkt herstellen, d. h. durch Brennen von Materialgemischen, die neben dem Kalkstein Substanzen mit Hydraulefaktoren enthalten, wie das heute beim Brennen von natürlichem hydraulischen Kalk und Zement der Fall ist, denn die für Zement erforderlichen Brenntemperaturen von über 1400° waren mit der antiken Brenntechnik nicht zu erreichen. Selbst die für den Bronzeguss eingesetzten Öfen erreichten wenig mehr als die dort notwendigen rund 1200°. Die Römer gingen einen anderen Weg: Sie brannten in einem ersten Schritt immer möglichst reinen Brandkalk, der anschließend gelöscht wurde. In einem zweiten Schritt wurden auf der Baustelle unterschiedliche Zuschlagstoffe hinzugefügt, die dem Mörtel hydraulische Eigenschaften verliehen.
Einen solchen Mörtel, ähnlich dem modernen hydraulischen Kalkmörtel, der durch Karbonisierung und Kristallverbindungen zwischen Kalk und Hydraulefaktoren erhärtet, gewannen die Römer, indem sie dem gelöschten Kalk Ziegelmehl beimischten. Ziegelmehl ist ein künstliches Puzzolan (siehe dazu unten), das durch den Tonanteil der Ziegel ähnliche Stoffe enthält wie der heute beim Brand von Zement zugesetzte Ton. Durch das Mischungsverhältnis konnte dieser hydraulische Mörtel sogar ,eingestellt‘ werden, wie bei heutigen hydraulischen Mörteln durch Zugabe von Zement. Vitruv

Abb. 3.5: Kaiserzeitliches Wasserbecken in Kameiros auf Rhodos
Auch Außenputzen, die Schlagregen ausgesetzt waren, wurde Ziegelmehl beigemischt, was die Witterungsbeständigkeit des Putzes nachhaltig erhöht. Ziegelmehl wurde zudem sehr häufig beim Mauerbau verwendet, weil das zugesetzte Mehl die Druckfestigkeit des Mörtels, verglichen mit reinem Luftkalk-Mörtel, verbessert. Für diesen Gewinn an Festigkeit nahm man die höheren Kosten offenbar in Kauf, da die Herstellung des Ziegelmehls wesentlich aufwendiger und teurer in der Beschaffung war als Bausand. Mörtel mit Ziegelmehl als Zuschlagstoff erreicht allerdings nicht die Festigkeit von römischem Beton, von dem anschließend die Rede sein wird. Dass man dennoch in vielen Regionen auch bei großen Bauten mit Ziegelmehl statt mit Puzzolana arbeitete, dürfte einfach daran liegen, dass Ziegelmehl praktisch überall im römischen Reich herstellbar war, wohingegen Puzzolanerde gegebenenfalls über große Strecken von den italischen Abbaustätten antransportiert werden musste.
Ein dem Zementmörtel vergleichbarer Baustoff stand den Römern ebenfalls zur Verfügung.209 Dazu wurde dem Löschkalk anstelle des sonst verwendeten Sandes mit der angesprochenen Puzzolanerde vermischt. Die Puzzolanerde (pulvis puteolanus) ist ein je nach Lagerstätte gelb-brauner oder rötlich-brauner Lavasand. Abgebaut wurde sie, wie der Name schon besagt, in großem Umfang in
Puteoli bei Neapel

Abb. 3.6: Sog. ‚Pont del Diable‘, Aquaedukt bei Tarragona
Die chemische, Reaktion, auf der die Erhärtung des Puzzolanmörtels beruht, ist der des Zementmörtels vergleichbar. Puzzolane enthalten lösliche Kieselsäuren und reaktionsfähige Aluminiumnoxide (die erwähnten Hydraulefaktoren), die sich mit dem Kalziumhydroxid des gelöschten Kalks zu kristallförmigen Calciumsilicathydraten und Calciumaluminathydraten verbinden. Der Unterschied liegt darin, dass beim Zement die im Ausgangsmaterial enthaltenen Kieselsäuren und Aluminiumnoxide erst in eine lösliche, reaktionsfähige Form gebracht werden müssen, um sich mit dem Kalk zu verbinden. Das geschieht durch den Brand im Zementofen bei ca. 1400°. Diese thermische Umformung kann bei der Puzzolanerde entfallen, weil die Hitze im Erdinneren die Umformung bereits vollzogen hat. Salopp gesagt, hatte den Römern der Vulkan bereits einen wesentlichen Teil der Arbeit abgenommen. Puzzolanerde war ohne weitere Aufbereitung am Bau verwendbar.
Praktisch wurde der Unterschied zwischen der Karbonatisierung des Luftkalks und der puzzolanischen Reaktion dadurch evident, dass Puzzolanmörtel auch unter Wasser aushärtet, d. h. unter Luftabschluss bzw. ohne Kohlendioxid aus der Luft. Dadurch unterscheidet sich der Puzzolanmörtel zugleich von den zuvor beschriebenen hydraulischen Mörteln mit Ziegelmehlzuschlag. Letztere müssen, da sie neben der puzzolanischen Reaktion auch durch Karbonatisierung abbinden, erst im Trockenen erhärten, bevor sie wasserdicht werden. Mörtel mit Ziegelmehl-Zuschlag war also nur für im Trockenen errichtete Wasserbauten geeignet. Ein zweiter Unterschied liegt bei der Druckfestigkeit: der Puzzolanmörtel übertrifft den Mörtel mit Ziegelmehl hinsichtlich der Druckfestigkeit ebenso deutlich wie der moderne Zementmörtel die heutigen hydraulischen Mörtel.
Verarbeitet wurde der Puzzolanmörtel in der Regel nicht als Mauermörtel, sondern als Beton, von den Römern opus caementitium genannt. Hinsichtlich der Verarbeitung gab es eine Reihe von Unterschieden zwischen modernem Betonbau und dem römischen opus caementitium: Während man heute vor dem Gießen Holzverschalungen baut, die nach dem Einfüllen und Abbinden des Beton abgenommen werden, errichteten die Römer zwei Schalmauern aus Naturstein oder Ziegeln, in die die Masse eingefüllt wurde. Sie diente nach Fertigstellung als dauerhafte Verblendung, und wurde häufig noch zusätzlich verputzt. Schalmauern und Gussmasse wurden schichtweise bzw. parallel hochgezogen. Holzverschalungen benutzten die Römer in der Regel nur bei Gewölben und bei im Wasser gegründeten Betonkonstruktionen. Auch bei der Gussmasse selbst gibt es Unterschiede: Während heute als Gesteinskörnung Kies mit einer Korngröße von 4–8 cm zugegeben wird, verwendeten die Römer etwa faustgroße Bruchsteine. Diese Steine waren die namensgebenden caementitia. Der Begriff meinte in der Antike also nicht das Bindemittel, wie der moderne Begriff ‚Zement‘ nahelegt, sondern den Zuschlagstoff. Auch die zugegebene Wassermenge ist ungleich. Während heute die Gussmasse wegen des Transports und der Verarbeitung am Ort mit Hilfe von Betonpumpen relativ dünnflüssig ist, war das opus caementitium bei der Verarbeitung eher teigig.210 Zudem wurde die Masse bei den Römern nach dem Einbringen schichtweise durch Stampfen verdichtet. Bei der modernen Betonverarbeitung entfällt dieser Arbeitsschritt. Einige Forscher sehen in diesen beiden Verfahrensweisen – dem relativ geringen Wassergehalt der Gussmasse und dem Verdichten – eine der wesentlichen Ursachen dafür, dass der antike Beton dort, wo er perfekt verarbeitet worden ist, sich als enorm haltbar erwiesen hat. Vereinzelt hat man in jüngster Zeit auf Verfahrensweisen, die denen der Römer ähnlich sind, wieder zurückgegriffen.211 Des weiteren benutzten die Römer bei Betonkonstruktionen keine innenliegende Armierung wie die heute übliche Bewehrung mit Baustahl zur Erhöhung der Zugfestigkeit. Römische Baukonstruktionen mussten entsprechend so angelegt sein, dass nur geringe oder gar keine Zugspannungen auftraten. Man hat zwar gelegentlich im römischen Beton eingelegte Hölzer gefunden (Anzio, Hafenmolen), doch war die Aufgabe dieser Hölzer beim Bau im Wasser, ein Auseinanderbiegen der Wände der hölzernen Setzkästen so lange zu verhindern, bis der Beton abgebunden hatte. Nach dem Aushärten hatten die Hölzer, anders als der moderne Baustahl, also keine Funktion mehr. Von technischer Bedeutung für die Qualität der Konstruktionen und das zugrundeliegende know-how sind hingegen die im Beton eingestampften caementitia : Je nach dem spezifischen Gewicht der als caementitia verwendeten Bruchsteine, oder auch durch Einschluss leerer Tongefäße in der Gussmasse, konnte das spezifische Gewicht der Betonmasse gezielt variiert werden. Die effektive Nutzung dieser Möglichkeiten setzt Kenntnisse der Spannungen innerhalb der Konstruktion voraus, denn nur so konnte bestimmt werden, wo im Bauwerk vergleichsweise leichter oder schwerer Beton die Standsicherheit erhöhen konnte. Mehr dazu im Abschnitt über den Gewölbebau.
Ein letzter Aspekt bei der Verarbeitung von Mörteln, der neuerdings in das Blickfeld der Forschung gerückt ist, bezieht sich auf die Qualitätssicherung bei Herstellung und Verarbeitung. Nachweisbare Probleme mit der sinkenden Qualität der verwendeten Materialien sind sicher kaum Kenntnismangel geschuldet, denn sie treten ab dem 3. Jh. auf, also zu einer Zeit, als man die Technik des Betonbaus längst nahezu perfekt zu beherrschen gelernt hatte. Zurückgeführt werden diese Probleme vielmehr auf ökonomische Faktoren, die mit dem allgemeinen Niedergang der römischen Wirtschaft zusammenhängen. So wurde augenscheinlich statt frisch gebrochenem Kalkstein, der in sich homogen ist, zunehmend unterschiedliches Material von aufgelassenen Bauten ,recycelt‘, wodurch die Brenntemperatur im Ofen nicht mehr optimal auf die heterogenen Qualitäten abgestimmt werden konnte. Arbeitskräftemangel und Zeitdruck werden geltend gemacht für die Verwendung von verunreinigter oder nicht sorgfältig gesiebter Puzzolana.212 Der gleiche Grund wird auch geltend gemacht für unzureichendes Verdichten der einzelnen Betonschichten. Alle diese Faktoren führten zu einer reduzierten technische Qualität vieler Bauwerke der Spätantike.
3.6 Bautechniken
3.6.1 Fundamente und Mauern
In der Regel wurden für die Fundamente Gräben ausgehoben, in die Streifenfundamente eingebracht wurden. Rostfundamente sind sehr selten, und wurden allenfalls für wertvolle Plattenfußböden gebaut. Die Fundamente sind in der Regel Flachgründungen. Tiefgründungen mit eingerammten Holzpfählen wurden nur dort verwendet, wo der Untergrund kaum belastbar war, also in sumpfigem Terrain214 oder für den Bau von Brückenpfeilern in weichem Untergrund.215
Im Idealfall wurde für die Fundamente großer Bauten der Boden bis auf den gewachsenen Felsen aufgegraben. In großen Teilen des Imperiums war das jedoch nicht möglich, so dass der Boden in einer Tiefe ausgeschachtet wurde, die der Belastung durch das aufgehende Mauerwerks angepasst war. Für einfache Gebäude mit ein oder zwei Stockwerken beträgt die Tiefe der Fundamentgräben häufig 50–70 cm, so dass die Fundamentsole frostsicher war. Ein Unterschreiten der Frostgrenze würde bedeuten, dass der gefrierende Boden die Fundamente hochdrücken, und damit Risse verursachen könnte. Bei Betonfundamenten wurde durch die entsprechende Tiefe auch das sog. Auffrieren des Betons verhindert.
Bei der Bestimmung der Fundamenttiefe in Abhängigkeit von der Belastung durch das Mauerwerk arbeiteten die Römer, aus heutiger Sicht gesehen, eher konservativ: Fundamente großer Bauten konnten durchaus acht Meter tief sein.216 Am Jupitertempel von Balbeek
Fundamentmauern wurden so gut wie immer etwas breiter bemessen als die Mauern, die sie tragen sollten, wodurch sich der Druck des Mauerwerks bei der Fundamentsohle auf eine etwas größere Grundfläche verteilt. Entspechend hing relative Breite des Fundaments gegenüber dem Mauerwerk von der Tragfähigkeit des Bodens ab. Fundamentmauern wurden in unterschiedlicher Technik ausgeführt. Für einfache Gebäude wurden die aus dem Lehmziegelbau immer schon bekannten Bruchsteinfundemente verwendet,218 denn unmittelbar auf einem feuchten Boden aufgesetzt, zersetzen sich luftgetrocknete Lehmziegel sehr schnell. Solche Fundamente entsprechen im Querschnitt einer einfachen, zweischaligen Mauer, d. h. an den Außenseiten der Fundamente sind eher größere Steine aufgeschichtet, die dann die Schalen der aufgehenden Mauern tragen, während im Inneren die Steine geschüttet und wohl durch Stampfen verdichtet wurden. Diese Steinschüttungen waren im einfachsten Fall mit Erdreich vermischt. Bei Gebäuden mit höheren Belastungen sind die Bruchsteine in Mörtel verlegt, also in derselben Technik errichtet wie die Mauern, die sie tragen. Oft ist die Oberkante des Fundaments horizontal abgeglichen, was etwa für aufgesetzte Ziegelmauern zwingend erforderlich ist.
Alternativ zur Schalung durch aufgeschichtete Bruchsteine konnten Betonfundamente auch – genau wie heute – in Holzverschalungen eingebracht werden, die nach dem Aushärten des Betons wieder entfernt wurden (Abb. 3.7), wie etwa bei der Konstantinsbasilika oder am Tempel der Venus auf dem Palatin in Rom
Unter den belastbarsten Fundamentierungen tritt das Betonfundament die Nachfolge des durchgeschichteten Vollsteinfundaments an, das die Griechen bei ihren ambitioniertesten Projekten vorsahen. Die Römer kannten letzteres, und verwendeten es auch, aber nur selten und hauptsächlich in relativ früher Zeit.220 Die Vorteile der neuen Verfahrensweise sind offensichtlich, denn die ältere Form war extrem arbeitsaufwendig und verlangte den Einsatz von anteilig vielen qualifizierten Handwerkern, da ein mörtelloses Fundament aus großen Steinquadern, vor allem aber eines aus Platten, nur stabil ist, wenn die Lagerfugen vollflächig aufliegen. Das wiederum bedeutet, dass jede Platte nach dem Brechen (und dem Antransport) von Steinmetzen vor Ort auf der Ober- und Unterseite sorgfältig geglättet werden musste. Nicht auf ganzer Fläche tragende Platten würden unter Last brechen. Bei felsigem Untergrund – unter Belastungsgesichtspunkten an sich ideal – musste zudem für die unterste Plattenschicht der anstehende Felsen selbst erst glatt gearbeitet werden. Beim Betonfundament hingegen entfiel alle diese Bearbeitungsschritte ersatzlos, und vor allem war nahezu keine qualifizierte Handwerkerarbeit erforderlich, sondern nur ein kompetenter Bauleiter. Zudem war ein Betonfundament sehr viel schneller herzustellen.
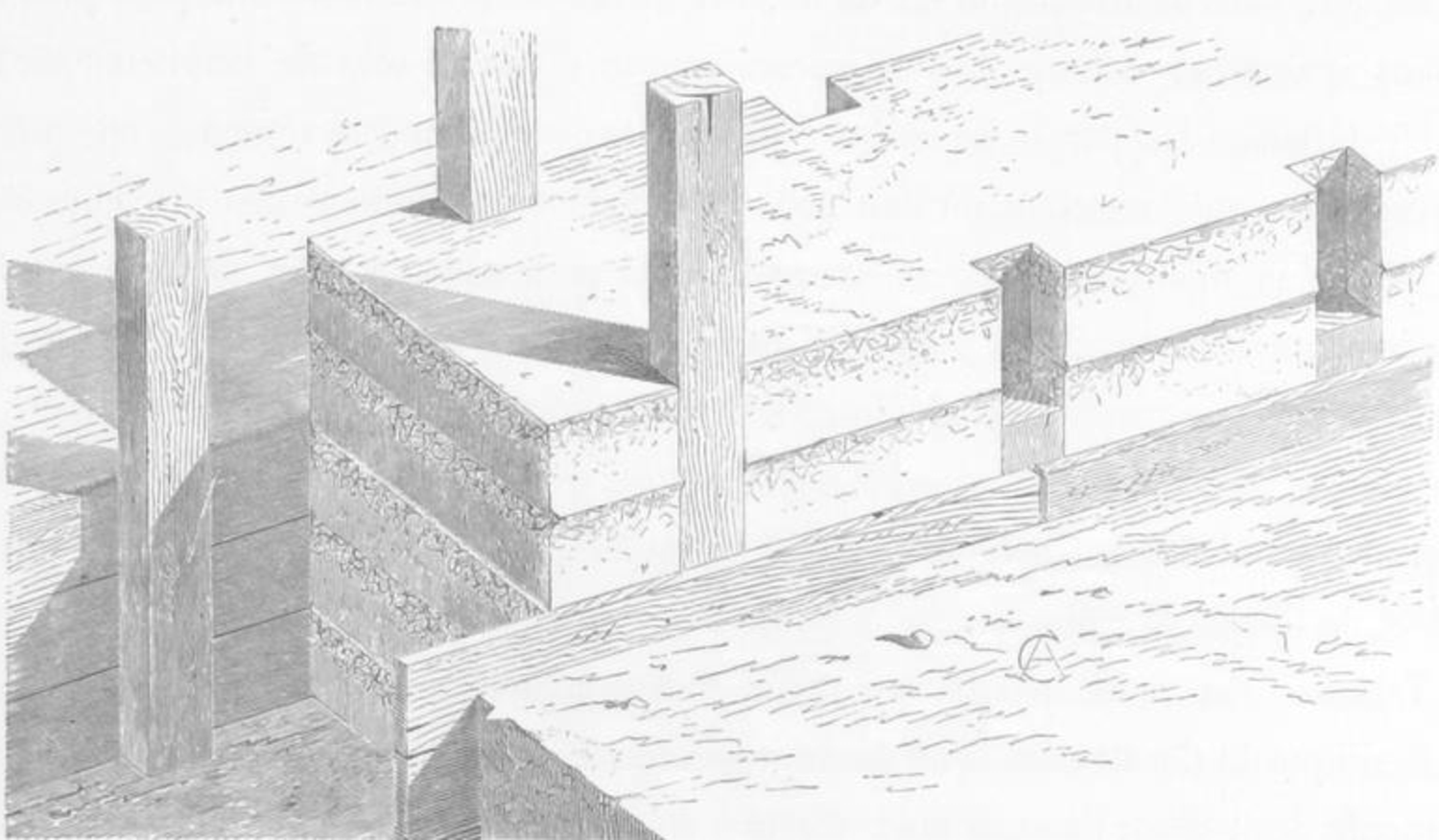
Abb. 3.7: Hölzerne Schalung für ein schichtweise eingebrachtes Betonfundament (Choisy 1873, Bd. I Fig. 2).
Fundamente zeigen einiges über Planungstiefe und Konstruktionswissen. Römische Fundamente haben häufig eine unterschiedliche Tiefe, was belegt, dass den Baumeistern vor Baubeginn klar war, wo am zu errichtenden Gebäude die höchsten Fundamentbelastungen auftreten würden. Das zeigt dann wiederum seinerseits, dass das Gebäude beim Ausheben der Fundamentgräben mindestens in seinen Hauptzügen durchgeplant gewesen sein musste, da bei Streifenfundamenten, die nur wenig breiter waren als die Mauern, die Lage der Mauern praktisch nicht mehr nachträglich geändert werden konnte (ohne neue Fundamentgräben neu zu öffnen oder die vorhandenen Fundamente nachträglich zu verbreitern). Verständnis der Belastungen zeigen gelegentlich auch Neubauten, die an der Stelle älterer Gebäude errichtet wurden: Beispielsweise plazierte man Entlastungsbögen genau dort, wo bereits ältere, ansonsten funktionslose Fundamente lagen, die auf diese Weise weiterbenutzt wurden.221
Mauern
Im Grundsatz bestanden, wie schon angesprochen, die tragende Mauern größerer römischer Gebäude meist aus zwei äußeren Mauerschalen und einem Kern aus in Mörtel verlegtem Bruchstein. Je nach der Technik, in der Schalen aufgemauert wurden, unterscheidet die Forschung verschiedene Mauerformen, auf die nachfolgend eingegangen wird.222 Obwohl diese Formen bei der Darstellung von römischem Mauerwerk in der Literatur dominieren, ist zu berücksichtigen, dass bei weitem nicht alle römischen Mauern in der angesprochenen Bauweise errichtet worden sind. So praktizierten die Römer etwa auch weiterhin für stark belastete Mauern und Pfeiler die ältere Technik des Bauens mit behauenem Natursteinen, die durchgeschichtet und ohne Mörtel versetzt wurden, also keinen Gusskern haben.223 Auch das Bauen mit luftgetrockneten Lehmziegeln ist, schon aus ökonomischen Gründen, niemals völlig aufgegeben worden.
Aber auch strukturell gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den nachfolgend beschriebenen Mauerwerksformen. So handelt es sich etwa beim opus reticulatum
Schließlich erfordert auch die Terminologie, die sich in der Forschung für die Formen des Mauerwerks etabliert hat, vorab einige Anmerkungen. Vitruv
Vorgestellt werden im folgenden nur die wichtigsten Formen des Mauerwerks. Allgemein kann gesagt werden, dass die regionale Bedeutung teilweise sehr unterschiedlich ist, worauf manche Termini auch explizit hinweisen (z. B. opus africanum). Auch kommen nicht alle Formen in allen Provinzen vor. Ähnliches gilt auch für die zeitliche Abfolge, d. h. es gibt keine allgemeingültige Abfolge der Formen, so dass sie nur bedingt Anhaltspunkte für eine Datierung von Gebäuden bieten können.
opus incertum

Abb. 3.8: Opus incertum am Unterbau des Tempels des Jupiter Anxur
Als incertum (Abb. 3.8) bezeichnet man ein Mauerwerk, bei dem die Schalen aus unbehauenen oder nur grob an der Außenseite behauenen, unregelmäßig versetzten Natursteinen – in Rom
opus reticulatum

Abb. 3.9: Opus reticulatum an Unterbau des ‚tempio republicano‘ in Ostia
Das Reticulat hat sich gegen das Incertum durchgesetzt, allerdings zunächst langsam, beginnend schon ab dem späten 2. Jh. v. Chr., bis es zu Anfang des 2. Viertels des 1. Jhs. v. Chr. vorherrschend wurde. Zur vollen Regelmäßigkeit bildet sich das Gitternetz der Fugen auch erst in dieser Zeit aus, weswegen für die frühen, weniger regelmäßigen Varianten von der Forschung der Terminus opus quasi reticulatum geprägt wurde.231 Nach dem Ende des 2. Jh. n. Chr. ist es kaum noch anzutreffen.
Gut erklären lässt sich, dass das Reticulat sich in praktisch allen Provinzen des Imperiums nachweisen lässt, denn als erste neuentwickelte, genuin römische Form des Mauerwerks konnten Städte und Heiligtümer mit in dieser Technik errichteten Bauten auf ihre romanitas verweisen. Dasselbe dürfte auch gelten für die Verwendung am Theater des Pompejus, der das erste – vom Grundtypus her griechische – Theater in Stein in Rom
opus quadratum und opus vittatum

Abb. 3.10: Opus quadratum Kalkstein, Flächen gespitzt (W. Osthues).
Obwohl opus quadratum / vittatum eine scheinbar einfache und gleichsam logische Form des Mauerwerks darstellt, und entsprechend in verschiedenen älteren Kulturen sehr häufig vorkommt, findet man es im römischen Imperium erst ab augusteischer Zeit, und in Rom
opus testaceum (opus latericium)
 , 1
, 1
 oder 2 Fuß von etwa 29,5 cm). Am Bau wurden sie häufig diagonal gebrochen vermauert, wobei die Basis der dann dreieckigen Form nach außen weist (s. Abb. 3.11) Der äußere Anschein, es handele sich um das gleiche Ziegelmauerwerk mit langrechteckigen Formaten wie in der Neuzeit in Nordeuropa üblich, täuscht daher oft den heutigen Betrachter (Abb. 3.13).
oder 2 Fuß von etwa 29,5 cm). Am Bau wurden sie häufig diagonal gebrochen vermauert, wobei die Basis der dann dreieckigen Form nach außen weist (s. Abb. 3.11) Der äußere Anschein, es handele sich um das gleiche Ziegelmauerwerk mit langrechteckigen Formaten wie in der Neuzeit in Nordeuropa üblich, täuscht daher oft den heutigen Betrachter (Abb. 3.13).
Gebrochen wurden solche Ziegel oft mit einer Säge. Es gab auch Ziegel, in die bereits vor dem Brand eine Sollbruchstelle diagonal eingeritzt war.236 Der Vorteil dieses Vorgehens war einerseits, dass sich auf diese Weise eine Verzahnung der Ziegelfassade mit dem Gusskern ergab (wie schon beim Reticulat), zudem ein geringerer Materialverbrauch, und schließlich, dass die nach außen verlegte Bruchkante einen guten Haftgrund für das Auftragen des Wandputzes abgab. Es gab aber auch unverputzte Fassaden, bei denen man zu dekorativen Zwecken Ziegel unterschiedlicher Farbe (aufgrund unterschiedlicher Materialqualität und Brenntemperatur) zu Mustern gruppierte.

Abb. 3.11: Opus testaceum, Aufbau. Leonidaion in Olympia
Der erste große, vollständig in Ziegeln verblendete Bau in Rom
Auch für das opus testaceum gilt, dass die Verbreitung innerhalb des Imperiums sehr unterschiedlich stark war, was direkt mit der Verfügbarkeit der Ausgangsmaterialien (Lehm bzw. Ton, Brennholz) zusammenhängen dürfte. Die größte Bedeutung als Baumaterial hatten die gebrannten Ziegel in Italien
opus mixtum

Abb. 3.12: Opus testaceum mixtum in Ostia
Die Art, wie die verschiedenen Materialien miteinander kombiniert wurden, deckt ein ganzen Spektrum von Varianten ab. Es reicht von Mauerschalen, bei denen die Steine in stets abwechselnden Reihen verlegt sind, also etwa eine Lage Ziegel, eine Lage Tuff- oder Kalksteinquader, wie vor allem in Kampanien
Opus mixtum findet man früh – noch in vorrömischer Zeit – in den Vesuvstädten, und nachfolgend in allen Perioden des Imperiums (und auch danach sehr häufig in byzantinischer Zeit). Die Bauweise verbreitete sich im Laufe der Zeit über praktisch alle Provinzen des römischen Reiches.
Angesichts der erheblichen konstruktiven Unterschiede (Wechsel nur innerhalb der Schalung vs. Ziegeldurchschuss) ist evident, dass es keine einheitliche technische Erklärung für die Verwendung von opus mixtum geben kann. Die Variante mit durchbindenden Ziegellagen dürfte sicher angewandt worden sein, um Schalen und Mauern stabil mit einander zu verbinden. Das war vor allem dann wichtig, wenn der Mauerkern aus minderwertigem Beton – oder einer bloßen Bruchsteinfüllung in Kalkmörtel – bestand. Dem entspricht, dass schon Vitruv

Abb. 3.13: Opus testaceum, Außenansicht: Casa di Diana, Ostia
Andere Erklärungen sind für die nur in die Mauerschalen eingesetzten, nicht durchbindenden Ziegellagen vorgebracht worden. Es könnte sich um Ausgleichsschichten handeln, bei denen jeweils der exakt horizontale Verlauf der Schichten hergestellt bzw. kontrolliert wurde. Teilweise korrespondieren die Löcher für das Einsetzen der Baugerüste auch mit der Oberkante der Ziegellagen, womit die Schichtstärken mit der möglichen Arbeitshöhe auf dem Gerüst in Zusammenhang stünden. Sicherlich haben auch – wie beim Testaceum mit verschiedenfarbigen Ziegeln und beim Reticulat – ästhetische Aspekte eine Rolle gespielt, sofern die Wände nicht verputzt wurden.241 Beim Bau von Stadtmauern wie der theodosianischen Mauer in Konstantinopel (Istanbul) dürften auch militärtechnische Aspekte eine Rolle gespielt haben. Beim Beschuss von Mauern mit Steinkugeln war das Ziel, ganze Steine aus der Mauerfassade herauszubrechen. Gelang dies, verloren die Steine über den durch Beschuss aufgebrochenen Reihen ihren Halt und brachen leicht nach unten weg. Ziegel, weil weicher, brachen jedoch nicht komplett aus dem Verband, sondern fingen die Wucht des Aufpralls des Geschosses durch Splittern ab. Dadurch verhinderten sie, dass die darüber liegenden Natursteine mehr oder minder von selbst wegbrachen. Es handelt sich damit um dasselbe Prinzip, das man anwandte, wenn in Lehmziegelmauern horizontale Balken eingelegt wurden (kein Fachwerk), die das Nachrutschen von darüberliegendem Lehm der Fassade verhindern sollten.
3.6.2 Wölbtechniken
Der Bogen
Bei der Überbrückung freier Spannweiten in Stein hat die Wölbtechnik einen grundlegenden konstruktiven Vorteil gegenüber Stütze-Gebälk-Systemen: ein Bogen kann größere Öffnungen überspannen als ein Balken von gleichem Querschnitt.244 Ein an seinen Enden aufgelagerter Balken biegt sich unter Last (Eigenlast und Auflast) in der Mitte nach unten durch. Diese Verformung zeigt an, dass innerhalb des Balkens Druck- und Zugspannungen auftreten Die obere Hälfte des Balkens wird durch den Druck gestaucht, die untere durch den Zug gedehnt, vgl. Abb. 3.14. Nun kann aber Stein – ebenso wie Beton – zwar hohe Druckspannungen aufnehmen, aber in nur sehr geringem Umfang Zugspannungen. In einem Steinbalken werden sich daher bei starker Belastung an der Unterseite durch übermäßige Dehnung vertikale Risse bilden, die sich bis zum Bruch des Balkens erweitern können. Römischer Tuff kann kann zudem, verglichen mit anderen Gesteinen, sehr wenig Zugspannungen aufnehmen. (Der sehr feste moderne Zement beispielsweise kann rund zehnfach höhere Druck- als Zugspannungen aufnehmen, weswegen zur Erhöhung der Zugfestigkeit heute fast immer Eisenarmierungen in den Beton eingegossen werden.)
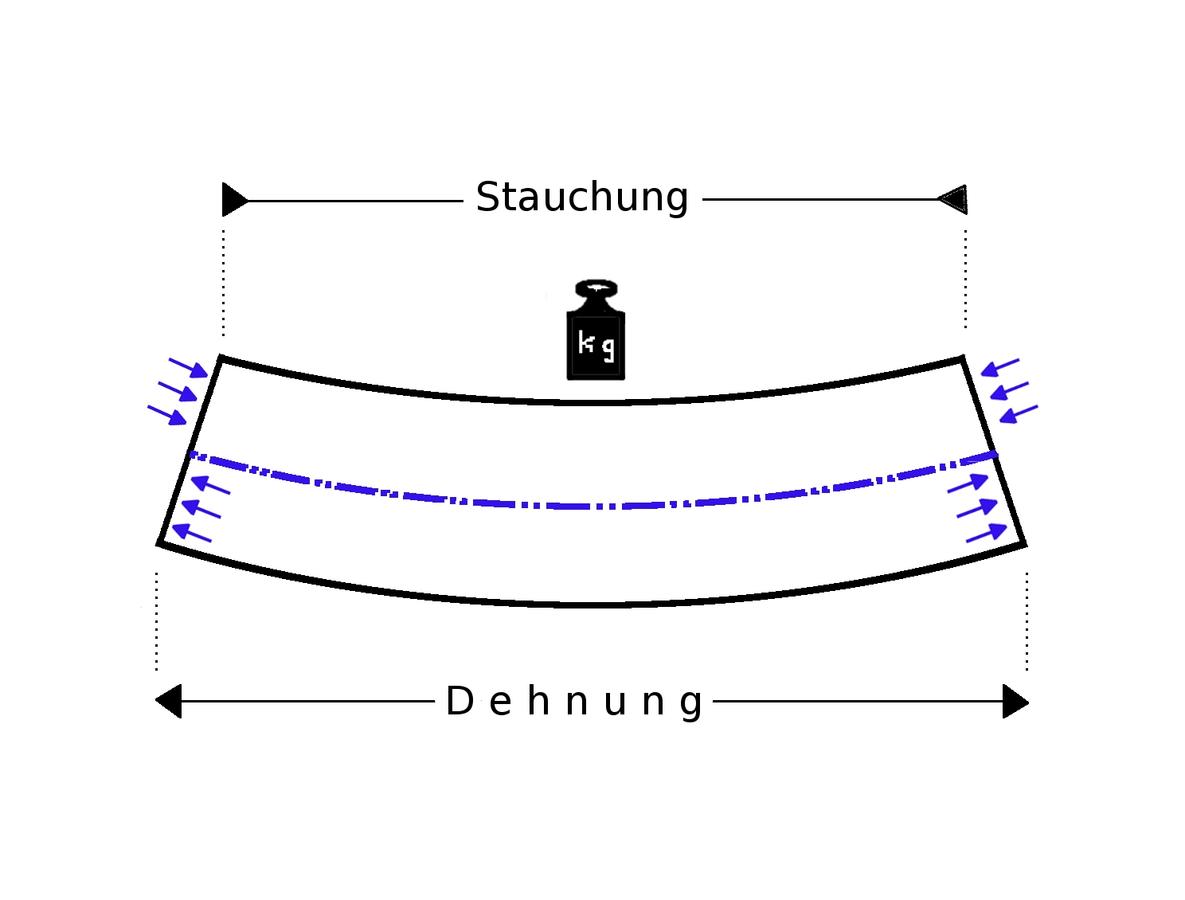
Abb. 3.14: Verformung eines Balkens unter Last (W. Osthues).
Anders als im angesprochenen Biegebalken ergeben sich in einem Keilsteinbogen keine Zugspannungen, sondern ausschließlich Druckspannungen, wenn Form und Dimensionierung des Bogens richtig gewählt sind. In diesem Sinne entspricht der Keilsteinbogen wesentlich besser als der Biegebalken der Belastbarkeit des Steinmaterials.
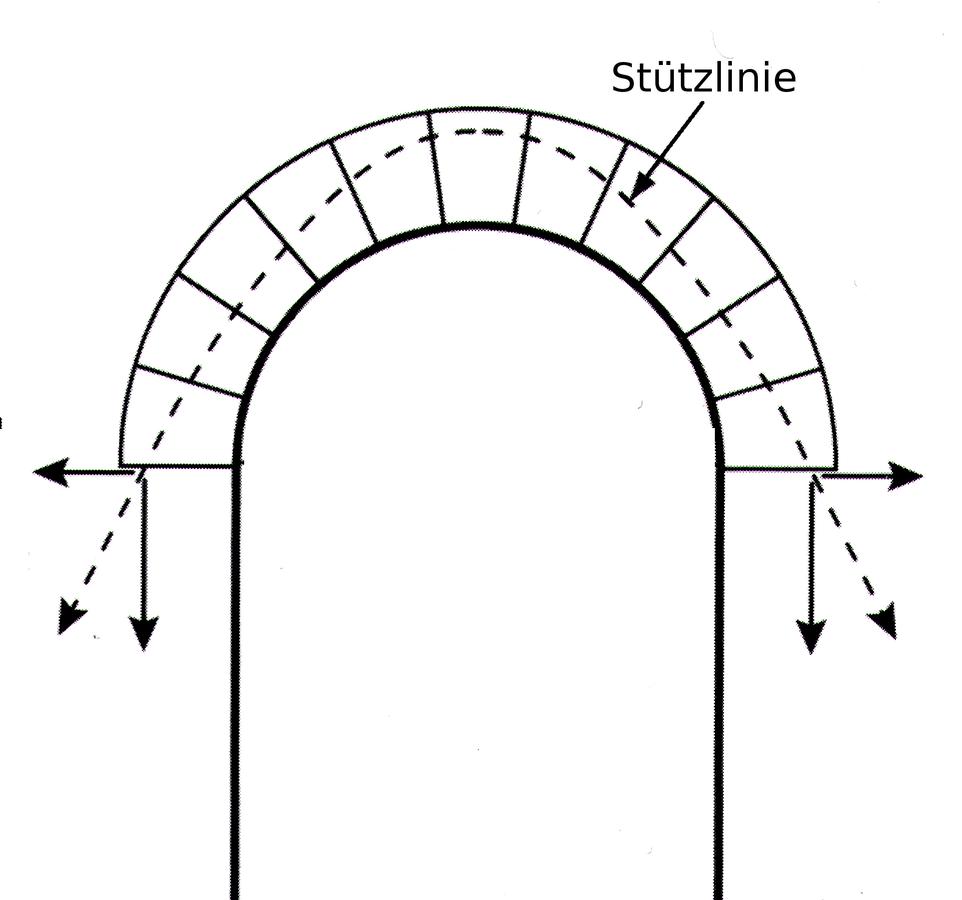
Abb. 3.15: Keilsteinbogen Prinzipskizze mit Stützlinie (Lancaster 2005a Abb. 2, bearbeitet).
Entscheidend dafür ist die radiale Anordnung der Fugen im Keilsteinbogen, die bewirkt, dass die Eigenlast des Bogens oder eine in der Mitte aufgelagerte Last vom Schlussstein ausgehend als seitlich wirkender Druck abgetragen wird, wie die Stützlinie anzeigt (Abb. 3.15). Daraus folgt allerdings, dass die Last bei den Kämpfersteinen – den beiden untersten Steinen des Bogens – permanent als Schubkraft wirkt, die die Steine tendenziell nach außen drückt. „Ein Bogen schläft nie“, wie ein arabisches Sprichwort sagt.245 Dieser Schub muss durch die sog. Widerlager kompensiert werden. Ohne Widerlager würde der Bogen horizontal ausweichen, wodurch sich eine Verformung des Bogens im Sinne einer Absenkung des Scheitels und die Öffnung der Fugen ergeben würde, die zum Einsturz des Bogens führen können, vgl. Abb. 3.16. Widerlager können im Fall einer Toröffnungen die angrenzenden Wände sein, bei einer Brücke die Rampen, Strebepfeiler, oder auch weitere, angrenzende Bogen wie bei vielen Brücken, Arkaden oder Substruktionen. An der Außenseite des Kolosseum und anderen Amphitheatern beispielsweise stützen sich alle Bogen gegeneinander ab. Schubkräfte können auch durch gezielten Einsatz von Auflasten vertikal abgeleitet werden (s. u.).
Formen und Verwendung
Aus dem Bogen lassen sich geometrisch alle Grundformen der Gewölbe ableiten (s. Abb. 3.17):
1staffelt man Bogen hintereinander, ergibt sich das Tonnengewölbe;
2verschneidet man im rechten Winkel zwei Tonnen mit gleicher Stichhöhe, erhält man das Kreuzgewölbe (bzw. bei unterschiedlicher Stichhöhe und gleicher Basis Stichkappen);
3verschneidet man zwei Tonnen über quadratischem Grundriss, ergibt sich das Klostergewölbe;
4rotiert man den Bogen um seinen Scheitelpunkt, erhält man die Kuppel.
Den sog. scheitrechte Bogen erhält man, wenn man das mittlere Segment eines Keilsteinbogens oben und unten horizontal beschneidet, so dass sich ein Balken aus Steinen mit radialem Fugenschnitt ergibt (Abb. 3.18 unten links).
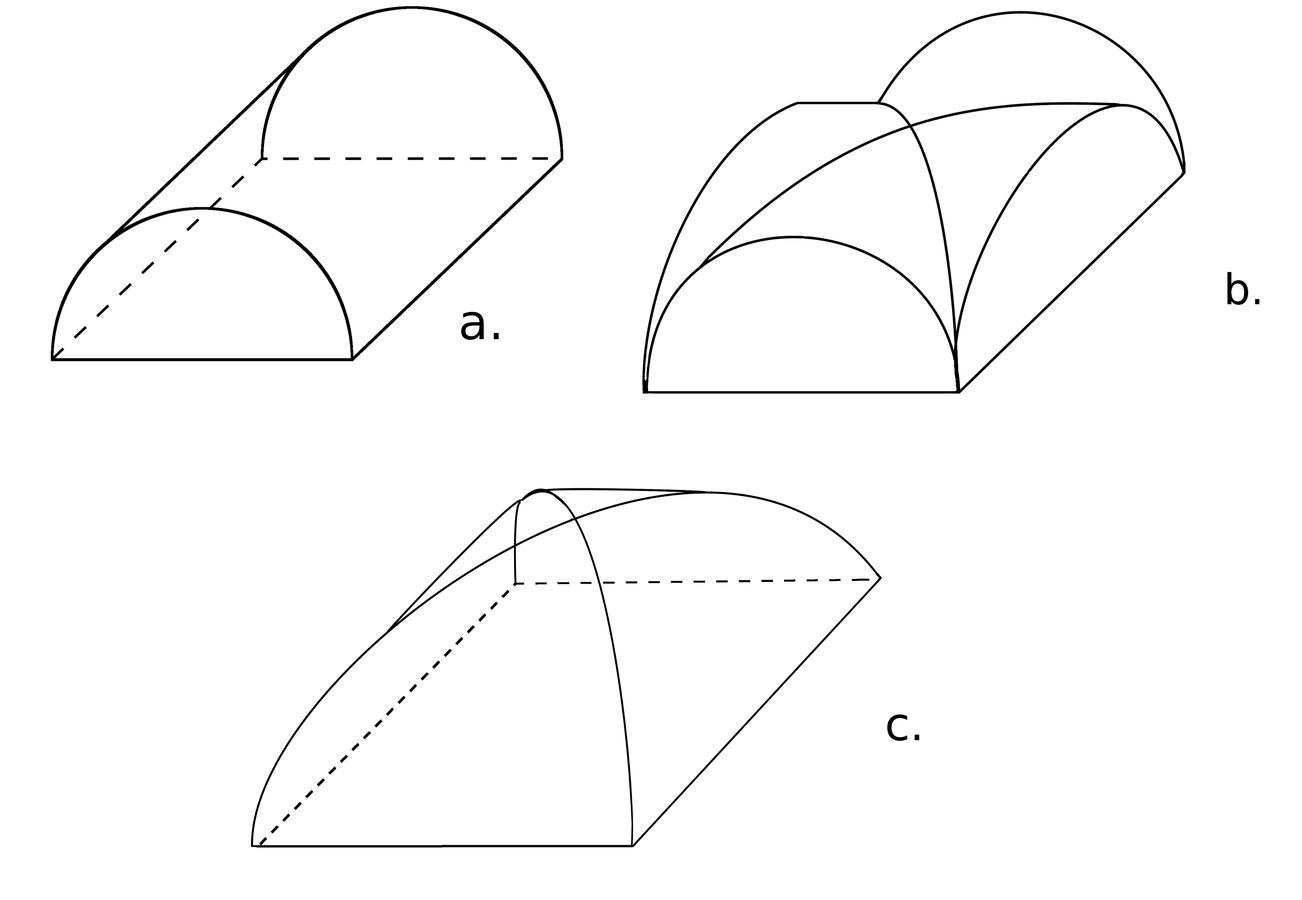
Abb. 3.17: Gewölbeformen: (a) Tonnengewölbe, (b) Kreuzgewölbe, (c) Klostergewölbe (W. Osthues).

Abb. 3.18: Türsturz als scheitrechter Bogen aus Ziegeln, Radialfugen vermörtelt; Thermopolium. Ostia. Skizze unten links: scheitrechter Bogen aus Natursteinen mit radialem Fugenschnitt, mörtellos. (W. Osthues).
Alle diese Gewölbeformen lassen sich an römischen Bauten nachweisen. Freistehende Bögen246 findet man bei Türen, Fenstern, Torbauten, Triumpfbögen etc., oft auch in Reihen, die sich gegenseitig stützen, bei Substruktionen, Aquaedukten, Brücken und Amphitheatern. Zu den ersten bekannten Bogen mit großer Spannweite zählt in Rom
Tonnengewölbe wurden zur Überdeckung von Räumen unterschiedlichster Größe genutzt. Typisch sind sie für die ab augusteischer Zeit errichteten Thermenbauten, da die dort herrschende Feuchtigkeit hölzerne Dachstühle frühzeitig angegriffen hätte.247 Die großen Basiliken hatten hingegen meist hölzerne Dachstühle. Erst im Zusammenhang mit der Belichtung wurden Basiliken auch mit Wölbkonstruktionen eingedeckt (s. u.). Typisch waren Tonnengewölbe des weiteren für Substruktionen von bebauten Terrassenanlagen, oder auch im Fundament sehr schwerer Bauten wie Amphitheater, da eine Wölbkonstruktion gegenüber einem massiven Fundament sehr viel Material einsparte.
Kreuzgewölbe findet man ab dem 1. Jh. n. Chr. als Deckenkonstruktion an Bauten mit kreuzförmigem Grundriss, später auch – in Reihe – als Eindeckung von Basiliken und Thermen. Die Öffnungen quer zur Raumachse wurden als Fenster genutzt (Lünetten), was bei einem einfachen Tonnengewölbe nicht möglich wäre. Vereinzelt findet man auch die Variante, bei der ein Tonnengewölbe mit Stichkappen kombiniert wurden, bei denen die quer zur Gebäudeachse liegenden Tonnen niedriger sind als die Haupttonne.248
Kuppeln wurden meist für die Eindeckung von Sälen mit rundem oder polygonalem Grundriss verwendet, oft bei Thermen, aber auch bei Rundtempeln. Kleine Kuppeln mit bis etwa 8m Spannweite findet man schon in republikanischer Zeit, größere Betonkuppeln ab der frühen Kaiserzeit.249
Das Klostergewölbe zur Eindeckung quadratischer Räume gab es – trotz der relativ komplexen Form – schon sehr früh, beispielsweise an dem unter Sulla zwischen 83 und 80 erbauten Staatsarchiv (Tabularium).250 Aus der Spätantike kennt man selbst ovale Räume mit Einwölbung, wie die antiken Baureste von St. Gereon in Köln
Scheitrechte Bogen wurden sehr häufig zur Überdeckung von Wandöffnungen anstelle von Holz- oder Steinbalken verwendet. Wegen der hohen Belastung von Tür- oder Fensterstürzen im Untergeschoss von mehrstöckigen Bauten wurden die Lasten über scheitrechten Bögen häufig durch Entlastungsbögen abgefangen, die über dem Sturz in die Wand eingelassen waren (Abb. 3.18. Sie hatten zudem den Vorteil, dass sich gebrochene Tür- und Fensterstürze relativ problemlos nach Bruch auswechseln ließen251 Bei starken Mauern mit caementitium Kern täuschen die an den Fassaden erkennbaren scheitrechten und Entlastungsbögen allerdings häufig den Betrachter, denn die Entlastungsbögen binden dort nicht durch die Mauer durch, entlasten also nur den Fassadenaufbau, während die Öffnung im Inneren durch ein gegossenen Betonbogen gesichert ist.252
Die Dimensionen der Gewölbe, die als Dacheindeckung dienten, blieben bis zum Ende der Republik relativ bescheiden. Wesentlich größere Spannweiten (bis etwa 20 m) hatten in republikanischer Zeit die in Keilsteintechnik erbauten Brücken. Die Spannweiten der Dachgewölbe nahmen fast sprunghaft zu in augusteischer Zeit, als Gewölbe in caementitium Bauweise ausgeführt werden: 21,5 m am sog. Tempel des Mercur in Baiae
3.6.3 Lehrgerüste
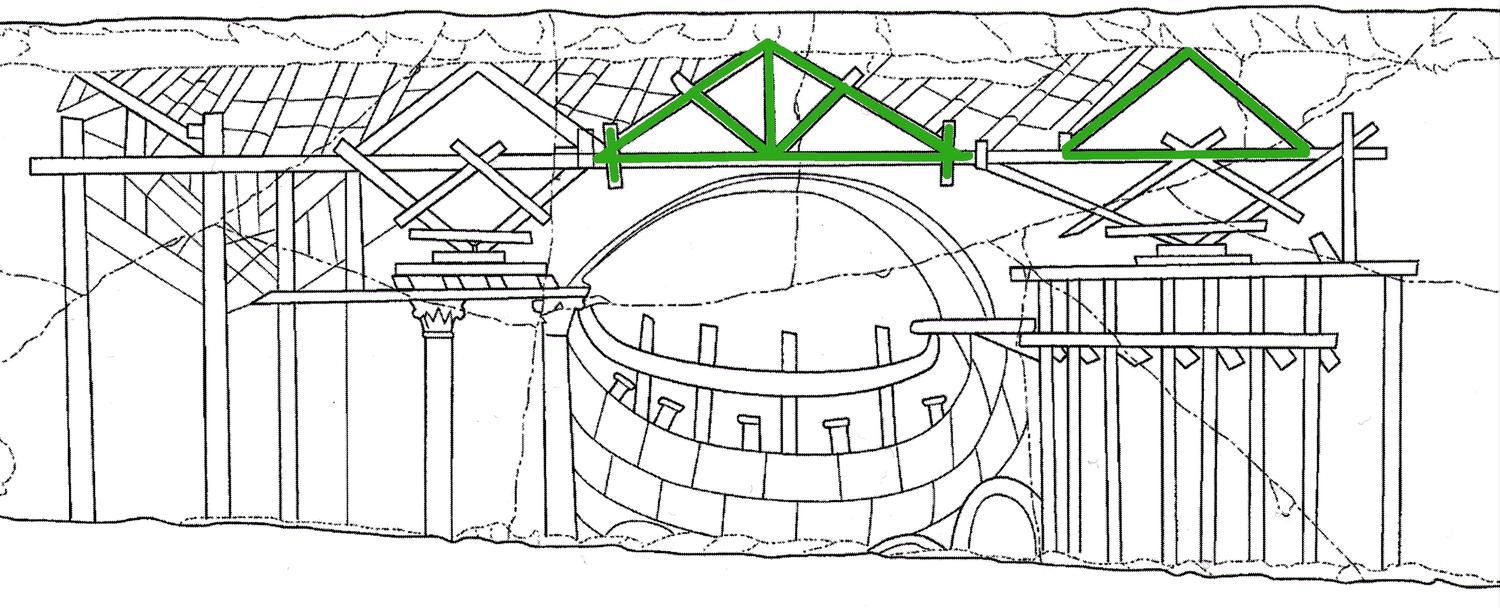
Abb. 3.19: Umgezeichnetes Relief eines Amphitheaters aus Holz, gefunden unter dem Palazzo della Cancelleria in Rom
Lehrgerüste als per se temporäre Konstruktionen haben sich naturgemäß nicht erhalten, so dass die Rekonstruktion der Konstruktionsformen ein fast nie vollständig zu lösendes Problem darstellt. So besteht bis heute selbst für die berühmteste Gewölbekonstruktion der Antike, die Kuppel des Pantheon, unter den Forschern immer noch kein Konsens darüber, ob bei der Errichtung der Kuppel ein zentrales, vom Boden bis zum Oculus reichendes Gerüst aufgestellt wurde oder nicht.255 Immerhin gibt es vereinzelt Anhaltspunkte für die Bestimmung der Konstruktionsmethoden der Lehrgerüste, wie etwa Konsolen oder Balkennester in den Widerlagern (Pfeiler oder Mauern), die zeigen, wo die Balken des Gerüstes sich abgestützt haben.256 Bei Betondecken gibt dort, wo der Verputz heute abgeblättert ist, häufiger noch Abdrücke, die zum Teil sogar die Fugen der Schalbretter anzeigen. Zudem gibt es einige wenige bildliche Darstellungen, bei denen allerdings zu berücksichtigen ist, dass die jeweiligen Künstler keine gelernten Bauzeichner waren. Vor allem die Proportionen sind in diesen Darstellungen oft erkennbar unrealistisch, doch zeigen einige aufschlussreiche technische Details.
Für die Herstellung der Lehrgerüste war neben geeignetem Holz eine qualifizierte Zimmermannstechnik notwendig, die belastbare Verbindungen der Balken ermöglichte, sowie Konstruktionswissen, um den unter Last auftretenden Kräften an den entsprechenden Stellen durch Stützen und Verstrebungen begegnen zu können. Das Lehrgerüst, genauer gesagt: die Schalung als sein oberer Abschluss, definierte zugleich als eine Art Negativ die Form des Gewölbes. In gewissem Umfang wirkte im Bauprozess beides zusammen, da die Belastungen des Gerüstes nicht in jeder Phase gleichmäßig waren, selbst wenn, wie üblich, das Gewölbe von beiden Seiten ausgehend hochgezogen wurde. Ein etwa zur Hälfte fertiggestelltes Gewölbe aus Keilsteinen oder Ziegeln belastete das Lehrgerüst nur seitlich, so dass das unbelastete Zentrum des Gerüstes tendenziell nach oben auswich, also dort etwas höher war als in unbelastetem Zustand. Moderne Vermessungen mit aktueller Meßtechnik haben häufiger Verformungen nachgewiesen, d. h. Abweichungen von der offensichtlich vorgesehenen Halbkreisform, die auf diese Weise zu erklären sind.
Die einfachste Vorgehensweise bei der Konstruktion eines Lehrgerüstes war das Vollgerüst, das auf dem Boden des Gebäudes gegründet war und bis zum Scheitel des Gewölbes reichte. Vorbilder für die Konstruktion könnten die schon im späten 4. Jh. v. Chr. sehr hohen Belagerungstürme gewesen sein257 Der Standsicherheit dieser Türme muss ein besonderes Augenmerk der Architekten gegolten haben, denn die Türme waren wegen ihrer Verkleidung Windlasten ausgesetzt und wurden schon in dieser Zeit mit Wurfgeschützen und Katapulten beschossen. Erfahrungen mit turmähnlichen Holzkonstruktionen größerer Höhe dürften die römischen Architekten auch im Wohnungsbau speziell in Rom
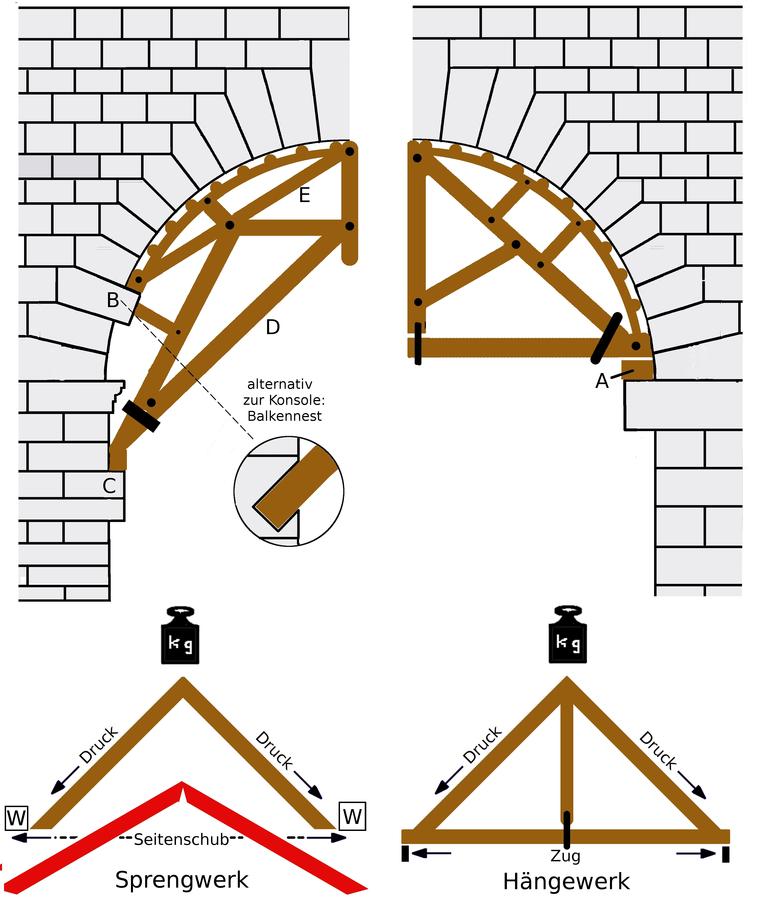
Abb. 3.20: Lehrgerüstformen für Tonnengewölbe und Brückenbögen, schematische Rekonstruktionen.
Die Römer kannten die beiden Hauptformen solcher Tragwerke, das Sprengwerk und das Hängewerk. Ein Sprengwerk besteht im einfachsten Fall nur aus zwei Streben, die diagonal zu einander gestellt sind (Prinzipskizze Abb. 3.20 unten links). Die Last, die die Streben tragen, führt an der Basis der Konstruktion neben vertikalem Druck zu Seitenschub, den die Widerlager (W) aufnehmen müssen. Im Fall der Überlastung der Widerlager spreizt sich die Konstuktion an der Basis, die Verbindung an der Spitze öffnet sich und sackt nach unten durch (auf dem Schema in rot dargestellt).
Das Hängewerk unterscheidet sich vom Sprengwerk im Grundsatz zunächst dadurch, wie dem Seitenschub der diagonalen Streben begegnet wird (Prinzipskizze Abb. 3.20 unten rechts). Beim Hängewerk sind die beiden diagonalen Streben an ihrem Fuß in einen Bundbalken eingezapft, so dass sie dort nicht nach außen ausweichen können. Der Bundbalken selbst wird im Lastfall gedehnt, d. h. auf Zug belastet, also gleichsam geradegezogen. Da der Bundbalken den Seitenschub der Streben aufnimmt, sind bei dieser Konstruktionsweise Widerlager nicht erforderlich, d. h. die Konstruktion übt keinen Seitenschub auf die Stützen oder Pfeiler aus, die sie tragen. Besteht die Konstruktion nur aus den bisher angesprochenen zwei Diagonalstreben und dem Bundbalken, spricht man im Fall eines Dachtragwerks von einem Sparrengebinde.
Beim eigentlichen Hängewerk kommt als vierte Komponente mindestens ein vertikaler Pfosten hinzu. Dieser Pfosten stützt nicht etwa den First der Konstruktion, und drückt damit auf den Bundbalken, sondern es verhält sich gleichsam umgekehrt: Das Zentrum des Bundbalkens ist an dem Pfosten aufgehängt. Man erkennt das auf Schemazeichnung daran, dass das untere Ende des Pfostens nicht mit dem Bundbalken verzapft ist, sondern über dem Bundbalken schwebt, bzw. durch ein Eisenband als Aufhängung (schwarz) mit ihm verbunden ist. Der Bundbalken ist bei dieser Konstruktion sozusagen doppelt gegen eine Durchbiegung in der Mitte (durch Eigenlast oder Auflast) gesichert, zum einen durch die Aufhängung am First, zum anderen durch die Streben, die ihn durch ihre Spreizung dehnen bzw. geradeziehen.
Das Sparrengebinde erkennt man rechts auf einem Relief, das ein aus Holz errichtetes Amphitheater darstellt (grün auf Abb. 3. 19) Im Zentrum sieht man ein zusammengesetztes Hängewerk. Letzteres hat zusätzlich zwei innere, diagonale Streben, die sich an dem vertikalen Pfosten gegeneinander abstützen, und so die Durchbiegung der beiden Hauptstreben verhindern. Charakteristisch an der Reliefdarstellung sind vor allem die beiden Zangen (kurze, vertikale Balken) an den beiden Enden der Basis des Hängewerks. Sie belegen die Kenntnis der Richtung der Kräfte im Hängewerk, denn sie sichern den kritischen Punkt der Konstruktion. Wenn nämlich die Verbindung zwischen den beiden Hauptstreben und dem Bundbalken an der Basis des Dreiecks sich lösen würde, könnte der Bundbalken den Schub der Streben nicht mehr auffangen, so dass die Streben sich spreizen würden wie oben für das Sprengwerk beschrieben. Zangen, die das verhinderten und die Verzapfung zwischen Streben und Bundbalken sicherten, dürften nicht nur durch Paare von kurzen Holzbalken, wie auf dem Relief wohl gemeint, sondern auch durch Eisen- oder Bronzebänder realisiert worden sein.
Ein Hängewerk als Lehrgerüst ist beispielhaft auf Abb. 3. 20 oben rechts dargestellt. Die Konstruktion hat mehrere Vorteile. Da die Holzkonstruktion wegen des Bundbalkens keinen Seitenschub erzeugt, war sie besonders geeignet bei Gewölben, die in großer Höhe errichet wurden, da die Stabilität entsprechend hoher Wände oder Pfeiler durch Seitenschub besonders gefährdet war (solange außen den Mauern keine Strebepfeiler vorgesetzt waren, um dem Seitenschub zu begegnen). Zudem ließ sich ein solches Gerüst nach Fertigstellung des Gewölbes als Ganzes entnehmen („ausrüsten“), nachdem das Lehrgerüst abgesenkt wurde, indem der Holzbalken, auf dem das Hängewerk aufgelagert war (auf Abb. 3. 20 oben rechts bei A), herausgeschlagen wurde. Das Gerüst konnte dann bei Bogenbrücken oder Aquaedukten für die Errichtung des nächsten Bogens wiederverwendet werden, oder bei tiefen Bogen seitlich verschoben werden für ein gleichsam schrittweises Zusammenfügen des Bogens aus nebeneinander gestellten, jeweils in sich tragfähigen Bogen. Ein solches Nebeneinanderstellen von einzelnen Bogens kann man für den Pont du Gard annehmen (Abb. 3. 21), denn dort zeigt die Sicht auf die Unterseite des Bogens, dass es sich technisch um drei nebeneinander gestellte Bogen handelt, da die Keilsteine dieser drei Bogen nicht ineinandergreifen, bzw. kein Fugenwechsel vorliegt. (Das verschobene Lehrgerüst war allerdings in diesem Fall ein Sprengwerk, s. u.) Der Nachteil der Hängewerke war, dass sie sicher nur bei Bogen oder Gewölben von begrenzter Spannweite eingesetzt werden konnten, als einfaches Sparrengebinde kaum für Gewölbe von mehr als etwa etwa 7-8 m Spannweite, als Hängewerk mit innerer Aussteifung (wie im Zentrum der Reliefdarstellung) wohl auch nur für Spannweiten von etwa 12 m.259 Man wird mit dieser Form des Lehrgerüstes immer dann rechnen müssen, wenn die Gewölbe die genannten Dimensionen nicht überschreiten und Konsolen oder Kämpferkapitelle entsprechender Stärke vorhanden sind, aber keine sonstigen Einlassungen für Balken oder weitere Konsolen.
Das polygonale, zusammengesetztes Sprengwerk ist beispielhaft auf Abb. 3. 20 oben links dargestellt. Die beiden diagonalen Streben D und E sind hier auf den Konsolen B und C aufgelagert. Die Strebe E stützt das Zentrum des Bogens direkt, D vermittelt über einen vertikalen Pfosten. Zudem sind einige Hilfsstreben eingezeichnet, die das Gerüst vor allem bei asymmetrischer Belastung sichern, sowie die Schalung abstützen. Ein Lehrgerüst dieses Typs wurde am Pont du Gard eingesetzt, wie man an den entsprechenden Konsolen erkennt, die im oberen Bereich der Pfeiler und in den unteren Abschnitten der Gewölbelaibung eingemauert worden sind. Die obere, zweisteinige Konsole, entsprechend B auf der Zeichung, ist auf dem Photo Abb. 3. 21 erkennbar. Konsolen dieser Art, also unter- und oberhalb des Kämpferkapitells, dienten allein als Widerlager für die Streben. Ihre Vorsprünge wären bei anderen als Nutzbauten sicherlich nach dem Ausrüsten abgearbeitet worden. Eine Alternative zu solchen Konsolen als Widerlager der Streben waren Balkennester, in die der Fuß der Streben eingezapft wurde, wie auf Abb. 3. 20 als Detail dargestellt. Man findet Balkennester dieser Art etwa am 62 v. Chr. erbauten Pons Fabricius in Rom
Ein wesentlicher Vorteil solcher Sprengwerke gegenüber den Hängewerken war, dass sie wegen der größeren Zahl der tragenden Streben (auf Abb. 3. 20 zwei statt nur einer, bzw. bei symmetrischer Ergänzung der Zeichnungen vier statt nur zwei) wesentlich höhere Lasten tragen konnten. Zudem war bei den Sprengwerken nicht der relativ lange Bundbalken der Hängewerke erforderlich. Nachteilig war vor allem bei der Auflagerung der Streben in Balkennestern, dass das Gerüst nicht als Ganzes entnommen und versetzt werden konnte, sondern für eine Wiederverwendung mindestens teilzerlegt werden musste, um die Streben aus den Balkennestern entnehmen zu können.
Da die Römer die zu tragenden Auflasten und die entsprechend erforderlichen Dimensionierungen ihrer Gerüstkonstruktionen nicht durch statische Berechnungen bestimmen konnten, ist es nicht überraschend, dass sich mit der Stabilität der Lehrgerüste die eingangs erwähnten Probleme ergeben haben. Neben mangelnder Stabilität der Lehrgerüste selbst kann auch bei gemauerten oder gegossenen Gewölben das zu frühe Ausrüsten Ursache von Deformationen gewesen sein, oder bei vom Boden aufgeführten Gerüsten eine nicht ausreichend Tragfähigkeit des Untergrundes. In solchen Fällen würde das Gewölbe durchsacken, also im Zentrum einen abgeflachten Kontur annehmen, oder eine nicht spiegelsymmetrische Form. Friedrich Rakob konnte an der Kuppel des Merkurtempels in Baiae

Abb. 3.21: Pont du Gard (Provence), Detail der mittleren Bogenreihe (W. Osthues).
3.6.4 Gewölbe
Die Keilsteintechnik wurde in der Mittelmeerwelt und im Orient seit Jahrhunderten angewandt. Ebenso wie die Griechen, bei denen sie etwa seit Mitte des 4. Jhs. v. Chr. auftrat, errichteten die Römer Nutzbauten mit Keilsteingewölben, wie Substruktionen, Tore in Stadtmauern und vor allem Brücken. Ein frühes Beispiel dafür in Rom
Das Bauen in Keilsteintechnik war arbeitsintensiv und teuer, zumindest dann, wenn das Steinmaterial an den Fugen für das Versetzen ohne Mörtel zugerichtet wurde, was qualifizierte Arbeitskräfte erforderte. Die Beschränkung auf den Ingenieurbau und hochbelastete Mauern wie die Außenwände von Amphitheatern dürfte aber vor allem technische Gründe haben. Geeignete Natursteine – in Rom
Betongewölbe
In bautechnischer Hinsicht aufschlussreich ist vor allem die Kuppel des Mercurtempels. Die in den Mörtel eingebettenen Bruchsteine (caementitia) sind dort radial in die Mörtelmasse eingebettet. Ihre Anordnung entspricht damit der von Keilsteinen. Das zeigt, dass die Baumeister den Gussbeton noch nicht als quasi-monolithen Kunststein verstanden, sondern als eine Art Keilsteinbogen aus grobem Bruchstein und Mörtel. Erst an späteren Betongewölben wird erkennbar, dass der Beton sozusagen als Bautechnik sui generis begriffen wurde, denn später platzierte man die caementa horizontal statt radial, womit die äußerliche Ähnlichkeit zur Keilsteinbauweise aufgehoben ist.266
Die große Betongewölbe der Kaiserzeit sind fast nie reine Gusskonstruktionen. Ein Teil der mit dem Betonguss kombinierten Bautechniken wurde offensichtlich eingesetzt, um die Struktur der Gewölbe an als kritisch wahrgenommenen Abschnitten zu verstärken. Eine Form solcher Verstärkungen war das Einziehen von Bögen bzw. Rippen an als besonders belastet wahrgenommenen Gewölbeabschnitten. Sie wurden auf die Lehrgerüste aufgemauert, bevor der Beton aufgebracht wurde. Dass die Rippen als Verstärkungen verstanden wurden, erkennt man deutlich an einem frühen Beispiel für diese Bauweise, am Tempel des Hercules Victor in Tivoli
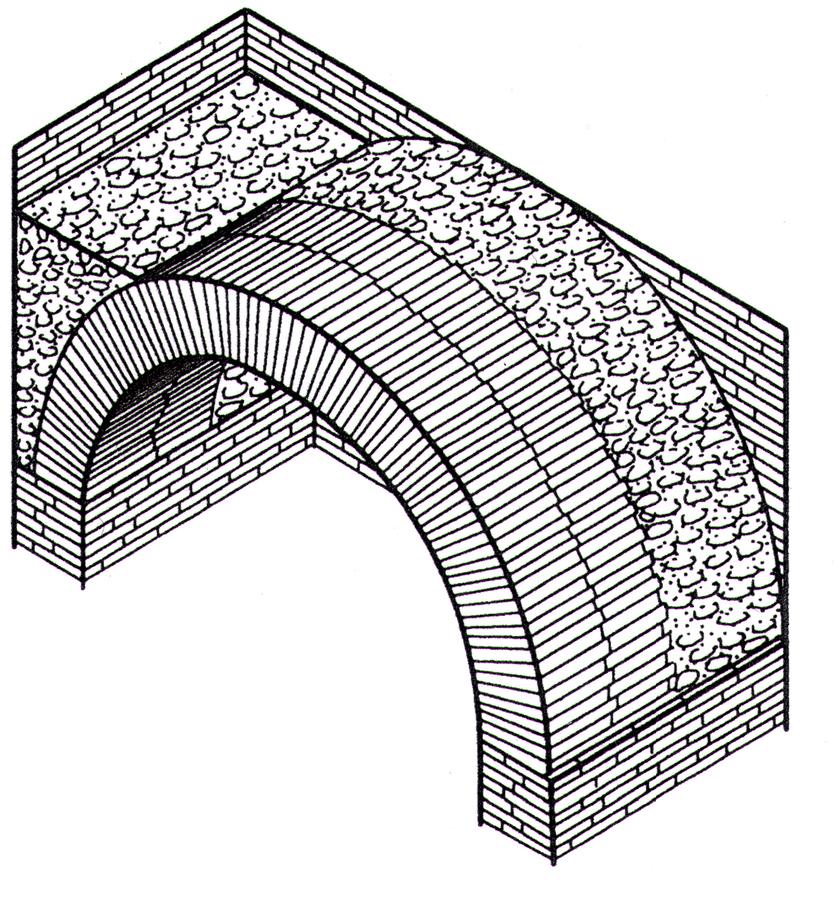
Abb. 3.22: Ziegelrippen in Betonschalen innerhalb eines Tonnengewölbes (Lancaster 2008, Abb. 10.6A).
Etwa am Beginn des 2. Jhs. n. Chr. lässt sich eine Weiterentwicklung der Kombination von Ziegelrippen und Betonguss beobachten, die nicht mehr nur besonders belastete Abschnitte der Gewölbe betrifft, sondern deren gesamte Struktur: Anstelle der bipedales überdeckte man nun mit Rippen aus kleineren Ziegelformaten die gesamten Lehrgerüste, die ihrerseits in regelmäßigen Abständen durchschnitten werden von horizontalen Lagen aus den großen bipedales, so dass sich eine Lamellenstruktur ergibt, deren Fächer anschließend mit der Gussmasse gefüllt werden (Abb. 3.23). Man findet diese Art der Wölbtechnik beispielsweise am Theater von Ostia. Sie wurde bis zum Untergang des Imperiums beibehalten. Man findet sie spät an an der 306 bis 313 erbauten Maxentiusbasilica in Rom
Im Ergebnis wird durch den Einschluss der Ziegel einerseits das Gewölbe leichter, da die Ziegel ein nur etwa halb so hohes spezifisches Gewicht haben wie der Beton. Damit konnten auch Lehrgerüst und Schalung leichter ausgeführt werden. Wahrscheinlich hatte die Lamellenstruktur auch zur Folge, dass sich der Druck innerhalb des Gewölbes homogener verteilte.
Ziegel wurden an Gewölben aus Beton auch noch in anderer Weise verwendet. Ab dem 2. Jh. n. Chr. gab es häufiger echte Ziegelschalen auf der gesamten Wölbfläche, also nicht Ziegelrippen, sondern Ziegel, die die Laibung des Gewölbes verblenden, in dem sie auf das Lehrgerüst aufgelegt wurden, bevor der Beton aufgebracht wurde. Solche Ziegelschalen wurden nicht selten mit der Betonmasse verzahnt durch einzelne, radial eingefügte Ziegel. Ein Beispiel dafür gibt es etwa an den Caracallathermen.270 Solche leichten Schalen dienten nicht zur Verstärkung der Gewölbestruktur wie die oben beschriebenen Rippen, sondern sollten Problemen begegnen, die offenbar auftraten, wenn Schalbretter abgenommen werden sollten, auf die der Beton direkt aufgegossen worden war.271 Um die unerwünscht feste Verbindung von Schalbrettern und Beton zu vermeiden, wurden möglicherweise die Bretter, wie oft auch heute, vor dem Aufbringen des Betons eingeölt. Ein zusätzlicher Effekt der Ziegelschalen war, dass man nicht die gesamte Innenfläche des Gewölbes mit Brettern verschalen musste.
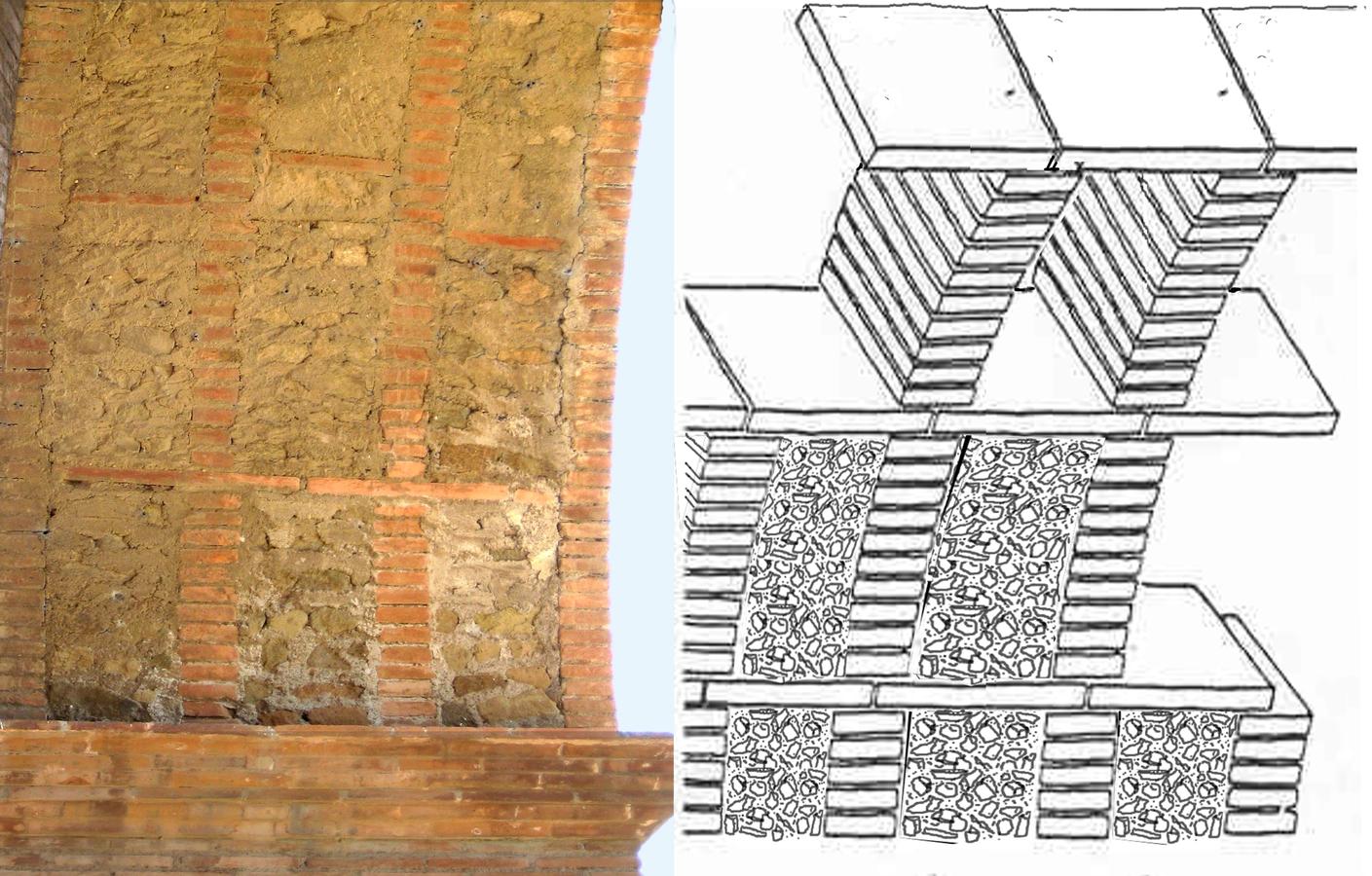
Abb. 3.23: Lamellengewölbe. Links moderne Restaurierung, rechts schematische Darstellung (W. Osthues).
Eine weitere Form der Verwendung von Ziegeln innerhalb von Gussgewölben bei Kuppeln war, die großen bipedales in Form von horizontalen Schichten in regelmäßigen Abständen in die Betonmasse einzufügen, so dass die Ziegel in der Aufsicht konzentrische Kreise bildeten, bzw. im Schnitt sich Ziegellagen und Beton abwechseln wie bei opus mixtum. Der Abstand zwischen den Ziegellagen korrespondiert meist mit der Höhe der äußeren Stufenringe im unteren äußeren Bereich der Kuppeln (z. B. am Tempel der ,Minerva Medica‘ aus der 1. Hälfte des 4. Jhs. n. Chr.; zu den Stufenringen mehr im folgenden). Die Funktion der Ringe könnte in der Homogenisierung der Druckverhältnisse innerhalb der Gussmasse gelegen haben, oder auch dem Niveauabgleich beim Aufbringen des Betons gedient haben.
Ziegelgewölbe
Die Verfüllung in den Zwickeln von Bögen und am Fuß von Gewölben mit Bruchsteinen in Lehm oder Kalkmörtel haben bei dieser Bauweise – anders als der Beton – keine tragende Funktion. Dennoch sind die Verfüllungen statisch von Bedeutung, denn sie verhindern als Auflast auf die unteren Abschnitte von Gewölben und Bogen ein seitliches Ausbrechen der Wölbungen bzw. reduzieren den Seitenschub am Fuß der Gewölbe. Die Auflast durch die Verfüllungen hat konstruktiv in etwa die gleiche Funktion wie die weiter unten angesprochenen Stufenringe von Kuppeln.
Leistungsfähig war auch diese Art der Bautechnik, wie die Tonnengewölbe der Thermenanlagen des Ostens (Spannweiten bis 18m) und vor allem die an Kuppelbauten erreichten Spannweiten belegen. Der Rundtempel im Zeus-Asklepius-Heiligtum von Pergamon
Technisch gibt es zwischen den Ziegelgewölben und den Betongewölben einige grundlegende Unterschiede. Zunächst einmal waren die Ziegelgewölbe deutlich leichter als die Betongewölbe, da, wie erwähnt, das spezifische Gewicht der Ziegel wesentlich geringer ist als das des Betons. Das bedeutet zugleich, dass die Druckspannungen innerhalb der Gewölbe insgesamt geringer waren. Allerdings hatte diese Bauweise zugleich den technischen Nachteil, dass das Material nicht homogen war, denn der Kalkmörtel war weniger druckstabil als die Ziegel selbst, oder auch der Beton. Hinzukommt, dass wegen der radialen Anordnung der quader-, nicht keilsteinförmigen Ziegel die Mörtelfugen jeweils unten schmaler waren als oben, was ebenfalls zur Inhomogenität der Druckverteilung im Gewölbe führte. War die Konstruktion jedoch von der Dimensionierung und den Auflasten her gesehen auf der ,sicheren Seite‘, brachte die vergleichsweise geringe Druckstabilität des Kalkmörtels aber auch gewisse Vorteile, denn der weichere Mörtel konnte bis zu einem gewissen Grad Spannungsspitzen aufnehmen, was in den erdbebengefährdeten Gebieten zur Standsicherheit der Bauten beitrug.
3.6.5 Kenntnisse der Statik und deren praktische Anwendung
Es gab in der Antike, trotz des bereits hohen Niveaus der antiken Mathematik, keine Form einer auf Berechnungen basierten Statik. Gleichwohl hatten die römischen Architekten ein durchaus fortgeschrittenes Verständnis der Spannungsverhältnisse in Gewölbekonstruktionen.
Die Konstruktion eines auf dem Rundbogen basierenden Tonnengewölbes, eingefügt in eine massive Wand wie bei einem Tordurchlass einer Stadtmauer, oder bei einem Triumpfbogen mit massiven Flanken, erfordert kein fortgeschrittenes Verständnis der vom Bogen und seiner Auflast hervorgerufenen Druckspannungen. Die massiven Wände oder Pfeiler solcher Bauten können die vom Bogen ausgehenden Kräfte, welcher Richtung auch immer, ohne weiteres aufnehmen. Trotzdem zeigt sich gelegentlich auch bei einfachsten Konstruktionen erkennbar ein Verständnis der vom Bogen ausgehenden Kräfte.
Auf der Abbildung Osthues15 ist ein stark vereinfachtes Schema mit einer Stützlinie dargestellt, die die Richtung der vom Bogen hervorgerufenen Druckspannungen darstellt. Die Linie verläuft unterhalb des Bogenansatzes (der Kämpferzone) nicht senkrecht, sondern diagonal nach unten. Dem Schema gegenübergestellen lässt sich das das Bild einer überwölbten Wandöffnung der Villa der Quintilii (Abb. 3.24, ca. 150 n. Chr.). Man sieht dort rechts der Öffnung einen schräg in die Mauer integrierten Stützpfeiler, der der Richtung der Stützlinie folgt. Konstruktiv erforderlich war dieser Stützpfeiler keineswegs, aber er zeigt doch an, dass der Baumeister wusste, welche Richtung der vom Bogen ausgehende Druck nehmen würde.
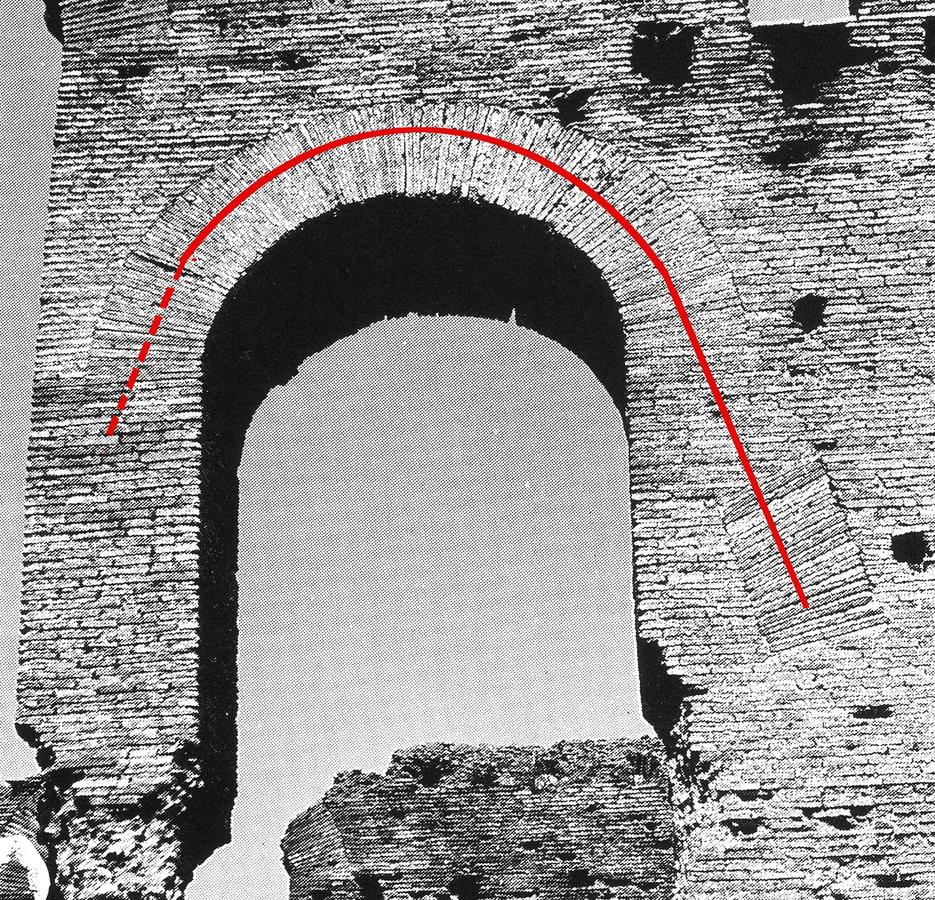
Abb. 3.24: Villa dei Quintilii Via Appia bei Rom
Sehr viel mehr know-how war erforderlich bei Gebäudetypen, bei denen das Gewölbe nicht von einer Wand eingefasst war wie bei den angesprochenen Torbauten, sondern auf der Krone von Mauern ansetzte. Hier bestand prinzipiell das Risiko, dass der Horizontalschub am Fuß des Gewölbes die das Gewölbe tragenden Mauern bzw. Widerlager auseinanderdrückt, wodurch das Gewölbe im Zentrum abflachen, und schließlich einstürzen würde. Eine Gegenmaßnahme wäre, durch die statisch optimale Form der Wölbung diese Kräfte aufzufangen. Optimal wäre in diesem Sinne ein Bogen wie der unten abgebildete Gateway Arch in St. Louis

Abb. 3.25: Gateway Arch, St. Louis
Die optimale Form eines Bogens ist jedoch keine fixe Form, sondern hängt ab von den Lasten, also der Eigenlast des Bogens und seiner Auflast. Die Form wie am Gateway Archi ist optimal nur für einen freistehenden Bogen. Die unterschiedlichen Stützlinien von belastetem und unbelastetem Bogen sind, stark vereinfacht, auf der nachfolgenden Abbildung 3.26 dargestellt.
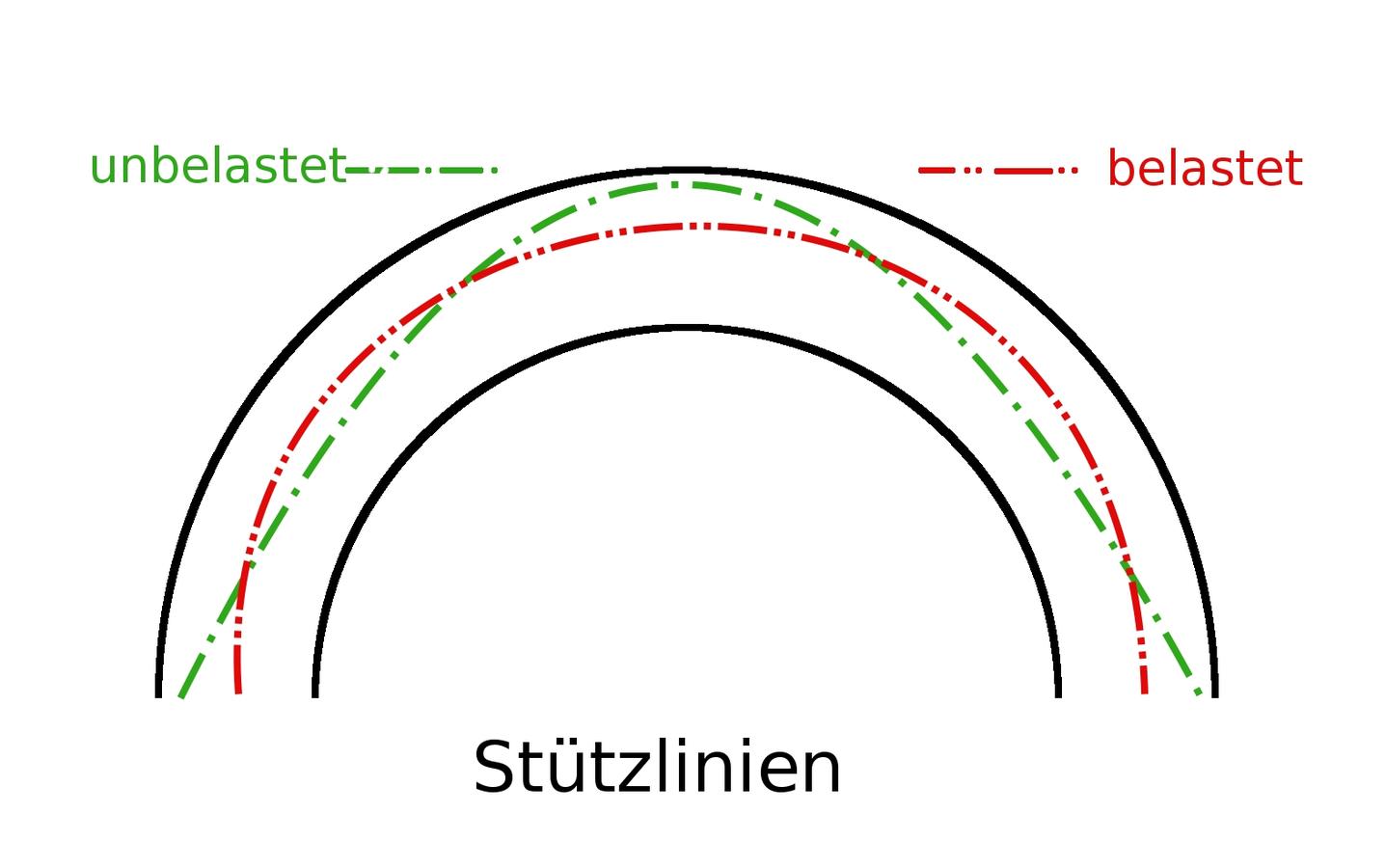
Abb. 3.26: Stützlinien eines belasteten und eines unbelasteten Bogens (W. Osthues).
Bei Gleichlast flacht die optimale Form, verglichen mit der des unbelasteten Bogens, ab, und entspricht einer quadratischen Parabel. Noch stärker flacht die statisch ideale Form ab, und nähert sich dem von den Römern bevorzugten Halbkreis an, wenn die Lasten selektiv auf den verschiedenen Abschnitten des Bogens ruhen. Würde man die Lasten auf dem Bogen so verteilen, dass nur die untersten beiden Segmente eines Bogen hoch belastet würden, könnte man erreichen, dass der Rundbogen mit der entsprechenden Stützlinie zusammenfällt. Im Prinzip zum gleichen Ergebnis würde man kommen, wenn man die Eigenlast des Bogens durch Veränderungen im Querschnitt des Bogens analog verteilen würde, d. h. minimaler Durchmesser des Bogens im Zentrum und maximaler Durchmesser in den untersten Abschnitten des Bogens.
Einige der Maßnahmen, mit denen die römischen Architekten den Spannungen in Gewölben, insbesondere in Kuppeln, begegnet sind, wirken ziemlich genau im eben beschriebenen Sinne. Nur erreichten sie die zielgerichtete Anpassung des Eigengewichts der Kuppeln in den unterschiedlichen Segmenten nicht durch Veränderungen im Querschnitt der Kuppeln, sondern durch gezielte Verwendung von Beton mit unterschiedlichem spezifischen Gewicht: Besonders leichter Beton im Zentrum von Kuppeln und besonders schwerer Beton in den peripheren Segmenten. Realisiert wurde das gezielte Variieren des Betongewichts durch die Beimengung unterschiedlich schwerer Bruchsteine. Für die Kuppelbereiche nahe dem Scheitelpunkt der Gewölbe wurden der Mörtelmasse extrem leichte Tuffsteine beigefügt (Gewicht etwa 0,7 km/dm3), in die Segmente nahe am Übergang zur den Mauerkronen Kalksteine von sehr hohem Gewicht (bis etwa 3,0 kg/dm3).273 Vor allem die extrem leichten Vulkangesteine waren allerdings nur in Italien, nicht in den entfernten Provinzen verfügbar. Um das Gewicht von Gewölben dennoch gezielt variieren zu können, wurden – wie gelegentlich in Rom
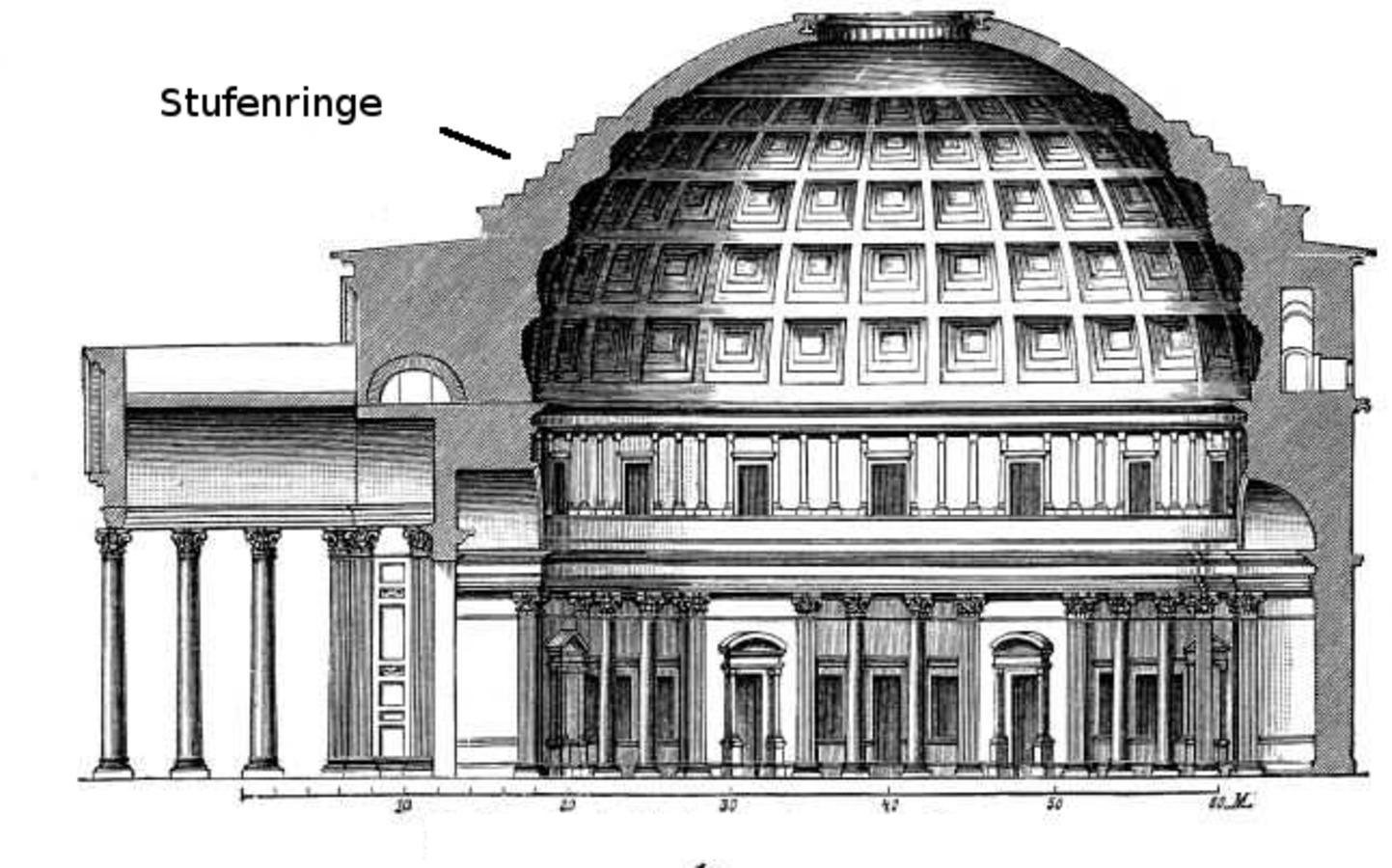
Abb. 3.27: Pantheon, Rom
Der eben beschriebene Effekt besonders schwerer Materialien im Bereich des Kuppelansatzes wurde noch weiter verstärkt durch Auflast, die dort platziert wurde: Die untersten Segmente einer Kuppel wurden oft zusätzlich belastet durch auf dem Kuppelansatz aufgemauerte sog. Stufenringe (Abb. 3.27). Dieses zusätzliche Gewicht leitet die im Gewölbe seitlich wirkenden Kräfte vertikal in die Mauern ab, und damit in die Fundamente. Noch zusätzlich verstärkt werden konnte diese Umlenkung der Kräfte dadurch, das die die Kuppel tragenden Mauern noch über den Ansatz der Kuppel hinaus fortgeführt wurden. Dabei entstehen zwischen diesem Teil der Außenmauern und dem Kuppelansatz Zwischenräume, die mit Bruchstein oder Beton verfüllt wurden. Beides, das Eigengewicht der überhöhten Mauer und das Gewicht der Füllmasse, wirkt dem Seitenschub entgegen. Alle hier angeführten Maßnahmen zur Schubkontrolle sind beim Bau des Pantheon angewandt worden. Moderne statische Analysen den Pantheon haben die Wirksamkeit dieser Maßnahmen nachgezeichnet und bestätigt.274 Optisch bewirken die zuletzt beschriebenen Maßnahmen allerdings, dass in der Außenansicht nur der obere, scheinbar flache Teil der Kuppel zu sehen ist, die im Inneren auf den ersten Blick vom Betrachter als Halbkugel erfasst werden kann. (Vgl. auch Abb. 3.28.)
Strebepfeiler
Dem Bogenschub mit konstruktiven Maßnahmen am Gewölbe selbst zu begegnen – Reduktion des Schubs durch Variieren des Materialgewichts und ,Umlenken‘ der Kräfte in die Vertikale, wie eben beschrieben – gehört zu den konzeptionell und materialtechnisch fortgeschrittenen Verfahrensweisen. Natürlich gab es auch einfachere Lösungen, die älter waren. Die einfachste von allen war, die Widerlager, d. h. die Mauern, so breit und fest zu bauen, dass sie dem Gewölbeschub standhalten konnten. Das war allerdings arbeitsaufwendig, und daher auch teuer. Eine ebenfalls einfache, konstruktiv aber effizientere Methode war, weniger massive Mauern durch vorgesetzte, zur Mauer hin geneigte Stützen abzusichern.275 Solche Mauerstützen waren aus anderen Kontexten seit langem bekannt. Vor allem Terrassenmauern und Futtermauern, die einen Hang gegen Abrutschen sichern sollten, wurden durch solche Mauerstützen gegen den Schub des Erdreichs gesichert. Bereits an einem der frühen Kuppelbauten mit großem Durchmesser, dem sog. Mercurtempel von Baiae

Abb. 3.28: Baiae
Mit dem Aufkommen der Thermen und der mehrschiffigen Basiliken ergab sich jedoch eine Problemstellung, die auf diese Weise nicht zu lösen war.276 Um die zentralen Räume mehrschiffiger Basiliken oder Thermen wirksam zu belichten, brauchte man eigene Fensteröffnungen für diese Räume, wenn die Mittelschiffe nicht nur indirekt, also durch die Fenster der seitlichen Räume, Licht erhalten sollten. Das war nur machbar, wenn die Seitenwände des Mittelschiffs noch höher aufgemauert wurden als der Ansatz der Dächer der Seitenschiffe, denn nur dann konnten in die oberen Abschnitte der Mauern eines Mittelschiffs Fenster eingefügt werden. Vereinfacht ausgedrückt: Wenn das Mittelschiff gleichsam zweigeschossig, die Seitenschiffe hingegen nur eingeschossig waren, dann ließen sich die Seitenschiffe durch Fenster im Untergeschoss, das Mittelschiff durch Fenster im Obergeschoss belichten. Das Prinzip kennt man von gotischen Kathedralen, und ähnlich auch von Kuppelbauten, bei denen die Kuppel von einem Tambour – einer runden Mauer – getragen wird, in den sich Fenster einfügen lassen.
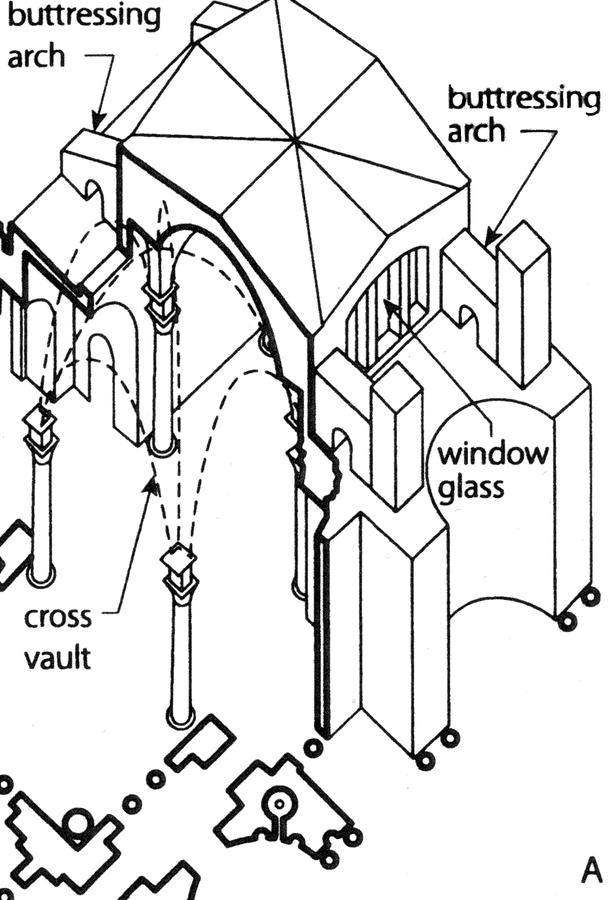
Abb. 3.29: Diocletiansthermen, Strebepfeiler (Lancaster 2008, Abb. 10.5).
Diese Bauweise wirft aber ein Problem auf, wenn das Mittelschiff mit einem Gewölbe überdeckt werden soll. Ohne zusätzliche konstruktive Maßnahmen müsste dessen Seitenschub vollständig von den oberen Bereichen der Seitenwände des Mittelschiffs aufgenommen werden, was wegen der Höhe überaus massive Seitenwände erfordern würde. Dem stünden jedoch gerade die Fenster in den oberen Abschnitten der Seitenwände entgegen, denn diese schwächen die Stabilität der Mauern. Auf der Abbildung 3.29 erkennt man, wie die Baumeister der Maxentius-Basilika dieses Problem gelöst haben: Als Widerlager gegen den Seitenschub mauerte man auf die Wände der Seitenschiffe Pfeiler auf, die durch Bogensegmmente mit den Wänden des Mittelschiffs verbunden wurden. Um den auf die Pfeiler durch das Bogensegment wirkenden Seitenschub als Druck in die Vertikale abzuleiten, überhöhte man die Pfeiler noch oberhalb des Ansatzes des Bogensegments (als buttressing arch rechts auf der Abbildung dargestellt). Kurzum, die Konstruktion folgt demselben Prinzip wie der Obergaden mit Fenstern und Strebewerk, den man von den gotischen Kathedralen kennt. Die Überhöhung der Pfeiler über den Ansatz des Bogensegments hinaus entspricht den Fialen des gotischen Strebewerks. Der Entwurf der Maxentiusbasilika zeigt somit, dass noch in der Spätantike substantielle konstruktive Innovationen entwickelt worden sind.
Eisenarmierungen zur Kontrolle von Horizontalschub
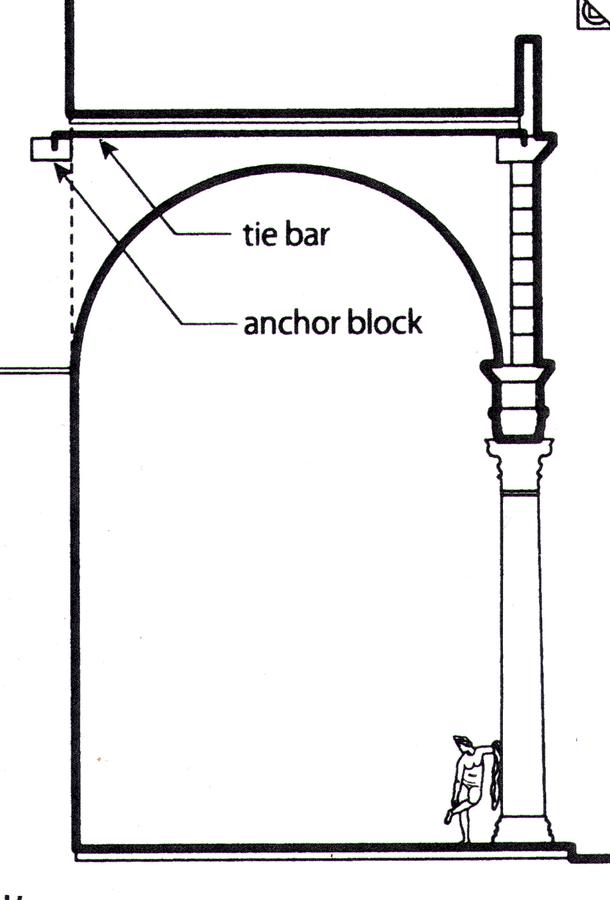
Abb. 3.30: Zuganker und Ankerblock (Lancaster 2005a, Abb. 105).
Diese Anker wurden zunächst, wie bei Stahlbeton, nur innerhalb des Betons oder Mauerwerks platziert. Das Problem, das diese Anker erforderlich machte, ergab sich beispielsweise bei der Verwendung von gewölbten Decken statt Balkendecken über Kolonnaden, deren Oberseite zudem als Wandelgänge genutzt werden sollten. Eine Kolonnade, die im Querschnitt aus einer (Rück-) Wand und einer äußeren Säulenstellung besteht, ist problematisch für eine Einwölbung, weil die Säulenstellung als eines der beiden Widerlager dem Horizontalschub wesentlich weniger entgegensetzen kann als die massive Mauer. Um die Säulenstellung von diesem Schub zu entlasten, verklammerte man die Säulen mit der Rückwand durch Eisenanker (s. Abb. 3.30). Auf seiten der Rückwand wurden die Eisen eingehakt in einen Ankerstein innerhalb der Mauer.277
Das Problem resultiert also letztlich daraus, dass man spätestens im frühen 2. Jh. n. Chr. zwei alternative Bautechniken, das Stütze-Gebälk-System der äußeren Säulenstellung und die Beton-Gewölbekonstruktion für die Decke, miteinander kombinierte. Die zweigeschossige griechische Stoa, der Vorläufer solcher Kolonnaden, war ein reines Stütze-Gebälk-System, bei dem die Frontsäulen das äußere Frontgebälk und die Innensäulen das Deckengebälk trugen.
Die Lösung, die Eisenanker oberhalb des Gewölbescheitels zu verbauen, ist technisch suboptimal, denn der Horizontalschub wirkt am Fuß des Gewölbes auf die Widerlager. Wesentlich wirksamer wäre es daher gewesen, mit den Eisenankern direkt die Widerlager, also das Kapitell und die Rückwand, zu verbinden, d. h. in der Weise, wie man es heute als Sicherungsmaßnahme von Gewölben und Säulenstellungen in alten Kirchen und Klosterbauten kennt. In dieser Konstellation ist der Eisenanker allerdings für den Betrachter sichtbar, was die Römer wohl zunächst zu vermeiden suchten. Noch in spätantiker Zeit haben aber auch schon die Römer zu dieser ästhetisch unbefriedigenden, technisch aber effektiveren Variante gegriffen.
3.7 Ingenieurbau
3.7.1 Die Fernstraßen

Abb. 3.31: Karte der römischen Fernstraßen (Wikipedia, A. Nacu).
Der Fernstraßenbau
Die Stadt Rom
Paradigmatisch für diese Zusammenhänge steht bereits das früheste der großen Straßenbauprojekte: Der Bau der Via Appia,280 der ,Königin der Fernstraßen‘
Am Bau der Via Appia lassen sich neben den politisch-militärischen Hintergründen zugleich auch die in technischer Hinsicht charakteristischen Merkmale des römischen Fernstraßenbaus
Die Motive und Techniken der römischen Planer für solche linearen Trassen sind mangels einschlägiger Quellen nicht direkt klärbar. Sicherlich hatte eine Streckenführung, die zwei Orte auf dem kürzesten Weg verband, prinzipiell den Vorteil, den Materialverbrauch für Fundamente und Straßenbelag
Die bautechnischen Probleme der linearen Trassenführung illustriert die Appia bereits in ihren ältesten Abschnitten. Südlich der Albaner Berge, etwa 32 km vor Terracina

Abb. 3.32: Via Ostiense. Römisches Strassenpflaster (W. Osthues).
Die zunächst fast dogmatisch verfolgte lineare Streckenführung – ohnehin nicht überall realisierbar wie etwa bei den Alpenstraßen
Die ursprüngliche Bauweise der Appia, wie sie einige Querschnitte zeigen, bestand über dem Untergrund, also dem anstehenden Boden, der in der Breite der Straße ausgehoben und eingeebnet worden war, aus einem Unterbau aus einer Schicht Schotter, der möglichst nahe bei der Baustelle gewonnen und mit Erde vermischt wurde, und einem Oberbau aus einer etwas weniger starken Schicht aus feinerem Schotter und Kalksteinbruch. Beide Schichten waren eingefasst von Reihen großer Steine. Ein Pflaster als Fahrbahnbelag (ähnlich wie auf (Abb. 3.32) hatte die Appia ursprünglich nicht. Erst 189 v. Chr., also knapp eineinhalb Jahrhunderte nach Baubeginn, wurde ein kurzer Abschnitt von weniger als einer Meile vor der römischen Stadtgrenze gepflastert, wie Livius
Was für die ursprüngliche Bauweise der Appia gilt, dürfte auch für die meisten anderen römischen Fernstraßen
Von der normalen Bauweise abweichende Konstruktionen wurden angewandt, wenn der Untergrund Probleme bereitete. War der Boden besonders weich, wurden zunächst Holzpfähle in den Boden gerammt, die anschließend mit grobem Schotter überdeckt wurden, auf dem dann der weitere Schichtaufbau erfolgte. Nicht selten wurden auch Straßen direkt durch Moore und Sümpfe gebaut. Wenn kein Damm aufgeschüttet wurde, wurde zunächst eine Unterkonstruktion komplett aus Holz aufgebaut, wie man sie aus dem römischen Germanien
Zur Ausstattung des Fernstraßennetzes
Die Verwaltung des Straßensystems war auf Basis des rechtlichen Status der Straßen
3.7.2 Brücken
Der Pons Sublicius gibt zudem einen weiteren Aspekt des römischen Brückenbaus vor: Die Brücke diente einerseits der Anbindung des rechten Tiberufers an die Stadt, andererseits hatte sie militärische Bedeutung, denn sie sollte den Janiculus-Hügel sichern helfen, der entsprechend etwa zeitgleich befestigt wurde, um feindlichen Truppen die dort günstige Angriffsposition auf die Stadt zu verwehren. Der militärischen Bedeutung der Brücken entsprechend, sind später viele von ihnen, wie auch die zugehörigen Straßen, von Militäringenieuren entworfen und von den Legionen gebaut worden.
Die im voraufgehenden Abschnitt schon angesprochene militärische und auch wirtschaftliche Bedeutung des Straßensystems, dem die Brücken zuzurechnen sind, dürfte schon für sich genommen hinreichend erklären, warum die Römer jahrhundertelang bereit waren, die enormen Kosten für diese Projekte zu tragen. Gleichwohl sollte man aber nicht übersehen, dass es noch ein drittes Motiv gab, das beim Brückenbau häufiger Bedeutung gehabt haben dürfte: Die Brücken sollten Rom
Schon die Expansion Rom
Elementare Kenntnisse und Techniken dürften die Römer vor allem von den Etruskern gelernt haben, was sich im Detail jedoch schlecht belegen lässt. Eine große Zahl von zu lösenden technischen Problemen des Brückenbaus stellte sich den römischen Ingenieuren aber erstmals, und die Lösungen, die sie entwickelten und realisierten, blieben fast tausend Jahre lang 'state of the art'. Für das Können der römischen Ingenieure spricht nicht zuletzt, dass eine nennenswerte Zahl ihrer Brücken bis in die Neuzeit erhalten geblieben sind. Einige sind sogar für den Autoverkehr genutzt worden, d. h. sie haben Belastungen standgehalten, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung noch nicht einmal denkbar waren. Innerhalb der gesamten Baugeschichte lassen sich nur sehr wenige Bauten anführen, die eine vergleichbare Nutzungsdauer erreicht haben.
Die Balkenbrücke aus Holz dürfte die konstruktiv einfachste und historisch älteste Form der Brücke sein. Auch die Römer haben diese Brückenform verwendet, nur ist darüber aufgrund der mangelnden Erhaltung des Materials wenig bekannt. Es gibt nur eine Balkenbrücke, deren Konstruktion genauer bekannt ist, nämlich die schon erwähnte Rheinbrücke Caesars
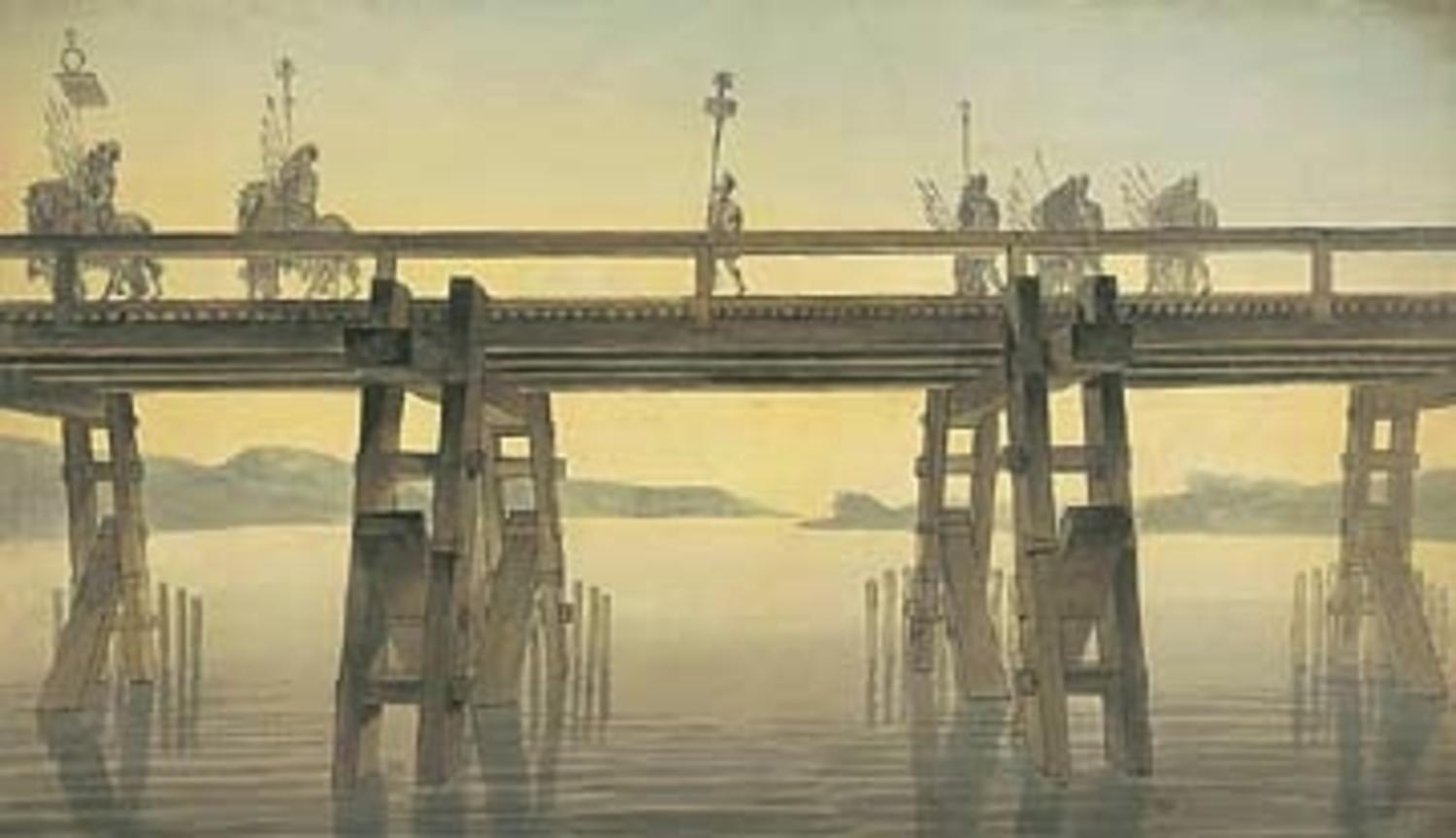
Abb. 3.33: Rheinbrücke Caesars
Es geht aus Caesars

Abb. 3.34: Eurymedon-Brücke bei Selge
Die Brücke wurde nach Beendigung der Expedition auf das rechtsrheinische Gebiet von den Truppen wieder abgerissen. Eine weitere Pfahljochbrücke war beispielsweise die 17 v. Chr. errichtete, erste Moselbrücke bei Trier

Abb. 3.35: sog. Pont Julien bei Bonnieux
Der Bau von Brücken aus Natur- oder Kunststein (Beton, Ziegel) erforderte aufgrund der fundamental verschiedenen Materialeigenschaften grundsätzlich andere Konstruktions- und Bautechniken als der Bau von Brücken aus Holz. Bei diesen, wie der beschriebenen Pfahljochbrücke, werden die Balken Biege- und Zugspannungen ausgesetzt. Holz war das einzige für die Römer verfügbare Baumaterial, das solche Spannungen in nennenswertem Umfang aufnehmen kann. Ziegel im Mörtelverbund, Naturstein und Beton können jedoch, wie im vorhergehenden Kapitel bereits ausgeführt, nur in geringem Umfang auf Zug belastet werden. Daher sind alle römischen Steinbrücken Bogenbrücken, denn bei allen Formen der Bogenkonstruktion treten kaum Zugspannungen auf. Stattdessen entstehen starke Druckspannungen, die von Stein im hohem Maße aufgenommen werden können. Einen Teil der erforderlichen Bau- und Konstruktionstechniken konnten die römischen Ingenieure aus dem Hochbau übernehmen. Das gilt für den gesamten Bereich der Steintechnik, und insbesondere für die Konstruktion von Bogen, die – wie im Hochbau – in der Regel, aber nicht immer, als Halbkreis angelegt wurden.
Im einfachsten Fall, wie beispielsweise bei der Eurymedon-Brücke (Abb. 3.34) bei der antiken Stadt Selge
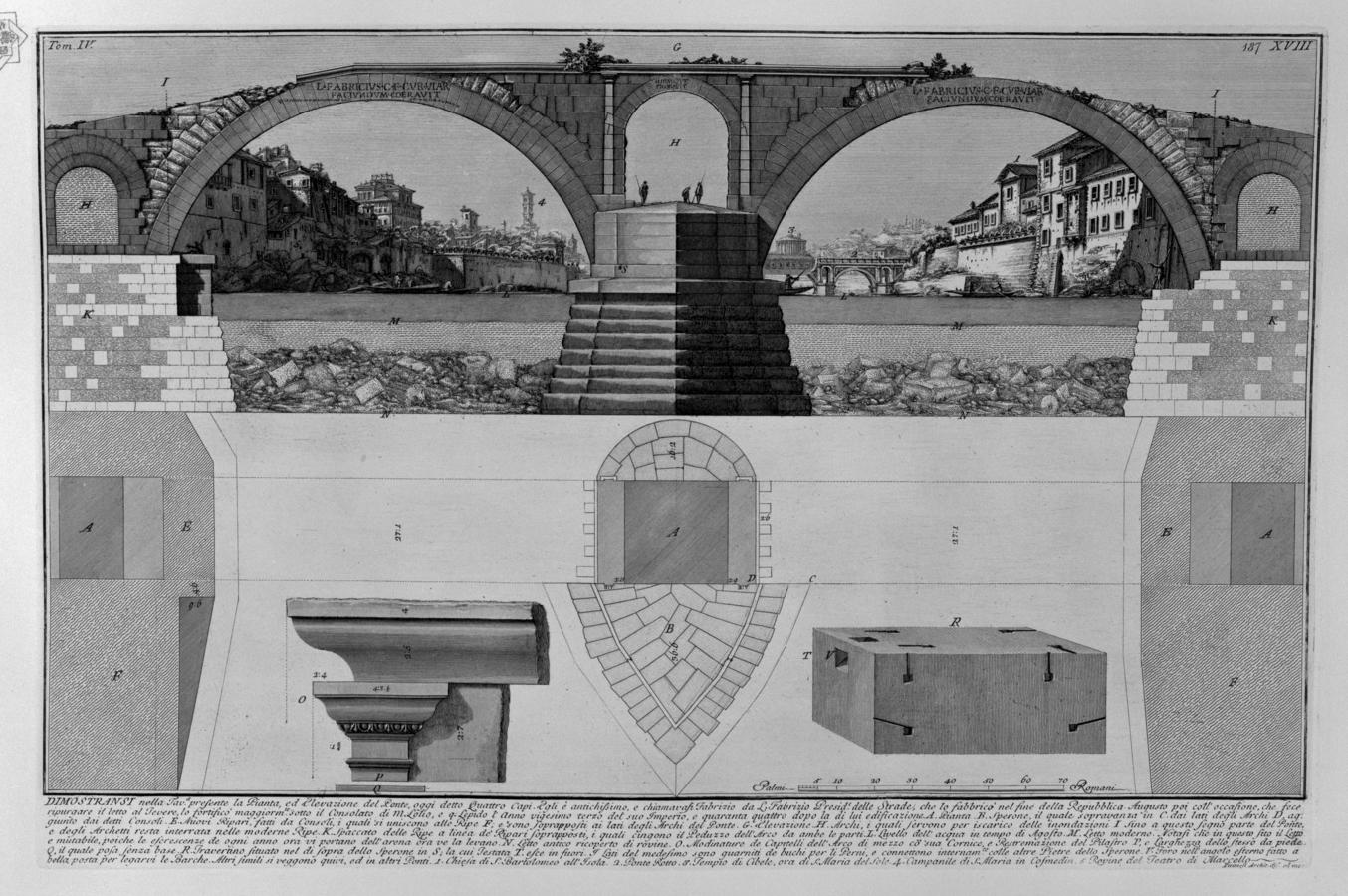
Abb. 3.36: Pons Fabricius, Rom
Wo möglich, überspannten die Römer Flüsse bei Steinbrücken mit einem einzigen Bogen, um die Gründung von Pfeilern im Flussbett zu vermeiden. Diese Vorgehensweise hatte allerdings konstruktionsbedingte Nachteile: Bei der üblichen Ausbildung der Bogen als Halbkreis liegt der Scheitel des Bogens in halber Höhe der überbrückten Spannweite, d. h. je größer die Spannweite des Bogens, umso höher liegt die Fahrbahn über dem Wasserspiegel. Im Flachland erfordert der Zugang zum Scheitelpunkt der Brücke folglich mehr oder weniger steile Rampen, die vor allem den Schwerlasttransport mit Wagen erheblich behindern. Das Problem veranschaulicht etwa der 3 v. Chr. erbaute Pont Julien im südfranzösischen Departement Vaucluse
Diese hervorragend erhaltene Brücke, die bis 2005 für den öffentlichen Verkehr genutzt wurde, illustriert einige spezielle Konstruktionsmerkmale, die für den römischen Steinbrückenbau typisch sind. Viele südeuropäische Flüsse führen im Sommer relativ wenig Wasser, können aber – wie nicht zuletzt der Tiber in Rom
Dem Problem des Wasserdruck bei Hochwasser auf die stromaufwärts gewandte Seite der Brücken zu begegnen, war hingegen eine spezifische Problematik des Brückenbaus, für die die Ingenieure verschiedene Lösungen entwickelt haben. Beim Pont Julien kam nur eine davon zur Anwendung: der Bau von Durchlässen auch bei den Teilen der Brücke, die normalerweise nicht vom Wasser erreicht wurden. Diese Durchlässe, die die Zwickel zwischen den Bögen bei Hochwasser vom Wasserdruck entlasteten, sind typisch römisch. Schon die älteste sicher datierbare, römische Steinbrücke, der teilweise erhaltene Pons Aemilius in Rom
Zu den technisch anspruchsvollen Aufgaben, denen sich die römischen Ingenieure gestellt haben, zählt die standsichere Gründung von Pfeilern im Wasser, wenn die Flüsse zu breit waren, um mit nur einem Bogen überspannt zu werden. Vitruv
Vitruv
Eine dritte, von Vitruv
Die Römer dimensionierten, im Vergleich zu modernen Konstruktionen, ihre Brückenpfeiler ausgesprochen massiv. Das dürfte bei im Wasser aufgerichteten Pfeilern unter anderem dazu gedient haben, dem Wasserdruck in der ersten Bauphase zu begegnen, in der die Pfeiler noch unverbunden nebeneinander standen, sich also noch nicht wechselseitig stabilisieren konnten (ähnlich einer Säulenstellung, die ohne Gebälk wesentlich instabiler ist als mit). Auch bei der Dimensionierung der Bogen waren die römischen Ingenieure sehr konservativ: In der Regel lag das Verhältnis zwischen der Höhe der Keilsteine des Bogens und der freien Spannweite bei etwa 1 : 20, obwohl bei entsprechendem Steinmaterial und präziser Zurichtung der Keilsteine auch sehr viel schwächer dimensionierte Bogen unproblematisch waren (bis 1 : 35301). Diese Relationen zeigen, nebenbei bemerkt, trotz ihrer meist relativ konservativen Werte deutlich die Überlegenheit des Bogens gegenüber in Stein ausgeführten Stütze-Gebälk-Konstruktionen, die etwa beim Tempelbau kaum über 1 : 4 hinausgingen beim Verhältnis von Balkenbreite zu freier Spannweite.
Waren die Pfeiler hochgezogen und die Bogen fertiggesellt, wurde die Konstruktion weiter stabilisiert, indem die Zwischenräume zwischen den Bogen eingeschalt und verfüllt wurden. Diese Füllungen hatten konstruktive Funktion nicht nur als Basis der Fahrbahn, denn die Masse in den Zwickeln (und nicht im Scheitel) wirkt als selektive Auflast nur auf die unteren Abschnitte der Bögen. Der Druck dieser Masse blockiert das mögliche Aufspreizen der Bögen am Fuß durch den Bogenschub, oder einfacher gesagt: die Masse zwingt die unteren Abschnitte der Bögen, ihre Form beizubehalten, statt in die Breite auszuweichen, was zum Einsturz führen würde. Der Gedanke liegt vor diesem Hintergrund nahe, dass die oben beschriebene, an Kuppeln angewandte Methode, den Seitenschub am Kuppelansatz durch selektive Auflast an ihrem unteren Rand nach unten abzuleiten (Stufenringe und Verfüllungen), aus dem Brückenbau stammt, denn bei Bogenbrücken ergibt sich das Prinzip der selektiven Auflast gleichsam von selbst, da die Zwickel zwischen den Bögen verfüllt werden mussten, um eine horizontale Fahrbahn zu ermöglichen. Damit tragen die unteren Abschnitte der Bögen stets erheblich mehr Auflast als die Scheitel der Bögen, was eine selektive Lastverteilung darstellt.
Neben den Strategien zur Bewältigung der konstruktiven Anforderungen lässt der Brückenbau der Römer auch das Bemühen um die Begrenzung der Baukosten erkennen. Das gilt etwa für mehrbogige Brücken, bei denen Paare von Bögen, oder auch alle Bögen, denselben Radius hatten, denn in diesem Fall ließ sich ein Lehrgerüst umsetzen bzw. mehrfach verwenden, wodurch Arbeitszeit und Holz eingespart werden konnte. Dasselbe gilt für die unverzahnt nebeneinandergestellten Keilsteine bei den Bögen des Pont du Gard (Abb. 3.21), wie schon im Zusammenhang mit den Lehrgerüsten erwähnt.

Abb. 3.37: Brücke von Alcantara
Unter den erhaltenen römischen Bogenbrücken gehört die Brücke von Alcantara
An allen bisher angesprochenen Brücken haben die Bögen die Form eines Halbkreises. Die Aussage der älteren Fachliteratur – die man gelegentlich immer noch lesen kann303 –, dass das bei allen römischen Brücken der Fall gewesen wäre, ist jedoch unzutreffend. Die Römer haben sehr wohl auch Brücken gebaut, bei denen die Bogen ein Kreissegment von weniger als 180° bilden, bzw. bei denen die Pfeilhöhe kleiner ist als der Radius der Bögen. Solche sog. Segmentbogenbrücken haben unter bestimmten Umständen eine Reihe von Vorteilen, verhalten sich aber auch statisch anders als die Brücken mit Halbkreisbogen.
Bei halbkreisförmigen Bogen in flachem Gelände liegt der Scheitelpunkt des Bogens bzw. der höchste Punkt der Fahrbahn stets deutlich höher als Anfang und Ende der Fahrbahn, oben am Beispiel des Pont Julien und seiner langen Rampen dargestellt. Eine Segmentbogenbrücke ist demgegenüber insofern vorteilhaft, als sie per se flacher ist, und daher weniger lange, oder auch gar keine Rampen erfordert. Dieser Vorteil kommt umso mehr zum Tragen, je größer die zu überbrückende Spannweite ist, denn je größer die Spannweite, desto höher liegt der Scheitelpunkt des Halbkreisbogens. Ein weiterer Vorteil der Segmentbogenbrücke ist die Materialersparnis, denn ein Bogensegment von weniger als 180° ist bei gleicher Spannweite stets kürzer als ein Halbkreis.
Statisch gesehen unterscheidet sich die Segmentbogenbrücke erheblich von den Brücken mit halbkreisförmigen Bogen. Während bei letzteren bei entsprechend verteilter Auflast fast ausschließlich Druckspannungen erzeugt werden, die vertikal in die entsprechend starken Fundamente abgeleitet werden müssen, ergeben sich bei Segmentbogen starke horizontale Schubspannugen, die von Widerlagern an den beiden Enden der Brücke aufgefangen werden müssen. Je flacher der Bogen, desto größer der Horizontalschub, womit der Druck auf die Pfeiler zugleich entsprechend abnimmt, die deshalb auch geringer dimensioniert werden können. Der Brückenbogen wird – bildlich gesprochen – gleichsam eingeklemmt zwischen die Widerlager, statt auf die Pfeiler zu drücken.

Abb. 3.38: Brücke von Alconetar
Das Prinzip der Segmentbogenbrücke war bereits in Griechenland
Unter den wenigen bekannten Mischkonstruktionen aus Holz und Stein nimmt die Traiansbrücke eine besondere Stellung ein. Sie überbrückte die untere Donau nahe des Eisernen Tores bei Turnu Severin
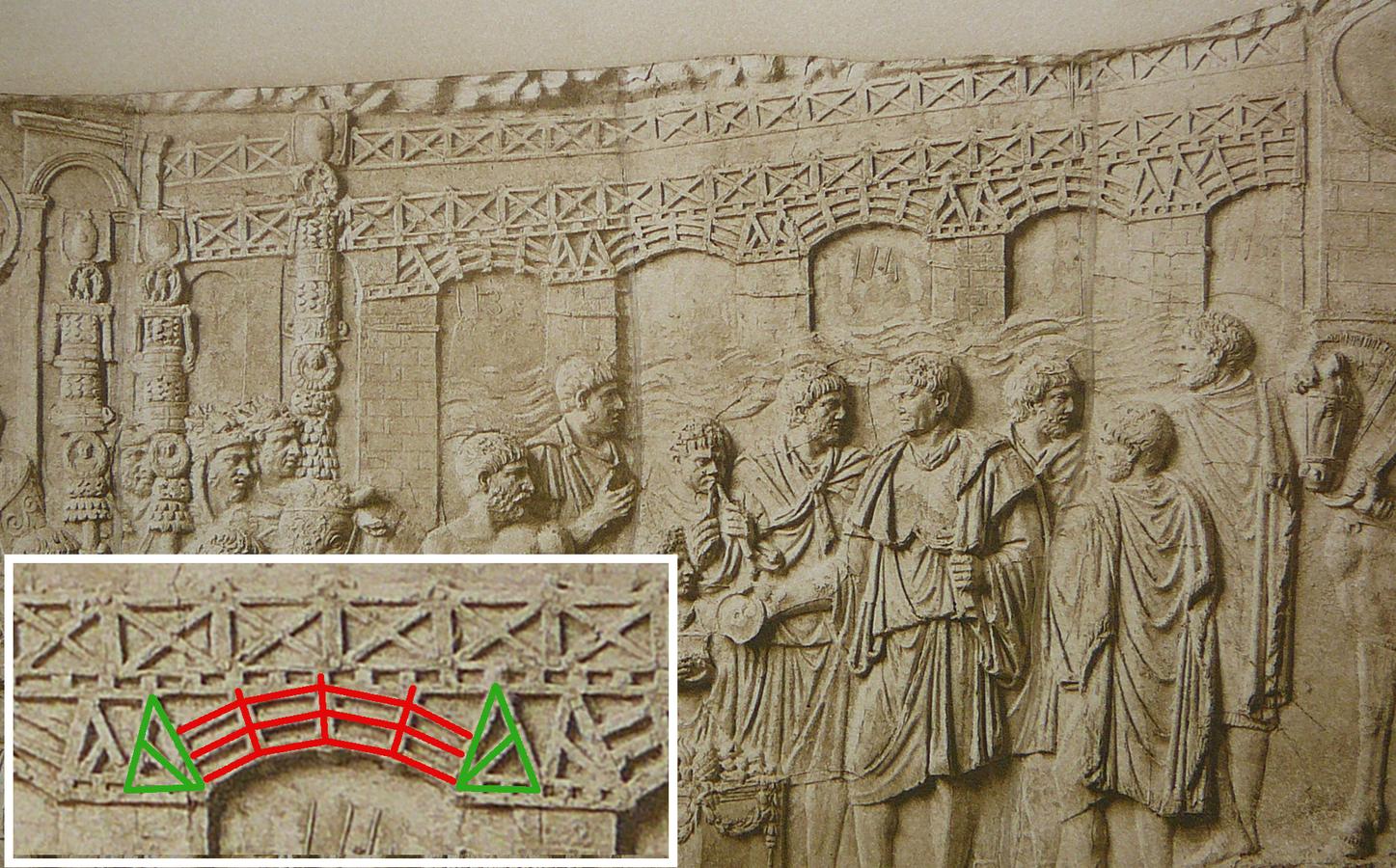
Abb. 3.39: Darstellung der Traiansbrücke, erbaut 103–105 v. Chr., auf einem Relief der Trianssäule in Rom
Die Brücke war etwa 1135 m lang und ruhte auf 20 Pfeilern. Die Gesamthöhe der Brücke betrug nach den antiken Angaben etwa 45 m, die lichte Weite der Bogensegmente ca. 50 m. Die Spannweiten waren damit deutlich größer als bei Steinbrücken mit Spannweiten von maximal ca. 37 m.
Die Außenschale der Pfeiler war aus großen Steinen, verlegt als opus quadratum, hergestellt. Das Innere wurde mit Gussbeton gefüllt, für dessen Herstellung Puzzolana herangeschafft worden war. Das Tragwerk und die Fahrbahn waren aus Holz in Fachwerktechnik errichtet. Das Relief zeigt einerseits in der Ansicht das Tragwerk als jeweils drei über einander gestaffelte Segmentbogen, andererseits in perspektivischer Aufsicht die Fahrbahn, die von zwei Kastenträgern, ausgesteift mit Andreaskreuzen, eingefasst wird. Das Tragwerk selbst (Abb. 3. 39 unten links) bestand aus polygonalen Sprengwerken, die sich an den Seiten teils an dreieckigen, ausgesteiften Böcken abstützten, teils an den unter den Böcken liegenden Bohlenkästen.308 Die Böcke wurden oben durch die darübergelegten Kastenträger in Position gehalten.
3.8 Die Architekten
3.8.1 Begriff
3.8.2 Tätigkeitsspektrum
EOAindexArchitekt!Aufgabenspektrum des ArchitektenDas Aufgabenspektrum der Architekten umfasste zunächst den normalen Tätigkeitsbereich beim Bau öffentlicher und anspruchsvoller privater Gebäude. Bauen war jedoch keine Vorbehaltsaufgabe der Architekten. Wie für alle anderen antiken Kulturen, ist auch für Rom
Ein weiterer Bereich, in dem Architekten gearbeitet haben, ist die Stadtplanung
Ein weiteres Teilgebiet, das ohne Zweifel zum Aufgabenspektrum
Auch im Bereich der Materialgewinnung waren Architekten tätig, und zwar nicht nur punktuell, d. h. im Kontext der Auswahl des Materials für einzelne Projekte. Man kennt die Namen einiger Architekten, die offenbar dauerhaft in Steinbrüchen beschäftigt waren. Letzteres erklärt sich wahrscheinlich dadurch, dass in antiker Zeit aus Steinbrüchen oft nicht wie heute einfach Blöcke mit Standardmaßen herausgebrochen wurden, sondern der Stein für seine Verwendung am Bau vorbearbeitet wurde. Der jeweilige Stein musste den funktionellen Anforderungen entsprechen – z. B. bei der Verwendung als monolither Säulenschaft oder Architrav – und vorbearbeitet werden, um das Transportgewicht bei schweren Baugliedern zu reduzieren.
Schließlich gehörten zum Aufgabenspektrum
Angesichts dieses für moderne Begriffe außerordentlich umfangreichen Aufgabenspektrums und der erforderlichen, entsprechend breiten Qualifikationsanforderungen stellt sich die Frage, inwieweit ein einzelner Architekt tatsächlich in allen oder annähernd allen diesen Teildisziplinen ausgebildet und tätig war, bzw. umgekehrt die Frage nach der Spezialisierung. Eine Antwort darauf fällt vor allem deshalb schwer, weil die Quellen und das epigraphische Material zu den über einhundertfünfzig namentlich bekannten Architekten fast nie die Rekonstruktion eines Oeuvres, einer Berufsbiographie oder einer Karriere zulassen. Das hängt zunächst damit zusammen, dass nach römischer Auffassung prominente Bauwerke dem verantwortlichen Beamten zuzuschreiben waren, auch wenn er keine eigenen Mittel zusätzlich zum bereitgestellten Budget einschloss, und nicht dem planenden oder bauleitenden Architekten. Diese Auffassung spiegeln die Namen der Bauwerke (Basilica Aemilia, Via Appia etc.), die Bauinschriften, und auch die Schriftquellen wider. Es ist bezeichnend, dass Frontinus
Trotz der in dieser Hinsicht sehr aussagearmen Quellenlage lässt sich aber immerhin punktuell die oben gemachte Aussage belegen, dass es keine durchgängige Trennung zwischen den gleichsam klassischen und den ingenieurtechnischen Aufgaben gegeben haben kann. Dafür spricht vielleicht weniger Vitruv
Ebenfalls kaum Material gibt es für die von der modernen Forschung häufiger aufgeworfene Frage nach der möglichen Trennung von entwerfenden und bauleitenden Architekten. Vieles spricht aus sachlichen Gründen für die Annahme, dass zumindest bei den erkennbar einheitlich gestalteten Großprojekten wie den Kaiserforen ein Architekt den Gesamtplan entworfen hat, dessen Ausführung von mehreren Architekten auf den einzelnen Baustellen überwacht und geleitet wurde. Auf der anderen Seite ist es jedoch fraglich, ob gerade bei umfangreicheren Projekten eine vollständige Trennung zwischen Entwurf und Bauleitung überhaupt möglich war, denn diese Trennung würde voraussetzen, dass der Entwurf vor Baubeginn vollständig ausgearbeitet vorlag in Form von bemaßten Zeichnungen und Musterstücken für die Bauornamentik. Nachweisbar ist das nicht. Es ist daher m.E. einigermaßen wahrscheinlich anzunehmen, dass Details erst im Baufortschritt festgelegt wurden, und dass, wenn denn Entwurf und Ausführung in getrennten Händen lagen, der bauleitende Architekt zumindest Details in eigener Verantwortung festlegte.
3.8.3 Formen der Berufsausübung und sozialer Status
Die Tätigkeit als Architekt war zwar an sich an keinen personenrechtlichen Status gebunden. Architekten lassen sich in allen entsprechenden Kategorien nachweisen, als Sklaven, Freigelassene, Fremde ohne Bürgerrecht und römische Bürger. Selbst Angehörige des Ritterstandes und der Senatsaristokratie waren als Architekten tätig, und sogar Kaiser wie Hadrian
Selbständige Architekten mit römischem Bürgerrecht, die 'freiberuflich' tätig waren, ohne ein eigenes Unternehmen zu führen, kennt man beispielsweise aus den Briefen des jüngeren Plinius
Wesentlich schlechter in den Quellen auszumachen sind freigeborene Architekten, die ein inhabergeführtes Bauunternehmen betrieben haben. Es gibt beispielsweise den sicher ungewöhnlichen, aber bemerkenswerten Fall eines Architekten, der in seinem Grabbau ausdrücklich auch die Bestattung seiner Freigelassenen vorgesehen hatte.327 Es ist aber keineswegs klar, dass damit die Mitarbeiter seiner Firma gemeint waren, denn genausogut könnten die Mitglieder des Hausgesindes gemeint gewesen sein. Auch im Fall des oben erwähnten Haftungsproblems, das im Verres-Prozess angeführt wurde, ist Ciceros
Spätestens ab dem 2. Jh. v. Chr. arbeiten auch Fremde ohne römisches Bürgerrecht, vor allem aus dem hellenistischen Osten, als Architekten in Rom
Sklaven und Freigelassene (also ehemalige Sklaven) lassen sich unter den Architekten für alle Phasen Rom
Die quantitative Verteilung der Architekten auf die verschiedenen personenrechtlichen Kategorien ist schwer zu bestimmen. Eine Zusammenstellung auf Basis von Grabinschriften334 listet für Rom
Jenseits der Privatwirtschaft in öffentlichen Institutionen dauerhaft beschäftigte Architekten lassen sich meist nur im griechischsprachigen Osten nachweisen, wo die Wahl oder vertragliche Anstellung von Architekten in Stadtverwaltungen oder Heiligtümern eine lange Tradition hatte.335 Es wird solche ,Planstellen‘ gleichwohl auch in Rom
Die mit Abstand sicher größten Arbeitgeber von Architekten in der Kaiserzeit waren ohne Zweifel das Kaiserhaus und das Militär.337 Die römischen Legionen hatten bereits eigene Architekten, als sie in republikanischer Zeit noch ein reines Milizheer waren. Überliefert sind allerdings nur die Namen von Vitruv
Eine nicht geringe Anzahl dieser Architekten des kaiserzeitlichen Heeres ist namentlich bekannt vor allem durch lateinische Grab- oder Votivinschriften. Für sie kennt man den Terminus architectus ordinatus.340 In den Digesten haben sie den besonderen Status des immunus, was bedeutet, dass sie zur Gruppe der Spezialisten gehörten, die von den Lasten des normalen Soldatendienstes befreit waren.341 Es gab aber auch, wie wohl schon im republikanischen Milizheer, Architekten, die im Heer auf Honorarbasis tätig waren, worauf der ebenfalls inschriftlich bezeugte Terminus architectus salariarius hinweist, denn ein Legionsangehöriger bezog ein stipendium, kein salarium.342 Auf diese Weise konnte die Armee auch auf Fremde ohne Bürgerrecht zurückgreifen. Zu diesen zählen wohl auch die schon erwähnten Architekten, die in von Legionen betriebenen Steinbrüchen die technische Leitung hatten. Noch der letzte inschriftlich bekannte Architekt der Antike war ein Festungsbaumeister.343
Architekten des Kaiserhauses344 sind aus zwei Quellen bekannt. Zum einen kennt man die Architekten, die offenbar zum Stab einiger Kaiser des 1. und 2. Jh. n. Chr. gehörten. Sie dürften weitgehend für die Großprojekte der Kaiser fachlich verantwortlich gewesen sein. Zu nennen sind Severus
In nicht geringer Zahl bekannt sind jedoch auch Architekten, die in untergeordneter Position für das Kaiserhaus gearbeitet haben. Viele von ihnen sind durch Grabinschriften identifizierbar, die am Namen die Freilassung durch das Kaiserhaus erkennen lassen. Es handelt sich bei ihnen entweder um fachlich qualifizierte Sklaven, die vom Kaiserhaus angekauft worden waren, oder aber um Sklaven, die ihre Ausbildung innerhalb der Kaiserhauses erhalten haben,348 also wohl in den Opera Caesaris. Genaueres über ihre Arbeit ist kaum bekannt. Vermuten kann man, dass im Kaiserhaus die Freilassung von Architekten nach einer bestimmten Anzahl von Arbeitsjahren üblich war.
Die wirtschaftliche Situation der römischen Architekten war, wie aus der Bandbreite der dargestellten Formen der Beschäftigung und des personenrechtlichen Status bereits deutlich geworden sein dürfte, ausgesprochen heterogen. Sie reichte vom Sklaven, der nach römischem Recht selbst Sache war und formal keinen eigenen Besitz haben konnte, vereinzelt bis zum Beamten mit prestigeträchtiger öffentlicher Stellung. Dass Architekten auch ohne besondere Umstände einigen Wohlstand erreichen konnten, zeigen manche Grabbauten, die Architekten für sich selbst entworfen haben oder für Freunde errichtet haben. Die Tätigkeit als Architekt an sich hatte demnach auch keinen klar definierten Prestigewert. Es darf geradezu als soziales Paradoxon angesehen werden, dass in einer Funktion, die von Sklaven ausgeübt werden konnte, und noch dazu aus dem Handwerk stammte, auch Angehörige der obersten Schicht öffentlich aufgetreten sind.
3.9 Das Bauwissen: Quellen, Tradierung und Entwicklung
3.9.1 Die Quellen des Wissens
Eine weitere maßgebliche Quelle für das Bauwissen
Die dritte wesentliche Quelle für die Entwicklung der römischen Architektur und das dort angewandte Bauwissen
In den folgenden Abschnitten sollen einige Aspekte der Entwicklung des Bauwissens
3.9.2 Existenzformen des Wissens und Tradierung
Die Ausbildung der Architekten und Ansätze zur Institutionalisierung der Ausbildung
Ausbildung in praktischen Berufen fand in der Antike lange Zeit hauptsächlich innerhalb von Familien statt, so dass das Fachwissen unter den Generationen weitergereicht wurden. Dass das auch in Rom
Zu den gentes, die länger im Bauwesen aktiv waren, zählt die Familie der Cossutier
Zu den römischen Familien, in denen mindestens ein Angehöriger gelernter Architekt war, und sich zudem auch wenigstens ein freigelassener Architekt nachweisen läßt, gehören die Postumier. C. Postumius Pollio
Auch die Familie Vitruv
Die Ausbildung zum Architekten
Ansätze zu einer Institutionalisierung der Architektenausbildung
Über staatliche Institutionen, in denen Architekturwissen entwickelt oder weitergegeben wurde, ist nahezu nichts bekannt. Für die republikanischer Zeit kann man die Existenz solcher Institutionen nahezu mit Sicherheit ausschließen – Vitruv
So wurde das Lehrgeld, das trotz der vom Lehrling sicher erbrachten Zuarbeit relativ hoch gewesen sein muss, beschränkt, indem das Maximalpreisedikt Diocletians von 301 n. Chr. das Lehrgeld bei einem architectus magister auf hundert Denare pro Schüler und Monat festsetzte.360 Der Begriff scheint darauf hinzudeuten, dass es zumindest in dieser Zeit Architekten gab, die die Ausbildung
Ansonsten ist die einzige staatliche Institution, die in irgendeiner Form die Architektenausbildung selbst betrieben und zumindest in Ansätzen systematisch organisiert haben dürfte, das Militär gewesen. So ist bei der Rheinarmee ein Legionär ausgebildet worden, der auf einer Bauinschrift für sich den Status eines architectus discens angibt,365 also offenbar eine vom Organisationsplan vorgesehene Ausbildungsposition bekleidete. Details zu dieser Ausbildung fehlen allerdings leider vollständig.
Griechische Architekten in Rom
Die für die römische Architekturentwicklung überaus folgenreiche Arbeit griechischer Architekten in der Stadt und in den von ihr kontrollierten Territorien lässt sich nicht isoliert betrachten und verstehen. Sie ist Teil einer umfassenden Rezeption und Übernahme der Kultur des hellenistischen Ostens, die zu Beginn des 2. Jhs. v. Chr., in der Zeit nach Ende des zweiten punischen Krieges bzw. des Hannibalkrieges, ihren Anfang nahm. Zuvor hatte es allerdings nahezu alle politisch und militärisch relevanten hellenistischen Staaten als eigenständige Akteure ausgeschaltet und ihrer Unabhängigkeit beraubt: zunächst das Reich Hierons II.
Rom
Die Offenheit der Römer für die hellenistische Kultur führte im 2. Jh. dazu, dass nicht nur die Kunstwerke, sondern auch die Künstler selber, sowie auch Intellektuelle und Ärzte, und nicht zuletzt Architekten, nach Rom
Die Tätigkeit griechischer Architekten in Rom
Wie eingangs dieses Kapitels erwähnt, spielten bei dem erforderlichen Wissenstransfer unterschiedliche Medien eine Rolle. Der schnellste, effizienteste und zuverlässigste Weg, das erforderliche Know-how nach Rom
Hermodoros
Noch später wird Hermodoros
Die schon wiederholt angesprochenen griechischen Architekten aus spätrepublikanischer Zeit, die Cicero
Auch in der Kaiserzeit lassen sich in Rom
Die Tätigkeit von Architekten aus dem griechischsprachigen Reichsteilen in Rom
3.9.3 Die Bedeutung von Schriften für die Tradierung von Bauwissen
Lateinische Architekturschriften jenseits des Werks von Vitruv
Die Tatsache, dass außer der Schrift Apollodors
Die Rezeption von Vitruv
Zur praktischen Bedeutung von Vitruvs de architectura
Vitruv
Hinweise darauf, dass ein Lehrbuch für die Ausbildung von Architekten von irgendeiner Seite als Desiderat angesehen wurde, etwa von Augustus
Um seinem Buch praktischen Wert für Architekten zu geben, stellt Vitruv
Im Bereich der Entwurfsarbeit gibt er für die sogenannten optischen Korrekturen nicht nur deren Begründung und allgemeine Grundsätze an, sondern auch konkrete Korrekturfaktoren, nach denen etwa die Höhe von Gebälken in Abhängigkeit von der absoluten Größe errechnet werden soll, oder Winkel geändert werden sollen. Vitruv
Während die angesprochenen Konzepte für die Entwurfsarbeit dem übergeordneten Ziel der Schönheit der Gebäude zuzuordnen sind, gibt Vitruv
Kurz gesagt: Vitruv
Zu den immanenten Gründen gehört in gewissem Umfang das Fehlen bestimmter bautechnischer Informationen an vielen Stellen des Werks. So macht Vitruv
Weitaus bedeutsamer unter den immanenten Gründen für die geringe Wirkung von Vitruv
Vitruv
Man tut Vitruv
Mit seiner Fixierung auf die griechische Tradition entgehen ihm aber nicht nur Tendenzen im Bereich der Ausgestaltung von Bauentwürfen, sie hindert ihn auch bei der Darstellung der Gebäudetypen, und dem Erkennen der Bezüge zu gesellschaftlichen Entwicklungen, die sie tragen: Vitruv
Mindestens ebenso sehr gegen die Relevanz seines Textes für die zeitgenössische und spätere Baupraxis wirkten allerdings Faktoren, auf die Vitruv
Vitruv
Folgt man den hier vorgetragenen Argumenten,406 dann ergibt sich zunächst, dass Vitruv
3.9.4 Objekte als Träger von Wissen
Wissen kann im Bauwesen auch indirekt, durch Objekte, in denen dieses Wissen verkörpert ist, weitergegeben werden. Technisch möglich war das durch die griechische Bauweise, die bei anspruchsvollen Bauten auf Bindemittel verzichtete, und stattdessen die einzelnen Blöcke durch Klammern und Dübel verband. Entsprechend konnte, sorgfältiges Arbeiten vorausgesetzt, sogar der Oberbau kompletter Gebäude abgebaut und an anderer Stelle wieder errichtet werden, wie die sog. ,Wandertempel‘ zeigen.407
Nach Rom
An den importierten Stücken konnten römische Architekten und Steinmetzen Proportionen und komplexe Ornamentformen studieren, und – in begrenztem Maße – auch die Herstellungstechnik (in derselben Weise wie heute die moderne Bauforschung). An sich war das Kopieren als Form der Aneignung von Wissen und Fertigkeiten immer schon übliche Praxis, denn es war eine der wichtigsten Formen der Ausbildung
Im einzelnen lässt sich die Bedeutung der Aneignung von Wissen und Fertigkeiten durch das Kopieren griechischer Bauteile in Rom
3.10 Innovationen
Diese Einteilung soll natürlich verbunden sein mit der Frage nach den Impulsen, die die innovativen Entwicklungen bewirkt haben. Einige der Grundlinien, die man in dieser Hinsicht ausmachen kann, sollen hier kurz vorweggenommen werden. Die erste betrifft die Aneignung des Fremden. Hierzu ist bereits oben im Zusammenhang mit den griechischen Architekten das meiste gesagt worden. Rom
Das Vordringen des Fremden hatte allerdings eine gewissermaßen natürliche Grenze. Je mehr die Römer übernahmen, umso näher rückte das Fremde ihnen gleichsam in ihre eigene Lebensweise hinein, die sie jedoch keineswegs aufgeben wollten. Das erklärt vor allem die Mischformen und Transformationen. Das römische Haus war, wie noch zu zeigen sein wird, auf die Lebensweise der (wohlhabenden) römischen Familie abgestimmt, und eben deshalb konnte es nicht einfach gegen das griechische Peristylhaus ausgetauscht werden.
Das wirklich Neue hingegen entstand nicht einfach aus den neuen Möglichkeiten, Kenntnissen und Ressourcen, sondern war in vieler Hinsicht der Tatsache geschuldet, dass Rom
Übernahmen
Unter dem, was die Römer von anderen Kulturen ohne größere Änderungen übernommen haben, nehmen die griechischen Säulenordnungen sicher die prominenteste Stellung ein. Dazu zählen neben den grundlegenden Typen von Säulen- und Gebälkformen auch Details wie die Schmuckbänder (Kymatien, Astragale, Mäander usw.), die später vor allem die Gebälke des 2. Jhs. n. Chr. überfrachten sollten. Der Begriff der ,Ordnung‘ im Sinne einer festen Verkettung von Säulenschaft-, Kapitell- und Gebälkformen ist in diesem Kontext allerdings nur begrenzt zutreffend, denn die Römer kombinierten die Formen untereinander relativ frei. Das hat seinen Grund aber nicht in einem mangelnden Verständnis des Formenkanon auf Seiten der Römer, sondern entspricht den Tendenzen der seinerzeit aktuellen späthellenistischen Architektur, in der die Ordnungen ihre Verbindlichkeit bereits verloren hatten.
Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist zunächst, dass die ,eigene‘, etruskische oder tuskanische Ordnung zwar nicht aufgegeben wird, aber erkennbar am unteren Ende der Hierarchie der Ordnungen rangiert. Sie fusionierte spätestens ab augusteischer Zeit mit der ebenfalls schon im hohen Hellenismus abgewerteten dorischen Ordnung zu einem System von Formen minderen Anspruchs, das eher für Zweckbauten verwendet wurde. Bei den Ursachen dafür überlagern sich ästhetische und pragmatische Motive: Das dorisch-tuskanische hatte nicht die Pracht der ionisch-korinthischen Ordnungen, und war damit auch erkennbar preiswerter herzustellen. Bemerkenswert ist des weiteren, dass die Römer mit der Übernahme der griechischen Säulenordnungen sich fremde Architekturformen in einem Umfang aneignen, wie das keine andere der großen antiken Kulturen vor ihnen getan hat. Eine Regionalmacht wie Ägypten
Die Übernahme der griechischen Säulenordnungen ist, theoretisch gesehen, ein einfaches Kopieren. In der Praxis dürfte dieses Kopieren jedoch erhebliche Anforderungen an die Ausführenden gestellt haben, und zwar aus drei Gründen. Säulen und Gebälke etruskischer Tempel waren aus Holz. Steinmetzen hatten natürlich auch schon vorher in Rom
Was die Römer übernahmen, ist nur zu einem geringen Teil als griechische ,Klassik‘ einzustufen, und insofern handelt es sich auch nicht um irgendeine Form von Historismus. Die Römer waren vielmehr an der aktuellen späthellenistischen Architektur interessiert. So haben sie sehr wahrscheinlich von der Architektur des ptolemäischen Alexandria und seiner Einflussgebiete411 das Konsolgeison, die verkröpften Gebälke und die Konchen412 von dort übernommen. Zu diesem Komplex gehört sicherlich auch der sog. erste pompeianische Stil. Dieser sog. ,Mauerstil‘ bezeichnet an Wänden von Räumen eine Sockelzone, bei der Quadermauerwerk in Putz oder Stuck imitiert wurde.413 Das Vorbild solcher Wanddekorationen war die Verkleidung von Mauern in Inkrustationstechnik, d. h. das Verblenden mit Platten aus wertvollem, farbigen Gesteinen. Alle diese Elemente stehen für den Luxus, der sich in den Nachfolgestaaten des Alexanderreiches mit ihren enormen Ressourcen entwickelt hatte, im griechischen Mutterland hingegen kaum finanzierbar war. An eben diesem Luxus waren vor allem die Mitglieder der spätrepublikanischen Oberschicht Rom
Im Gegensatz zu den Architekturformen kopierten die Römer nur sehr selten komplette Gebäudetypen, sondern modifizierten die Typen, an denen sie Interesse hatten. Eine Ausnahme davon ist der Rundtempel, den die Römer schon am Ende des 2. Jhs. v. Chr. übernahmen (in Rom
Mischformen
Häufig kombinierten die Römer Elemente aus der eigenen Architektur mit Elementen fremder Architekturen. Der Grund, das fremde Vorbild nicht vollständig zu übernehmen, liegt praktisch nie nachweisbar darin, dass es am know-how dafür gefehlt hätte, und auch nicht darin, dass spezielle Materialien nicht verfügbar gewesen wären. Man kann hier einen gewissen Konservatismus der Bauherren annehmen, ein Traditionsbewusstsein, oder auch, dass sich bestimmte Elemente der heimischen Bauweise im Sinne der Ansprüche und Bedürfnisse einfach bewährt hatten.
Ein typisches Beispiel für ein hybrides Entwurfsmuster – mit erheblichen Freiheitsgraden – ist der ,römische‘ Tempel der späten Republik und der Kaiserzeit416, der Komponenten der etruskischen und der griechischen Bautradition miteinander verband. Von den Etruskern übernahmen die Römer den Unterbau des Tempels in Form eines Podiums mit vorgelagerter Freitreppe anstelle des umlaufenden Stufenbaus der Griechen (Krepis). Auch bei den Grundrissformen wurden etruskische Elemente beibehalten. Dazu gehört, dass häufig anstelle der an allen vier Seiten umlaufenden Säulenstellung des griechischen Peripteros die Römer an der Rückseite eine durchgehende Wand platzieren, die die dann dreiseitige Säulenstellung abschloß (sog. sine postico). Zur etruskischen Grundrisstradition zählt weiter, dass – bei Tempeln für mehrere Götter – die maximal drei Kulträume (Cellen) nebeneinander angeordnet wurden, während sie bei den Griechen normalerweise417 hintereinander angeordnet waren, was bei einer abschließenden Rückwand keinen eigenen Zugang für die hintere Cella zugelassen hätte. Auch einige Details des Aufrisses gehörten zur etruskischen Tradition, die man oft – aber nicht immer – findet, etwa der etwas spitzere Winkel des Satteldachs, oder die Flaschenform der Entasis
Ein weiteres Beispiel desselben Typs sind die luxuriösen Privathäuser, wie man sie vor allem aus den Vesuvstädten kennt. Sie entsprechen nicht einfach dem zeitgenössischen hellenistischen Typ des Peristylhauses. Vielmehr wurde das traditionelle etruskisch-römische Atriumhaus418 um ein Peristyl erweitert, das häufig eine kleine Ziergartenanlage mit einem Säulenumgang einfasste. Eine einfache Übernahme des Peristylhauses dürfte für die Römer schon deshalb nicht infrage gekommen sein, weil das Atriumhaus auf die gesellschaftlichen und rituellen Konventionen der römischen Oberschicht abgestimmt war, indem etwa bestimmte Hausbereiche für den täglichen Empfang der Klienten durch den Inhaber bzw. Patron reserviert waren, andere für die Verehrung der Vorfahren, und ähnliches.
Hybride findet man auch im Bereich der Architekturformen. Besonders prägnant in dieser Hinsicht ist das sog. Kompositkapitell, bei dem der untere Teil des korinthischen Kapitells, ein Kelch aus Blattranken (Kalathos) mit den dem oberen Teil des ionischen Kapitells, den Voluten und dem flachen Abakus, kombiniert wurde.419
Weiterentwicklungen und Transformationen
Es gibt eine ganze Reihe von römischen Gebäudetypen, bei denen deutlich der Einfluss der hellenistischen Architektur spürbar ist, aber ohne dass – wie bei den Mischtypen – römische und hellenistische Elemente einfach miteinander verbunden worden wären. Die hellenistische Interpretation bestimmter Bauaufgaben fungiert hier gleichsam als Anstoß, eigene Typen (weiter) zu entwickeln, wobei bestimmte hellenistische Elemente aufgenommen und integriert werden.
Ein Beispiel dafür ist das römische Forum.420 Als gewachsenes administratives und merkantiles Zentrum existierte es bei den Römern gleichsam schon immer, denn der ,Urtyp‘, das Forum Romanum, stammt aus einer Zeit, in der die Römer noch gar keine Kontakte mit dem hellenistischen Osten hatten. Anregungen haben die Römer später aufgenommen, vor allem aus den spätklassischen und hellenistischen Stadtanlagen, bei denen die Agora planvoll in das orthogonale Straßenraster integriert war421 Die geordnete Verbindung von Platz und Straßen war allerdings ein Planungsgedanke
Ein anderes Beispiel für ein komplexes Konzept, das ebenfalls deutlich hellenistischen Einfluss offenbart, ist das Terrassenheiligtum. Die Römer nahmen hier, ohne Zweifel in Kenntnis der entsprechenden Anlagen des Ostens (Asklepiosheiligtum auf Kos
Dasselbe gilt auch für das römische Theater. Die Römer griffen hier einerseits noch weit stärker auf griechische Vorbilder zurück, die sie modifizierten, indem sie etwa den Zuschauerraum auf einen Halbkreis reduzierten, der bei den griechischen Theatern größer als 180° war. Andererseits und vor allem aber konnten die Römer mit Hilfe ihrer Bautechnik große Theater auch freistehend errichten, während die griechischen Theater für den Zuschauerbereich stets in einen natürlichen Hang nutzten. Die die Sitzreihen für die Zuschauer tragende, massive Konstruktion aus Bogen und Gewölben erreichte dabei häufig Dimensionen, die deutlich über das hinausgingen, was im Osten technisch – und wohl auch finanziell – möglich war. Jedenfalls waren dort freistehende Zuschauertribünen, wenn nicht ohnehin aus Holz, durch einfache Erdanschüttungen realisiert worden. Ähnliches ergibt sich, wenn man den römischen Circus mit dem griechischen Stadion vergleicht.
Neuentwicklungen (Innovationen im engeren Sinne)
Zu den neuen Gebäudetypen, die eng mit der römischen Kultur verbunden waren, und daher weder Vorläufer noch Nachfolger haben, gehört das Amphitheater:423 Das sog. Gladiatorenspiel (munus gladiatorum) und die Tierhetzen (venationes) gehörten zur römischen Tradition, die zunächst in temporär errichteten Bauten aus Holz stattfanden. Die älteste Arena dieses Typs aus Stein ist das Amphitheater in Pompeji
An Rom
Einen vollkommen anderen Stellenwert innerhalb der Baugeschichte hat die römische Basilica. Auch hier ist bisher, trotz der ebenfalls griechischen Bezeichnung (basilike [stoa] = königliche Halle), von einer rein römischen Entwicklung auszugehen, auch wenn von der Baukonstruktion her (Stütze-Gebälk-System) die frühen Basiliken Gemeinsamkeiten mit den griechischen Stoen haben. Für Rom
Zu den bautechnischen Innovationen der Römer zählt in erster Linie das Ziegelmauerwerk und die Verwendung von Beton zum Mauer- und Gewölbebau. Mit letzterem direkt zusammen hängen die verschiedenen Formen der Konstruktion von Mauerschalen, die – mit Ausnahme des opus incertum und des opus quadratum – alle von den Römern entwickelt worden sind. Auf die Bedeutung dieser bautechnischen Innovationen soll im Folgenden ausführlich eingegangen werden.
3.10.1 Arbeitsökonomie und Produktivitätssteigerungen
1einer Reduktion des Arbeitsaufwandes,
2einer Reduktion des Anteils qualifizierter Arbeit, und
3einer Effektivierung der gesamten Materialwirtschaft einschließlich der Logistik.
Ablesbar waren die Ergebnisse der verschiedenen Neuerungen an, gemessen am Bauvolumen, beeindruckend kurzen Bauzeiten. So konnten in der Kaiserzeit komplexe Anlagen wie Foren, Thermen und Paläste in sehr großem Maßstab – mit Seitenlängen von 200 bis über 300 m – in wenigen Jahren fertiggestellt werden:
1die Traiansthermen in 5 Jahren (104 bis 109 n. Chr.)
2das Traiansforum in 7 Jahren (106/7 – 113 n. Chr.)
3die Caracallathermen in 10 Jahre (206-216 n. Chr.)
4die Diokletiansthermen in 8 Jahre (298 – 306 n. Chr.)
5der Diokletianspalast in 10 Jahre (295 bis 305 n. Chr.)
Die Griechen brauchten – unter günstigen Bedingungen – vergleichbare Bauzeiten für die Errichtung eines einzelnen Tempelbaus mittlerer Größe, wie etwa für den Zeustempel in Olympia
Zweifellos haben diese Unterschiede bei den Bauzeiten mit den weit größeren finanziellen und materiellen Ressourcen auf Seiten der Römer sowie finanziellen und politischen Problemen bei den Griechen zu tun. Die Tatsache jedoch, dass es selbst dem römischen Kaiser Hadrian
Faktoren beider Ebenen wirkten zusammen bei der Entkoppelung von Materialproduktion und Bauprozess. Während im griechischen Werksteinbau die Quader, Steinbalken und Säulentrommeln im Steinbruch erst gebrochen werden konnten, wenn die entsprechenden Bestellmaße vorlagen, also ein konkretes, durchgeplantes Projekt vorher entwickelt worden war, ließen sich die formlosen Materialien des caementitiums wie Kalk, Bruchstein und Puzzolana auf Vorrat produzieren, und anschließend flexibel, also für die unterschiedlichsten Projekte verwenden. Ähnliches gilt für die Ziegel, die zwar kein formloses Material waren, aber durch die Normierung auf nur drei Größenklassen problemlos vorproduziert und gelagert werden konnten. Die Standardisierung der Ziegelmaße war erstaunlicherweise schon zur Zeit von Vitruv
Die Entkoppelung von Produktion und Verwendung bei Marmorbauteilen war hingegen nicht ohne weiteres möglich. Die entscheidende Neuerung war hier die Standardisierung: vor allem Säulentrommeln und Gebälke wurden offenbar, wie schon die Ziegel, in Größenklassen eingeteilt, und konnten dadurch ebenfalls auf Vorrat produziert werden. Die Römer waren in dieser Hinsicht ausgesprochen konsequent: Selbst an einem so bedeutenden Bau wie dem Pantheon in Rom
Diese Entkoppelung von Herstellungs- und Bauprozess auch geformter Materialien ist an gewisse Voraussetzungen gebunden: Standardisierung ist nur dann effizient, wenn sie einheitlich Geltung hat, und mit einer effektiven Steuerung des Materialflusses verbunden ist. Dies durchzusetzen war praktisch nur einer zentralen staatlichen Behörde möglich, die die Römer auch etablierten. In diesem Punkt waren die Römer offensichtlich aber nicht dogmatisch. Während beim Marmor die ratio marmorum die Steuerung selbst übernahm, verblieb die Ziegelproduktion lange Zeit bei einer größeren Anzahl privater Unternehmen. Eine gewisse Zentralisierung und zunehmende staatliche Steuerung fand aber auch hier im 3. Jh. n. Chr. statt, indem die Ziegelproduktion zunehmend von den Legionen übernommen wurde.
Zur Entkoppelung von Materialproduktion und Bauprozess tritt als weiterer Faktor die höhere Effizienz der römischen Bautechnik auf der Baustelle hinzu. Das Bauen von Mauern mit caementitium war – anders als das mit Lehmziegeln oder in griechischer Emplektron-Technik – keine technische Beschränkung der Möglichkeiten gegenüber dem älteren Bau mit Naturstein, denn die Druckfestigkeit des römischen Betons lag im Bereich harter Gesteine. Bei reiner Ziegelbauweise war sie geringer, was aber durch größere Mauerstärken annähernd ausgeglichen werden konnte. Die römischen Bauweisen hatten in diesem Sinne keine limitierenden Nachteile, im Sinne der Effizienz aber große Vorteile: Die Endbearbeitung der Quaderflächen auf der Baustelle, also jedes einzelnen Steins vor seinem Versatz, und auf den Sichtflächen nach dem Versatz, konnte ersatzlos entfallen. Dasselbe galt für die Vertikal- und Horizontalverbindungen der Quader, also die von einem Schmied aus Eisen herzustellenden Dübel und Klammern, die Ausarbeitung der Bettungen in den Quadern, in die diese eingesetzt wurden, und das Verbleien der Eisenteile zum Schutz vor Korrosion. Damit war die Baustelle zugleich in sehr viel geringerem Maße auf Fachkräfte angewiesen, denn anders als die Zurichtung der Werksteine erforderte das Mischen des Mörtels und das Vermauern der Ziegel keine bzw. nur geringe Qualifikationen. Römischen Bauleiter konnten also flexibel ihren Bedarf an Arbeitskräften auf den allgemeinen lokalen Arbeitsmärkten decken. Man hat daher auch mit sehr wenig ,festangestellten‘ Baufacharbeitern in entsprechenden Unternehmen zu rechnen. Zur höheren Produktivität im Sinne der Kostenökonomie gehört weiterhin die im Vergleich zur griechischen Bauweise relativ sparsame Verwendung teurer Materialien: Die Römer haben, soweit erkennbar, von Anfang an darauf verzichtet, Mauern aus massiven Marmorblöcken zu bauen. Stattdessen wurden Wände mit vergleichsweise dünnen Marmorplatten verblendet, um die Optik der Marmorarchitektur beizubehalten. Diese Inkrustationstechnik ist keine römische Erfindung, sondern vereinzelt wohl schon in spätklassischer Zeit angewandt worden430 In diesen Kontext gehört wahrscheinlich eine der ganz wenigen Werkzeuginnovationen der Römer, denn die Herstellung von sehr dünnen Inkrustationsplatten ist ohne Säge kaum machbar.431 Für Rom
Die hier angesprochenen Entwicklungen werfen die Frage auf, ob zu den Innovationen der Römer nicht nur neue Gebäudetypen und Bautechniken zu zählen sind, sondern auch ein Konzept von Rationalisierung des Bauwesens. De facto lassen sich viele Elemente finden, die zu einem solchen Konzept gehören würden: Die Arbeitsorganisation erscheint, wenn man sie der älteren griechischen Bauweise gegenüberstellt, als eine Taylorisierung der Arbeit, denn an die Stelle der bei den Griechen dominierenden Steinmetzen als hochqualifizierte Arbeitskräfte tritt bei den Römern eine Kette von jeweils einfachen Tätigkeiten, die vom Ziegelstreicher bis zum Betonierer reicht. Die Bautechnik der Römer ist im Sinne der Kostenökonomie zweifelsfrei überlegen, aber nicht weniger leistungsfähig, und darüberhinaus gleichermaßen einheitlich und flexibel anwendbar: vom Fundament über die Mauern bis hin zu den Gewölbedecken konnte alles mit der gleichen Bautechnik realisiert werden. Die Kombination von zentralisierter Steuerung des Materialflusses und Standardisierung von Bauteilen entspricht durchaus modernen Strategien zur Rationalisierung von Produktionsabläufen. Der einzige wichtige Punkt moderner Ansätze, der sich in Rom
Die genannten Elemente der römischen Bauweise haben auch zu Ergebnissen im Sinne einer Rationalisierung geführt, denn die eingangs angeführten Beispiele für enorm kurze Bauzeiten veranschaulichen ja einen deutlichen Fortschritt bei der Produktivität. Trotzdem wäre es aus mehreren Gründen unangemessen, bei den Römern von einer Rationalisierung des Bauwesens im modernen Sinne zu sprechen. Zum einen handelt es sich eindeutig nicht um ein einheitliches Konzept mit der Ökonomisierung des Bauens als übergeordneter, leitender Zielsetzung. Der Vorstellung von Gewinnmaximierung steht bereits unmittelbar entgegen, dass die großen Bauprojekte in der Kaiserzeit meist ja nicht von privaten, auf Gewinn ausgerichteten Unternehmen realisiert wurden. Die Kaiser, die die Projekte initiierten und finanzierten, verkauften ihre Bauten nicht, so dass für sie per se kein Gewinn anfallen konnte, der zu maximieren gewesen wäre. Ihnen ging es um den Prestigewert ihrer Bauten, womit gleichsam die Legitimation ihrer Herrschaft maximiert werden sollte. Man kann an Einzelfragen sogar zeigen, dass beides – Prestigegewinn und Kostenökonomie – im Widerspruch zu einander stand: die Kaiser verbauten häufig auch bei großen Säulen monolithe Säulenschäfte, die wegen der Transportprobleme wesentlich teurer gewesen sein müssen als die bei den Griechen übliche Zusammensetzung der Schäfte aus einzelnen Trommeln. Es gab zudem explizite Äußerungen, die in dieselbe Richtung weisen. So hat der der Kaiser Vespasian
Der Tatsache, dass Kostenökonomie keine übergeordnetes Ziel war, entspricht auch, dass die einzelnen Faktoren, die oben im Sinne der Produktivitätssteigerung angeführt worden sind, mit jeweils unterschiedlichen bzw. eigenen Begründungen eingeführt worden sind: das caementitium ist offensichtlich als Mittel zur Steigerung der Festigkeit und Dauerhaltbarkeit von zweischaligen Mauerwerk eingeführt worden, der Ziegel in Rom
Auch wenn für die Römer ,Rationalisierung‘ kein einheitliches Konzept war, so kann man gleichwohl fragen, ob bei den einzelnen Faktoren die Römer von anderen gelernt haben, und ob möglicherweise später die Ökonomie des römischen Bauens als solche erkannt und fortgeführt worden ist. In ersterem Sinne kann man anführen, dass die Verstaatlichung und zentrale Steuerung vor allem von Produktion und Transport wertvoller Gesteine keine römische Neuerung war: Sie wurde seit ewigen Zeiten im pharaonischen Ägypten
3.10.2 Das Opus Caementitium und der Gewölbebau
Alle diese Formulierungen meinen natürlich mehr, als sie sagen, denn niemand hätte sie verwendet, wenn es nur darum gegangen wäre, dass die Römer ihre Mauerschalen mit einer sehr harten Gussmasse gefüllt haben, was – nebenbei bemerkt – fast genau das ist, was die Römer die ersten rund zweihundert Jahre mit ihrem Beton im Wesentlichen gemacht haben. Gemeint ist natürlich immer das caementitium als der Baustoff, mit dem die großen Gewölbe hergestellt wurden, die die eindrucksvollsten römischen Bauten gedeckt haben, bzw. letztlich deren Bau überhaupt erst ermöglichten. Beides, Beton und Gewölbe, haben aber unterschiedliche Wurzeln, und deshalb dürfte es zweckmäßig sein, ihnen hier getrennt kurz nachzugehen.
Die Verwendung der Puzzolanerde als Baustoff wird Ende des 3. oder Anfang des 2. Jhs. v. Chr. angesetzt. Nicht exakt ist zu klären, wo das passiert ist. Der Name, den die Römer selbst dafür gewählt haben (pulvis puteolanus), verweist auf Kampanien
Wie die Qualitäten des pulvis puteolanus entdeckt worden sind, lässt sich ebenfalls nicht mehr genau nachvollziehen. Zweischalige Mauern, die mit Bruchstein sowie Lehm, Sand oder Schutt gefüllt wurden, waren eine sehr viel ältere Form der Bautechnik, die, wie Vitruv
Parallel dazu, und weitgehend unabhängig von der Nutzung des caementitiums, verläuft die Verwendung der Wölbtechniken. Sie sind ganz sicher keine genuin römische Entwicklung. Umstritten ist nur, von wem die Römer sie gelernt haben. In der Forschung dominiert heute die Auffassung, dass sie von den Etruskern übernommen wurde. Stark umstritten ist allerdings, zu welchem Zeitpunkt. Ein Teil der Forscher sieht die Cloaca Maxima als Beleg dafür an, dass sie in Rom
Geht man mit der Datierung bis ins 3. Jh. v. Chr. herunter, käme auch eine Übernahme der Technik aus den unteritalischen Griechenstädten infrage, denn die Griechen verwendeten die Keilsteintechnik ab der Mitte des 4. Jhs. v. Chr. Interessanterweise berührt man damit Diskussionen, die zum Thema in der Antike selbst geführt worden sind. Seneca erwähnt in einem seiner Briefe,442 dass der stoische Philosoph Poseidonios
Wie auch immer man die eben angerissenen Fragen beurteilen will, sicher dürfte zunächst einfach sein, dass die entscheidende und auch die genuine Leistung der römischen Baumeister darin zu sehen ist, den Beton als Baustoff mit seinen natursteinähnlichen Eigenschaften und die Wölbtechniken zusammengebracht zu haben, nachdem beides zunächst sehr lange nebeneinander genutzt worden war, denn vom mit drei Keilsteinen überdeckten Abwasserkanal bis zur freitragenden Kuppel des Pantheons war es sicherlich ein weiter Weg. Oder, um genauer zu sein: Die eigentliche Leistung war, die dabei auftretenden Probleme des Bogenschubs und seiner Folgen verstanden, und dafür Lösungen entwickelt zu haben, die auf diesem Verständnis beruhen. Denn die Lösungen, die oben im Abschnitt über den Gewölbebau dargestellt worden sind, beruhen nicht darauf, Festigkeitsproblemen einfach mit massigeren Dimensionierungen zu begegnen, was konstruktiv auch kaum zu brauchbaren Ergebnissen geführt hatte. Die römischen Lösungen zeigen vielmehr sehr genau, dass die Baumeister wussten, wie das Tragverhalten von Gewölben einzuschätzen war, denn anders hätten sie nicht bestimmen können, wo Belastung und wo Entlastung der Stabilisierung der Konstruktion dienen konnte. Wie also sind die römischen Architekten diese Fragen angegangen, und wie haben sie ihr Verständnis der im Bogen wirkenden Kräfte entwickelt, obwohl doch erst in allerjüngster Zeit durch computergestütze Verfahren die Kräfteverhältnisse genau bestimmt und quantifiziert werden konnten? Direkte Aufschlüsse darüber gibt es mangels Quellen nicht, aber einige begründete Vermutungen lassen sich vielleicht formulieren.
Zunächst einmal wird man festhalten können, dass die römischen Baumeister sicher nicht einfach nur von der Festigkeit des seinerzeit schon lange erprobten caementitiums als Baumaterial ausgingen. Die Gewölbe für den Tempel des Hercules Victor
Diesen Ansatz, in die Gussschale Verstärkungen einzuziehen, die auf dem Keilsteinprinzip basieren, finden sich in der einen oder anderen Form an fast allen römischen Betongewölben: als Ziegelrippen aus den großen besales, oder auch als Rippen in der Technik, die oben als Lamellenstruktur bezeichnet worden ist. Die römischen Baumeister sind demnach nie davon ausgegangen, dass ihr caementitium beliebig hohe Kräfte aufnehmen konnte, d. h. dieselben Eigenschaften hat wie ein Monolith (eine Kuppel aus einem einzigen Stein, wie am Grab Theoderichs
Woher aber wussten die Baumeister, in welchen Bereichen der Betonguss selbst durch Auflast stabilisiert werden, und wo eine möglichst leichte Konstruktion das Gewölbe stabilisiert? Beides waren ja Prinzipien, die den Erfahrungen bei Stützte-Gebälk-Systemen direkt widersprachen, da bei Tragbalken Auflast (außer im Bereich der Stützen) immer die Bruchgefahr erhöht. Ein Ansatz für das Verständnis der Spannungen könnten Bauschäden in Form von Rissen im Beton oder Fugenklaffungen in Keilsteinbögen gewesen sein. Solche sich öffnenden Risse auf der Außenseite (vgl. Abbildung oben „Versagen eines Bogens“, Abb. 3.16) geben an, wo der Bogen seine ursprüngliche Form zu verlieren beginnt und wo die entsprechenden Kräfte am stärksten sind. Es liegt nahe, Rissen auf der Oberseite eines Bogens zu begegnen, indem man durch Auflast die Fuge wieder schließt und den sich verformenden Bogen in seine ursprüngliche Form zurückzwingt. Die beschriebenen Stufenringe im äußeren Bereich von Kuppeln kann man aus dieser Sicht als eine Art ,präventiver Reparatur‘ verstehen. Eine andere Erfahrung, die in die gleiche Richtung weist, könnte an den Brücken gemacht worden sein. Die Auffüllungen in den Zwickelfeldern zwischen den Bogen bis zur Fahrbahnebene sind ja ebenfalls hohe Auflasten, die ungleichmäßig die Bogen belasten – außen stark, in der Mitte kaum. Die Baumeister werden sicherlich beobachtet haben, dass diese selektiv aufgebrachten Lasten den Brückenbogen keineswegs verformten, sondern im Gegenteil seine Form stabilisierten.
Die unterschiedlich starken Kräfte, die in den Segmenten eines Bogens wirken, waren auch auf andere Weise beobachtbar beobachtbar. Friedrich Rakob hat, wie schon angesprochen, bei seinen Untersuchungen in Baiae
Ein letzter Aspekt der ,concrete revolution‘, der hier noch kurz ausgeführt werden soll, betrifft die Verbreitung der in Rom
Abgekürzt zitierte Werke
| DNP | Der neue Pauly |
| H. Cancik u. a. (Hrsg.), Der neue Pauly: Enzyklopädie der Antike. Stuttgart: Metzler Verlag, 1996–2003. | |
| CIL | Corpus inscriptionum latinarum. |
| Corpus inscriptionum latinarum. Consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum, Berlin: Reimer Verlag, später de Gruyter, 1862ff. | |
| CLE | Carmina Latina epigraphica |
| Anthologia latina sive Poesis latinae supplementus, recensuit Franciscus Buecheler et Alexander Riese, Leipzig: Teubner 1869–1926 | |
| FIRA | Fons Iuris Romani Antejustiniani |
| S. Riccobono u. a. (Hrsg.), Fontes Iuris Romani Antejustiniani in usum scholarum, 1940 | |
| ILLRP | Inscriptiones latinae liberae rei publicae |
| A. Degrassi, Inscriptiones latinae liberae rei publicae, Florenz: La Nuova Italia, 1957–1963 | |
| ILS | Inscriptiones Latinae selectae |
| H. Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae. Berlin, 1892–1916 |
Antike Autoren und Sammelwerke
Antike Autoren und Sammelwerke sind nach den international üblichen Abkürzungen zitiert, die nachfolgend aufgelöst sind. Die lateinischen (bzw. griechischen) Originaltexte und englische Übersetzungen der angeführten Werke liegen – wenn hier nicht anders angegeben – in der Loeb Classical Library vor.
| App. | Appian |
| – civ. | bella civilia / ‚Bürgerkriege‘ |
| Caes. | Caesar |
| – Gall. | de bello Gallico / ‚Über den gallischen Krieg‘ |
| Cass. Dio | Cassius Dio |
| Ῥωμαϊκὴ ἱστορία / Römische Geschichte | |
| Cato | Cato der Ältere |
| – agr. | de agri cultura / ‚Über den Landbau‘ |
| Cetius Faventinus | H. Plommer, Vitruvius and later Roman building manuals, Cambridge: Cambridge University Press 1973, 39–85. |
| Cic. | Cicero |
| – Verr. | in Verrem / ‚Gegen Verres‘ |
| – ad Q. | ad Quintum fratrem / Briefe an Quintus |
| – Att. | ad Atticum / Briefe an Atticus |
| – leg. | de legibus / Über die Gesetze |
| – orat. | orator / ‚Der Redner‘ |
| – Tusk. | Tusculanae disputationes / ‚Gespräche in Tusculum‘ |
| Cod. Theod. | Codex Theodosianus |
| C. Pharr, The Theodosian Code. And Novels. And the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography, Princeton: The Lawbook Exchange, 1952 | |
| Colum. | Columella |
| de re rustica / ‚Über den Landbau‘ | |
| Edict Diocl. | Edictum De Pretiis Rerum Venalium |
| S. Lauffer (Hg.), Diokletians Preisedikt, Berlin: de Gruyter 1971 | |
| Dig. | Digesta oder Pandekten, Teil des Corpus Iuris Civilis |
| zitierte Autoren: | |
| Gai. Gaius | |
| Ulp. Ulpian | |
| Th. Mommsen, P. Krüger (Hrsg.), Corpus Iuris Civilis, Hildesheim 1889 | |
| Diod. | Diodorus Siculus |
| bibliotheca historica/Universalgeschichte. | |
| Dion Hal. | Dionysos von Halikarnassos |
| – ant. | Ῥωμαικὴ ἀρχαιολογία / ‚Römische Altertümer‘ |
| Fest. | Festus |
| de verborum significatione / ‚Über die Bedeutung der Wörter‘ | |
| Frontin. | Frontinus |
| – de aq. | de aquis urbis Romae / ‚Über die Wasserversorgung Roms‘ |
| Gell. | Gellius |
| noctes Atticae / ‚Attische Nächte‘ | |
| Iuv | Juvenal |
| saturae / ‚Satiren‘ | |
| Liv. | Livius |
| ab urbe condita / Geschichte Roms | |
| Nep. | Nepos |
| ap. priscian / Fragmente | |
| P. K. Marshall (Hg.), Cornelii Nepotis Vitae cum fragmentis, Leipzig 1977 | |
| Plin. | Plinius der Ältere |
| – n. h. | naturalis historia / ‚Naturgeschichte‘ |
| Plin. | Plinius der Jüngere |
| – epist. | epistulae / ‚Briefe‘ |
| Plut. | Plutarch |
| – Cato mai. | Cato Censorius / Cato d. Ä. |
| – Crass. | Crassus |
| – Demetr. | Demetrios |
| – Per. | Perikles |
| – Pomp. | Pompeius |
| Polyb. | Polybios |
| Ἱστορίαι / Geschichte | |
| Prok. | Prokop |
| – aed. | Περὶ κτισμάτων / Über die Bauten |
| Sen. | Seneca |
| – ep. | epistulae morales ad Lucilium / ‚Briefe an Lucilius‘ |
| Serv. | Servius |
| –Aen. | commentarius in Vergilii Aeneida / Kommentar zu Vergils Aeneis |
| SHA | Historia Augusta |
| Sidon. | Sidonius Apollinaris |
| – epist. | epistulae / ‚Briefe‘ |
| Strab. | Strabon |
| –geogr. | Γεωγραφικά / Geographie |
| Suet. | Suetonius |
| de vita Caesarum / ‚Kaiserbiographien‘ | |
| Aug. Augustus | |
| Caes. Caesar | |
| Tib. Tiberius | |
| Vesp. Vespasian | |
| Stat. | Statius |
| – silv. | Silvae / ‚Gedichte‘ |
| J. S. Phillimore, Silvae. Oxford 1905 ff. (Oxford Classical Texts) | |
| Tac. | Tacitus |
| – ann. | Annalen |
| Theophr. | Theophrast |
| – hist. plant. | historia plantarum / ‚Naturgeschichte der Gewächse‘ |
| – caus. plant. | de causis plantarum / ‚Über die Ursachen des Wachstums‘ |
| Varro | Varro |
| – L. L. | de lingua Latina / ‚Über die lateinische Sprache‘ |
| Vell. | Velleius |
| historia Romana / ‚römische Geschichte‘ | |
| Vitr. | Vitruv |
| de architectura / ‚Über die Architektur‘ | |
| lat. Text mit deutscher Übersetzung bei Fensterbusch 1964 |
Bibliographie
Adam, J. P., A. Mathews (1994). Roman Building: Materials and Techniques. London: Routledge Chapman & Hall.
Amici, C. M. (1997). L’uso del ferro nelle strutture romane. Materiali e Strutture 2-3: 85-95
- (2005a). Dal progetto al monumento. In: La Basilica di Massenzio Ed. by C. Giavarini. Rom: L’ Erma di Bretschneider 21-74
- (2005b). Le tecniche di cantiere e il procedimento costruttivo. In: La Basilica di Massenzio. Il monumento, i materiali, le strutture, la stabilità Ed. by C. Giavarini. Rom: L’ Erma di Bretschneider 125-160
- (2006). The Basilica of Maxentius in Rome: Innovative Solutions in the Organization of Construction Process. In: Proceedings of the Second International Congress on Costruction History Ed. by M. Dunkeld. Exeter: Short Run Press 167-178
Anderson, J. C. (1997). Roman architecture and society. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Andrews, F. B. (1973). The Medieval Builder and his Methods. New York: Barnes & Noble.
Ashby, Th., I. A. Richmond (1935). The Aqueducts of Ancient Rome. Oxford: Clarendon Press.
Badian, E. (1972). Publicans and Sinners: Private Enterprise in the Service of the Roman Republic. Oxford: Cornell University Press.
Ball, L. (2003). The Domus Aurea and the Roman Architectural Revolution. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Barton, I. M. (1996). Roman Domestic Buildings. Exeter: University of Exeter Press.
Bender, H. (1975). Römische Straßen und Straßenstationen. Stuttgart: Zweigmuseum des Württembergischen Landesmuseum.
Bengtson, H. (1982). Grundriss der römischen Geschichte mit Quellenkunde. Bd. 1, Republik und Kaiserzeit bis 284 n. Chr.. München: C.H. Beck.
Bernard, S. G. (2010). Pentelic marble in architecture at Rome and the Republican marble trade. Journal of Roman Archaeology 23: 35-54
Bietti Sestieri, A. M. (1985). Roma, archeologia nel centro II: La „Citta murata“. Rom: De Luca Editore.
Bitterer, T. (2013) Marmorverkleidung stadtrömischer Architektur. Öffentliche Bauten aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. bis 7. Jahrhundert n. Chr.. phdthesis. LMU München
Bloch, H. (1968). I bolli laterizi e la storia edilizia romana: contributi all’archeologia e alla storia romana. Rom: L’Erma di Bretschneider.
Bottke, H. D. (1999) Römische Mietshäuser Die Wohnverhältnisse sozialer Unterschichten von der ausgehenden Republik bis zur hohen Kaiserzeit und deren bautechnische sowie ökonomische Ursachen. phdthesis. Universität Duisburg
Brandl, U., E. Federhofer, Dolata F. (2010). Ton + Technik. Römische Ziegel. Stuttgart: Konrad Theiss.
Brunn, C. (1991). The Water Supply of Ancient Rome: A Study of Roman Imperial Administration. Helsinki: Societas Scientiarum Fennica.
Brunner, G. O. (1999). Sind Karrengleise ausgefahren oder handgemacht?. Helvetia Archaeologica 30: 31-41
Burford, A. (1972). Craftsmen in Greek and Roman Society. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Burmeister, S., M. Fansa (2004). Rad und Wagen: der Ursprung einer Innovation. Wagen im Vorderen Orient und Europa. Mainz: Philipp von Zabern.
Calabresi, G., M. Fattorini (2005). Subsoil and Foundations. In: La Basilica di Massenzio: il monumento, le strutture, la stabilita Ed. by C. Giavarini. Rom: L’ Erma di Bretschneider 75-91
Calza, R., E. Nash (1959). Ostia. Florenz: Sansoni.
Casson, L. (1974 [ND 1994]). Travel in the Ancient World. Toronto: Hakkert.
Chantraine, H. (1967). Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser. Studien zu ihrer Nomenklatur. Wiesbaden: Steiner.
Chevallier, R. (1976 [ND 1989]). Roman Roads. Berkeley: University of California Press.
- (1988). Voyages et déplacements dans l’Empire romain Voyages et déplacements dans l’Empire romain Voyages et déplacements dans l’Empire romain. Paris: Colin.
Choisy, F. A. (1873). L’art de bâtir chez les romains. Paris: Ducher.
Cichorius, C. (1900). Die Reliefs der Traianssäule, Tafelband II „Die Reliefs des Zweiten Dakischen Krieges“. Berlin: Reimer.
Cifani, G. (1994 [1995]). Aspetti dell’edilizia romana archaica. Studi Etruschi 60: 185-226
Connolly, P., H. Dodge (1998). Die antike Stadt: Das Leben in Athen & Rom. Köln: Könemann.
Cotterell, B., J. Kamminga (1990). Mechanics of Pre-industrial Technology: An Introduction to the Mechanics of Ancient and Traditional Material Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
Cüppers, H. (2001). Die Römerbrücken. In: Das römische Trier Ed. by Hans-Peter Kuhnen, Lukas Clemens. Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 40. Stuttgart: Theiss 158-165
Davies, H. E. H. (1998). Designing Roman Roads. Britannia 29: 1-16
DeLaine, J. (1990). Structural Experimentation: The Lintel Arch, Corbel and Tie in Western Roman Architecture. World Archaeology 21(3): 407-424
- (1997a). Building the Eternal City: the Construction Industry of Imperial Rome. In: Ancient Rome: The Archaeology of the Eternal City Ed. by J. Coulston, H. Dodge. Oxford: Oxford University School of Archaeology 119-141
- (1997b). The baths of Caracalla: a study in the design, construction, and economics of large-scale building projects in imperial Rome. Portsmouth, R.I.: JRA.
della Portella, I. (2004). The Appian Way: From its Foundations to the Middle Ages. Los Angeles: Getty Publications.
Donderer, M. (1996). Die Architekten der späten römischen Republik und der Kaiserzeit: Epigraphische Zeugnisse. Erlangen: Universitätsbund Erlangen-Nürnberg.
Drerup, H. (1976). Zur Plangestaltung römischer Fora. In: Hellenismus in Mittelitalien Ed. by P. Zanker. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 398-412
Drexhage, H. J., H. Konen, H. K. (2002). Die Wirtschaft des römischen Reiches (1.–3. Jahrhundert): eine Einführung. Berlin: Oldenbourg Akademieverlag.
Eich, P. (2005). Zur Metamorphose des politischen Systems in der römischen Kaiserzeit. Die Entstehung einer „personalen Bürokratie“ im langen dritten Jahrhundert. Berlin: Akademie Verlag.
Evans, E. (1994). Military Architects and Building Design in Roman Britain. Britannia 25: 143ff.
Fant, J. C. (1999). Augustus and the city of marble. In: Archeomateriaux. Marbres et autres roches (ASMOSIA IV: Bordeaux, 9–13 octobre 1995) Ed. by M. Schvoerer. Bordeaux: CRPAA 277-280
Fauerbach, U., M. Sahlhof (2012). Kaiserkult am Katarakt: Der Augustustempel auf Philae.. In: Bericht über die 46. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung vom 12. bis 16. Mai 2010 in Konstanz Stuttgart: Koldewey-Gesellschaft 65-80
Federhofer, E. (2007). Der Ziegelbrennofen von Essenbach, Lkr. Landshut und römische Ziegelöfen in Raetien und Noricum: Untersuchungen zu Befunden und Funden, zum Produktionsablauf und zur Typologie. Rahden Westf.: Verlag Marie Leidorf.
Fensterbusch, C. (1964). Vitruv zehn Bücher über Architektur = Vitruvii De architectura libri decem. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Fitchen, J. (1986). Building Construction before Mechanization. Cambridge, Mass.: MIT Press.
French, D. (1981). Roman Roads and Milestones of Asia Minor, Fasc. 1: The Pilgrim’s Road. Oxford: British Archaeological Reports.
Gabucci, A. (2007). Rome. Berkeley: University of California Press.
Galliazzo, V., R. Chevallier (1995). I ponti romani. Bd. 2 Catalogo generale. Treviso: Canova.
Gardner, H. (2005). Gardner’s Art Through The Ages: The Western Perspective; The Roman Pantheon: The Triumph of Concrete. Thomson: Wadsworth Publishing.
Gargiani, R. (2008). La Colonne: Nouvelle Histoire de la Construction. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.
Giuliani, C.F. (1997). L’opus caementicium nell’edilizia romana. Materiali e Strutture 2-3: 49-62
Golvin, J. C. (1988). L’Amphithéâtre Romain: essai sur la théorisation de sa forme et de ses fonctions. Paris: Boccard.
Graßhoff, G., C. Berndt (2011). Die Entasis der Säulen des Pantheon. eTopoi. Journal for ancient studies. 1: 45-68
Grewe, K. (2009). Die Reliefdarstellung einer antiken Steinsägemaschine aus Hierapolis in Phrygien und ihre Bedeutung für die Technikgeschichte. In: Bautechnik im antiken und vorantiken Kleinasien Ed. by M. Bachmann. 429-454
Gros, P. (1973). Hermodorus et Vitruve. Mefra 85: 173ff.
- (1976a). Aurea templa: recherches sur l’architecture religieuse de Rome à l’époque d’Auguste. Rom: EFdR.
- (1976b). Les premieres generations d’architectes hellénistiques a Rome. In: L’Italie préromaine et la Rome républicaine: mélanges offerts à Jacques Heurgon Ed. by J. Heurgon. Collection de l’École franc̣aise de Rome 27. Rom: EFR 387-410
- (1990). Les étapes de l’aménagement monumental du forum. In: La città nell’Italia Settentrionale in età romana Triest, Rom: Università di Trieste, Ecole franc̣aise de Rome 29-68
- (1996). L’architecture romaine: du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire 1. Les monuments publics. Paris: Picard.
- (2001). L’architecture romaine: du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire. 2, Maisons, palais, villas et tombeaux. Paris: Picard.
Gros, P., X. Lafon, X. L. (2005). Théorie et pratique de l’architecture romaine: la norme et l’expérimentation: études offertes à Pierre Gros. Aix-en-Provence: Publications de l’Université de Provence.
Haase, W., H. Temporini (1972ff.). Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW)/Rise and Decline of the Roman World. Geschichte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
Hanfmann, G. M. A. (1983). Results of the Archaeological Exploration of Sardis, 1958–1975. In: Sardis from Prehistoric to Roman Times
Hart, F. (1965). Kunst und Technik der Wölbung. München: G.D.W. Callwey.
Haselberger, L. (1999). Appearance & Essence: Refinements of Classical Architecture – Curvature: Proceedings of the Second Williams Symposium on Classical Architecture held at the University of Pennsylvania, Philadelphia, April 2–4, 1993. Philadelphia: University Museum, University of Pennsylvania.
Heilmeyer, W. D. (1970) Korinthische Normalkapitelle: Studien zur Geschichte der römischen Architekturdekoration. phdthesis. Univeristät Frankfurt 1965
Heinz, W. (1988). Straßen und Brücken im Römischen Reich. Antike Welt Sondernummer 2: 1-72
Heisel, J. P. (1993). Antike Bauzeichnungen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Hellenkemper-Salies, G., H.-H. von Prittwitz, HH. v., Bauchhenß H.-H. (1994). Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia. Katalog des Rheinischen Landesmuseums Bonn. Köln: Rheinland-Verlag.
Henze, A., A. Hönle (1981). Römische Amphitheater und Stadien: Gladiatorenkämpfe und Circusspiele. Zürich: Atlantis.
Herzig, H. E. (1974). Probleme des römischen Straßenwesens: Untersuchungen zu Geschichte und Recht. In: ANRW II.1 Berlin: Walter de Gruyter 593-648
Hesberg, H. v. (1981). Lo sviluppo dell’ordine corinzio in età tardo- repubblicana. In: L’art décoratif à Rome à la fin de la république et au début du principat. Table ronde, Rome 10–11 mai 1979. Collection de l’Ecole française de Rome, 55. Paris: De Boccard 19-33
von Hesberg, H. (1980). Konsolengeisa des Hellenismus und der frühen Kaiserzeit. Mainz: Philipp von Zabern.
Hess, F. (1943). Konstruktion und Form im Bauen..
Heuss, A. (2007). Römische Geschichte. Paderborn: Schöningh.
Hodge, A. T. (1995). Roman Aqueducts & Water Supply. London: Buckworth.
Hoepfner, W., E.-L. Schwandner (1994). Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis. München: Deutscher Kunstverlag.
Honsell, H. (2010). Römisches Recht. Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer Verlag.
Jansen, G. C. M. (2000). Cura aquarum in Sicilia: Proceedings of the Tenth International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, Syracuse, May 16-22, 1998. Leiden: Babesch.
Jones, M. W. (2000a). Doric Measure and Architectural Design 1: The Evidence of the Relief from Salamis. AJA 104(1): 73-93
- (2000b). Principles of Roman architecture. New Haven, Conn.: Yale University Press.
Kammerer-Grothaus, H. (1974). Der Deus Rediculus im Triopion des Herodes Atticus. Untersuchung am Bau und zu polychromer Ziegelarchitektur des 2. Jahrhunderts n. Chr. in Latium. Römische Mitteilungen 81: 131-252
Karl, R. (2003). Überlegungen zum Verkehr in der eisenzeitlichen Keltiké. Wien: Brennos.
Keay, S. J., M. Millet, M. M., Paroli M. (2005). Portus. An archaeological survey of the port of Imperial Rome. London: The British School at Rome.
Kolb, A. (1993). Die kaiserliche Bauverwaltung in der Stadt Rom, Geschichte und Aufbau der cura operum publicorum unter dem Prinzipat. Stuttgart: Steiner.
Kolb, F. (1995). Rom. Geschichte der Stadt in der Antike. München: C.H. Beck.
Kunkel, W., M. Schermaier (2005). Römische Rechtgeschichte. Köln, u. a.: Böhlau.
Kunkel, W., R. Wittmann (1995). Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik II/2: Die Magistratur. München: C. H. Beck.
Laidlaw, A. (1985). The First Style in Pompeji: painting and architecture. Rom: Bretschneider.
Lamprecht, H. O. (1996). Opus caementitium: Bautechnik der Römer. Düsseldorf: Beton-Verlag.
Lancaster, L. C. (1998). Building Trajan’s Markets. American Journal of Archaeology 102: 283-308
- (2000). Building Trajan’s Markets 2: The Construction Process. American Journal of Archaeology 104: 755-785
- (2005a). Concrete Vaulted Construction in Imperial Rome: Innovations in Context. Cambridge, UK, New York, NY: Cambridge University Press.
- (2005b). The process of building the Colosseum: the site, materials, and construction techniques. Journal of Roman Archaeology 18.1: 57-82
- (2008). Roman Engineering and Construction. In: The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World Ed. by J. P. Oleson. Oxford, New York: Oxford University Press 256-284
Langdon, J. (1986). Horse, Oxen, and Technological Innovation: the use of draught animals in English farming from 1066 to 1500. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Laurence, R. (1999). The Roads of Roman Italy: Mobility and Cultural Change. London, New York: Routlegde.
Lechtman, H. N., L. W. Hobbs (1986). Roman Concrete and the Roman Architectural Revolution. In: High Technology Ceramics: Past, Present, Future: the nature of innovation and change in ceramic technology Ed. by W. D. Kingery, E. Lense. Ceramics and Civilization 3. Westerville, OH: American Ceramic Society
Lippe, Landschaftsverband Westfalen (2011). Römischer Ziegelbrand brachte hohe Leistung und gute Qualität. Experiment des LWL im Ziegeleimuseum Lage beendet. Archaeologie-Online
Long, L. E. (2012) Urbanism, Art, and Economy: The Marble Quarrying Industries of Aphrodisias and Roman Asia Minor. phdthesis. University of Michigan
Lugli (1968). La tecnica edilizia romana: con particolare riguardo a Roma e Lazio. Rome: G. Bardi.
MacDonald, W. L. (1986). The Architecture of the Roman Empire 2. An urban appraisal. New Haven: Yale Univ. Press.
Maiuri, A. (1938). Die Altertümer der Phlegräischen Felder vom Grab des Vergil bis zur Höhle von Cumae. Rom: Istituto Poligraifico dello Stato.
Malacrino, C. G. (2010). Constructing the Ancient World: Architectural Techniques of the Greeks and Romans. Los Angeles: Getty Publications.
Mark, P., R. Hutchinson (1986). On the structure of the Roman Pantheon. Art Bulletin (College Art Association) 68(1): 24-34
Marta, R. (1990). Architettura Romana: tecniche costruttive e forme architettoniche del mondo romano. Rom: Kappa.
Martin, S. D. (1982) Building Contracts in Classical Roman Law. phdthesis. University of Michigan
- (1989). The Roman Jurists and the organization of private building in the late republic and early empire. Bruxelles: Latomus.
Mattern, T. (2000). Vom Steinbruch zur Baustelle. Kaiserzeitlicher Baugliedhandel und normierte Architektur?. In: Munus. Festschrift für Hans Wiegartz Ed. by Hans Wiegartz, Torsten Mattern, T. M.. Münster: Scriptorium 171-188
Mau, A. (1882). Geschichte der decorativen Wandmalerei in Pompeji. Berlin: Reimer.
Meiggs, R. (1973). Roman Ostia. Oxford: Clarendon Press.
- (1982). Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World. Oxford: Clarendon Press.
Moore, D. (1995). The Roman Pantheon: the Triumph of Concrete. Mangilao, Guam: MARC/CCEOP.
Müller, W. (1989). Architekten in der Welt der Antike. Zürich, München: Koehler & Amelang.
Noëttes, R. Lefebvre (1931). L’attelage, le cheval de selles à travers les ãges. Paris: Picard.
Nuber, H. U. (2005). Zu Wasser und zu Lande. Das römische Verkehrsnetz. In: Imperium Romanum. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau Ed. by Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg. Esslingen: Theiss 410-419
O’Connor, C. (1993). Roman Bridges. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Ohlig, C. P. J. (2008). Cura aquarum in Jordanien: proceedings of the 13th International Conference on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, Petra/Amman, 31 March-09 April 2007. Siegburg: DWhG.
Ohr, K., J. J. Rasch (1991). Die Basilica in Pompeji. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
Oleson, J. P. (2008). The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World. Oxford, New York: Oxford University Press.
Osthues, E. W. (2005). Studien zum dorischen Eckkonflikt. Jahrbuch des deutschen Archäologischen Instituts 120: 1-154
Pearse, J. L. (1974) The Organization of Roman Building during the Late Republic and Early Empire. phdthesis. University of Cambridge
Pekary, T. (1968). Untersuchungen zu den römischen Reichsstraßen. Bonn: Habelt.
Pensabene, P. (1997). Elementi architettonici della Casa di Augusto sul Palatino. Römische Mitteilungen 104: 149-192
- (1998). Analisi tecnica e formale dei marmi architettonici della casa di Augusto sul Palatino e del tempio di Venere a Pompei. In: Atti IX giornata archeologica. Archeologia – Archeologie. Ricerca e metodologie, Genua 29. Novemebr 1996 Ed. by A. Bettini, B. M. Giannattasio, B.M. G.. Genua: Dipartimento di archeologia, filologia classica e loro tradizioni „Francesco Della Corte“ 55-124
Pensabene, P., P. Arthur (1985). Marmi antichi 1: problemi di impiego, di restauro e di identificazione. Rom: L’Erma di Bretschneider.
Pesce, G. (1950). Il Palazzo delle colonne in Tolemaide di Cirenaica. Rom: L’ Erma di Bretschneider.
Pieler, P. E. (2001). Römisches Vergaberecht. In: Zum Recht der Wirtschaft, Festschrift für Heinz Krejci zum 60. Geburtstag, Bd. 2 Ed. by E. Bernat, E. Böhler, E. B.. Wien: Verl. Österreich 1479-1495
Pippard, A. J. S., L. Chitty (1951). A Study of the Voussoir Arch. London: H. M. Stationary Office.
Radke, G. (1971). Viae publicae Romanae. Stuttgart: Alfred Druckenmuller Verlag.
Ragette, F. (1980). Baalbek. Park Ridge, N.J.: Noyes Press.
Rakob, F. (1961). Litus beatae Veneris aureum. Untersuchungen am Venustempel in Baiae. Römische Mitteilungen 68: 114-149
- (1983). Opus caementicium und die Folgen. Römische Mitteilungen 90: 359-372
Rasch, J. J. (1985). Die Kuppel in der römischen Architektur. Entwicklung, Formgebung, Konstruktion. Architectura 15: 117-139
- (1991). Zur Konstruktion spätantiker Kuppeln vom 3. bis 6. Jahrhundert. Jahrbuch des deutschen Archäologischen Instituts 106: 311-383
Ravelli, F., P. J. Howarth (1984). Etruscan cuniculi: tunnels for the collection of pure water. In: Transactions of the Twelfth International Congress on Irrigation and Drainage, Fort Collins, CO, USA
Rea, R., H. J. Beste, H.J. B. (2002). Il cantiere del Colosseo. Römische Mitteilungen 109: 341-374
Robert, T., S. Broughton (1951–52). The Magistrates of the Roman Republic. New York: American Philological Association.
Rodríguez Almeida, E. (2002). Formae Urbis antiquae: le mappe marmoree di Roma tra la Repubblica e Settimio Severo. Rom: Ecole Française de Rome.
Rogers, R. H. (1982). Curatores Aquarum. Harvard Studies in Classical Philology 86: 171-180
Rolfe, J. C. (1914). Suetonius, with an English Translation by J. C. Rolfe. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Rossetto, P. Ciancio (1995). Indagini e restauri nel Campo Marzio meridionale. Teatro di Marcello, Portico d’Ottavia, Circo Flaminio, Porto Tiberino. In: Archeologia laziale, 12. Dodicesimo incontro di studio del Comitato per l’archeologia laziale Ed. by S. Quilici Gigli. Quaderni di archeologia etrusco-italica, 23, 24.. Rom: Consiglio nazionale delle ricerche 93-101
Rosumek, P. (1982). Technischer Fortschritt und Rationalisierung im antiken Bergbau. Bonn: Habelt.
Sack, D., K. Tragbar (2012). Bericht über die 46. Tagung fur Ausgrabungswissenschaft und Bauforschung: vom 12. bis 16. Mai 2010 in Konstanz. Dresden: Thelem.
Scheidel, W., I. Morris, I. M. (2007). The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Schermeier, M. J. (2000). Bona Fides in Roman Contract Law. In: Good Faith in European Contract Law Ed. by R. Zimmermann, S. Whittaker. Cambridge Studies in International and Comparative Law 12. Cambridge, New York: Cambridge University Press 63-92
Schneider, H. (2005). Die Brücken im Imperium Romanum. In: Brücken - Historische Wege über den Fluß. Tagungsband zum 13. Kasseler Technickgeschichtlichen Kolloquium Ed. by F. Tönsmann. Kassel: Kassel University Press 1-20
Schneider, H. C. (1982). Die Bedeutung der römischen Straßen für den Handel. MBAH (Münstersche Beiträge zur Antiken Handelsgeschichte) 1(1): 85-96
Schneider, R. (1908). Griechische Poliorketiker I. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
Schöne, R. (1897). Damianos Schrift über die Optik: mit Auszügen aus Geminos. Berlin: Reichsdruckerei.
Schönfelder, M. (2000) Das spätkeltische Wagengrab von Boé. phdthesis. Universität Marburg
Schreiber, H. (1985). Auf Römerstraßen durch Europa. München: Paul List.
Sear, F. (1983). Roman Architecture. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Seelentag, G. (2008). Der Kaiser als Hafen. Die Ideologie italischer Infrastruktur. In: Das Marsfeld in Rom. Beiträge der Berner Tagung vom 23.–24. November 2007, Pantheon 4 Ed. by J. Albers, G. Graßhoff, G. G., Heinzelmann G.. 103-118
Seitz, G. (2005). Straßenstationen. Infrastruktur für die Weltherrschaft. In: Imperium Romanum. Roms Provinzen an Neckar, Rhein und Donau Ed. by Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg. Esslingen am Neckar: Theiss 420-425
Senseney, J. R. (2011). The Art of Building in the Classical World: Vision, Craftsmanship, and Linear Perspective in Greek and Roman Architecture. Cambridge: Cambridge University Press.
Shatzman, Israël (1972). The Roman General’s Authority over Booty. Historia 21(2): 177-205
Sidebotham, S. E. (1991). Römische Straßen in der ägyptischen Wüste. Antike Welt 22(3): 177-189
Sintès, C., P. Arcelin (1996). Musée de l’Arles Antique. Arles: Actes Sud.
Spoleto (2004). Sicilia ellenistica, consuetudo italica. Alle origini dell`architettura ellenistica d`Occidente. Atti dell`Incontro di studio..
Stamper, J. W. (2005). The Architecture of Roman Temples: the republic to the middle empire. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Stoll, O. (2001). Ordinatus Architectus: Roman Military Architects and their Importance for the Transfer of Technology. In: Römisches Heer und Gesellschaft Stuttgart: Franz Steiner Verlag 300-368
Straccioli, R. A. (2003). The Roads of the Romans. Los Angeles: Getty Publications.
Strong, D. E. (1968). The Administration of Public Building in Rome during the Late Republic and Early Empire. Bulletin of the Institute of Classical Studies 15(1): 97-109
von Sydow, W. (1984). Die hellenistischen Gebälke in Sizilien. Römische Mitteilungen 91: 239-358
Tapio, H. (1975) Organization of Roman Brick Production in the First and Second Centuries A.D. An Interpretation of Roman Brick Stamps (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Dissertationes Humanarum Litterarum 5). phdthesis. Suomalainen Tiedeakatemia
Taylor, R. M. (2003). Roman builders: A Study in Architectural Process. Cambridge; New York: Cambridge University Press.
Thomas, M. L., G. E. Meyers (2012). Monumentality in Etruscan and Early Roman Architecture: Ideology and Innovation. Austin: University of Texas Press.
Till, R. (1937). Die Redenfragmente des M. Porcius Cato..
Ulrich, R. B. (2007). Roman Woodworking. New Haven, London: Yale University Press.
Valeriani, S. (2006). Kirchendächer in Rom: Beiträge zu Zimmermannskunst und Kirchenbau von der Spätantike bis zur Barockzeit. Petersberg: Michael Imhof.
Vassal, V. (2006). Les Pavements d’opus signinum: technique, décor, fonction architectural. Oxford: Archaeopress.
Velenis, G. (1974). Some observations on the original form of the Rotunda in Thessaloniki. Balkan Studies 15: 298-307
Walser, G. (1970). Itinera Romana. Beiträge zur Straßengeschichte des Römischen Reiches. Bern: G. Walser.
Ward-Perkins, B., H. Dodge (1992). Marble in antiquity: collected papers of J. B. Ward-Perkins. London: British School at Rome.
Ward-Perkins, J. B. (1981). Roman Imperial Architecture. Harmondsworth, New York: Penguin Books.
- (1988). Rom. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.
Weber, W. (1986). Der Wagen in Italien und den römischen Provinzen. In: Achse, Rad und Wagen Ed. by W. Treue. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht 85-108
Welch, K. E. (2007). The Roman Amphitheatre. From its Origins to the Colosseum. Cambridge: Cambridge University Press.
Wiegand, T. (1894). Die puteolanische Bauinschrift sachlich erläutert. Leipzig: B. G. Teubner.
Wiplinger, G. (2006). Cura aquarum in Ephesus: proceedings of the twelfth International Congress on the History of Water Management and Hydraulic Engineering in the Mediterranean Region, Ephesus/Selçuk, Turkey, October 2–10, 2004. Dudley, Mass.: Peeters Publishers.
Wiseman, T. P. (1970). Roman Republican Road-Building. Papers of the British School of Rome 38: 122-152
Wurster, W., J. Ganzert (1978). Eine Brücke bei Limyra in Lykien. Archäologischer Anzeiger
Zanker, P. (1976). Hellenismus in Mittelitalien, Kongress Göttingen 1974. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
Personenindex
Ortsindex
Fußnoten
Cic. Tusk. 1.5. (O. Gigon) – Antike Autoren und Werke sind im Folgenden nach den international üblichen Abkürzungen zitiert. Eine Liste, in der die hier verwendeten Abkürzungen aufgelöst sind, befindet sich am Ende dieses Beitrags.
Umfassende Darstellungen zur Geschichte Roms: Scheidel et.al. 2007; Haase and Temporini 1972ff.; Bengtson 1982; Gabucci 2007; Heuss 2007.
Beispiele unten S.
Strong 1968, 97–103; Pearse 1974, 1–16. Zu den Magistraturen vgl. Robert and Broughton 1951–52.
Für den folgenden Abschnitt zur Tätigkeit der Zensoren ist zu beachten, dass die zur Verfügung stehenden Quellen alle relativ spät sind, d. h. im wesentlichen aus dem späten 1. Jh. v. Chr. oder aus noch späterer Zeit stammen.
Im 1. Jh. n. Chr. haben allerdings einige Kaiser die Zensur selber übernommen, u. a. Claudius und Vespasian.
Diese Zeitspanne, lustrum genannt, entsprach einem periodischen Reinigungsritus.
Polyb. 6.13.3.
Liv. 40.46.16.
Liv. 43.16. Zu den Finanzmitteln vgl. Strong 1968, 97f..
Frontin. de aq. 6.
Liv. 35.41.10.
App. civ. 1.4.28; Velleius 1.15.3.
Liv. 6.32.1.
Frontin. de aq. 5.
Liv. 4.22.7.
Vgl. z. B. Liv. 43.16.13.
Liv. 40,51,4.
Frontin. de aq. 5.
Frontin. de aq. 6.
Ihr Aufgabenbereich ist zusammenfassend beschrieben bei Cic. leg. 3.3.7. Vgl. dazu Kunkel and Wittmann 1995.
Frontin. de aq. 95.
So bauen die kurulischen Ädilen 193 v. Chr. zwei Portiken, beide Aemilia genannt, und einen Handelsmarkt (Emporium) am Tiber; im Folgejahr 192 noch eine weitere Säulenhalle; Liv. 35.41.10.
Frontin. de aq. 7.
Mitglieder des Senats war als einzige wirtschaftliche Betätigung die Landwirtschaft erlaubt.
Badian 1972. Der Terminus publicani, der an sich alle Unternehmer bezeichnet, die staatliche Aufträge übernahmen, bezeichnet in der Literatur häufig speziell die Steuerpächter.
Liv. 39.44.6-8, Plut. Cato mai. 19.
Liv. 43.16.
ILLRP 465, 465a, 466 = ILS 5799; = CIL VI, n. 40904 a.
CIL I 809.
ILLRP 518 = ILS 5317 (FIRA III 153). Die bis heute ausführlichste Darstellung ist die Dissertation von Wiegand 1894, 661–775.
Die Lesung ist unsicher.
Vgl. Ulrich 2007.
Vgl. zur Syngraphé Abschnitt. 8.2.10 im Beitrag über das griechische Bauwesen.
Cic. Verr. 2.130–153. Zu berücksichtigen ist dabei naturgemäß, dass es sich dabei um eine Anklage handelt, die den Streitfall einseitig aus Sicht des Klägers darstellt. Die Rede ist im übrigen nie vor Gericht gehalten wurde, sondern schriftlich veröffentlicht worden, nachdem Verres zuvor auf Anraten seines Rechtsbeistandes ins Exil nach Massilia (Marseille) gegangen war, womit das Verfahren beendet war.
In den englischen Übersetzungen ist diesbezüglich von „whitewashing“ (B. O. Foster) die Rede, in deutschen analog von „Tünche“ (Gerhard Krüger). Das dürfte sachlich falsch sein. Die Säulen des republikanischen Tempels waren aus Travertin, einem porösen Gestein, das üblicherweise mit einer Stuckschicht überzogen wurde. Sie musste nach Demontage der Trommeln zwangsläufig erneuert werden.
Wahrscheinlich Decimus Junius Brutus, der Vater des Caesarenmörders Decimus Iunius Brutus Albinus. Publius Junius könnte auch ein Freigelassener des älteren Decimus Junius Brutus gewesen sein; vgl. Kolb 1995, 475.
Die Zuständigkeit erklärt sich zum Teil dadurch, dass zwischen 86 und 70 v. Chr. keine Zensoren amtierten.
Strenggenommen nicht, weil das Mündel seine Selbstkosten ja nicht erstattet bekommen würde.
Damit waren Bauten aus Lehmziegeln, nicht aus gebrannten Ziegeln, gemeint.
Suet. Aug. 28.3.
Frontin. de aq. 117.
Frontin. de aq. 116.
Frontin. de aq. 99; 102; 104; 106; 125; 127.
Frontin. de aq. 100.
Für den vom Staat, d. h. vom Senat finanzierten Teil der Cura standen 250.000 Sesterzen an Einnahmen aus dem Verkauf von Wasserrechten zur Verfügung, soweit sie nicht unterschlagen wurden. Mit Domitian hat sich selbst ein Kaiser an dieser Kasse bedient; Frontin. de aq. 118.
Frontin. de aq. 119.
Frontin. de aq. 117.
Vgl. dazu die jüngeren Untersuchungen der Reihe „Cura Aquarum in...“, der Kongress-Serie zur Geschichte des Wasserbaus des Leichtweiß-Instituts der Technischen Universität Braunschweig. Erschienen sind Bände zu Ephesos, Sizilien, Jordanien und Israel.
Inschriftlich bekannt durch CIL 6.8631, 301, 8482, 33790; 11.31995. Allerdings ist nicht einmal der Name der Behörde gesichert. Ausführlicher zur ratio marmorum hier S.
Zu den Militärarchitekten s. S.
Siehe die oben erwähnten Inschriften zu den Reparaturen an der Via Caecilia.
Cato agr. 14f.
Zusammengestellt von Martin 1982.
Sie wurde aber noch in der juristischen Literatur beispielhaft herangezogen. Frage Stipulator: „Versprichst Du, ein mehrstöckiges Wohnhaus an diesem Ort innerhalb von 2 Jahren zu bauen“ – Antwort Promessor: „Ich verspreche“. Dig. 45.1.124.
Mehr zum personenrechtlichen Status unten im Abschnitt über die Architekten.
Auch Setzwaage genannt. Sie bestand aus Holzleisten, die in der Form des Buchstaben „A“ zusammengesetzt waren, an dessen Spitze ein an einer Schnur aufgehängtes Lot befestigt war. Sie diente zum Nivellieren, ähnlich wie die spätere Wasserwaage.
Cic. ad Q. 3.1.
Plin. ep. 9. 39.
Siehe dazu Schermeier 2000, 63ff.; Kunkel and Schermaier 2005, 113.
Gai. D 19, 2, 25, 7.
Lab D 19, 2, 62
Gell. 19.10.
Vitr. 1. 2. 2.
Ausführlicher dazu im Beitrag über das griechische Bauwesen im vorliegenden Band, Abschnitt. 2.3.5.
Vitr. 6.8.9.
Suet. Caes. 1.31,1.
Die Geschichte ist in einer mittelalterlichen Quelle enthalten. Der Autor war ein Mönch des 11. Jhs. mit Namen Xiphilinus, der vor allem aus Cassius Dio exzerpierte.
Plut. Pomp. 42. 4. Die Übersetzung bei Heisel 1993, 184, derzufolge Pompeius den Plan selbst gezeichnet haben, halte ich für unzutreffend.
Frontin. de aq. 1.17.
Zur Maßstäblichkeit Heisel 1993, 205f.. Die von ihm angeführte Vitruvstelle (1.2.2) ist in diesem Punkt aber gerade nicht eindeutig auf Zeichnungen bezogen. Nach meinem Verständnis geht es Vitruv hier, sozusagen im Gegenteil, darum, dass die Dimensionierungen eines Gebäude durch Rechnung, und gerade nicht durch Zeichnung bestimmt werden sollte, und zwar durch proportionale Ableitung von sekundären Größen aus den Hauptmaßen. Dieser Punkt ist für Vitruv essentiell, denn nur durch rechnerische Bestimmung der Größen lässt sich die Kommensurabilität der Maße erreichen, die die ,Symmetrie‘ sichert, die für Vitruv der Schlüssen für harmonisch gestaltete Entwürfe ist.
Heisel 1993, 188–191, Abb. R3.
Modulus, griechisch Embater, Vitr. 1.2.4; 4.3.3.
Vitr. ebenda.
Diese eindeutig aus der griechischen Architekturtradition stammende Vorgehensweise ist im Detail im Beitrag über die griechische Architektur in diesem Band, Abschnitt 8.8.6 beschrieben.
Der Geminus zugeschriebene Text findet sich angehängt an die Schrift des byzantinischen Autors Damianos über die antike Optik; s. Schöne 1897.
Zur Konstruktion der Entasis in der frühneuzeitlichen Architektur vgl. den entsprechenden Beitrag von A. Becchi in dieser Publikation. Eine authentische graphische Konstruktion einer griechischen Entasis zeigt die Abb. 2.8. im Beitrag über die griechische Architektur.
Vitr. 9. praef. 4f.
Vitr. 1.1.12.
Vitr. 1. praef. 3.
Sozusagen Vitruvs Grundbekenntnis zur Naturphilosophie in 2.2; die Behandlung der Puzzolana in 2.6. Auch bei der Darstellung der Eigenschaften der verschiedenen Bauhölzer wird von ihm auf die Vier-Elemente-Lehre häufig Bezug genommen.
Vgl. Vitr. 5.4f. – Die von ihm vorgeschlagenen Schallbecken als Verstärker sind weder theoretisch plausibel noch durch Funde nachweisbar.
Vitr. 3.3.11.
Zu den Refinements vgl. die Beiträge im von L. Haselberger organisierten Symposion zu diesem Thema, in Haselberger 1999.
Vitr. 6.2
Vitr. 3.5.9.
Vitr. 4.4.2f.
Vitr. 3.5.11 (Winkel); 3.5.9 (Architravhöhe); 3.3.11 (Verstärkung der Ecksäulen).
Cic. Att. 2.3.
Zu Cyrus ausführlich Anderson 1997, 32–34. Cyrus dürfte entweder ein Freigelassener oder ein freigeborener Fremder (ohne römisches Bürgerrecht) gewesen sein.
Vgl. unten S.
Zu nennen ist hier vor allem die These von Noëttes 1931, derzufolge die Antike keine effiziente Anschirrung der Zugtiere gekannt habe, was die Transportleistung, und damit die gesamte Wirtschaftsentwicklung der Antike nachhaltig behindert habe.
Vitr. 2.9.14. Frisch geschlagenes Lärchenholz hat ein Raumgewicht von 900 bis 1000 kg/cbm. Weitgehend ausgetrocknet, liegt das Gewicht deutlich niedriger, so dass es sicher schwimmt.
Plin. n.h. 36.1.
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist etwa das durch die Beschreibung bei Athenaios bekannte, spektakuläre Großprojekt Hierons II. von Syrakus. Das mit extremem Luxus ausgestattete Schiff sollte unter anderem auch als Getreidefrachter dienen, absolvierte aber nur wenige Fahrten.
Zur Geschichte Ostias s. Calza and Nash 1959; Meiggs 1973.
Die porticus inter lignarios wurde 192 erbaut, Liv. 35.41.10. Das Viertel der Schreiner und Holzhändler dürfte demnach noch älter sein.
Schon im 2. Jh. v. Chr. hatte Rom Getreide aus dem ptolemäischen Ägypten bezogen. Diese Lieferungen gehörten aber noch nicht zur normalen Versorgung der Stadt, sondern waren eine politische Geste der um ein Bündnis mit Rom bemühten Ptolemäerkönige.
Zu den Hafenbauprojekten und Hafenerweiterungen unter Traian zählen neben der Neuanlage des Portus-Hafens und dem Hafenbau in Centumcellae (Civitavecchia) auch die Anlagen bei Terracina; vgl. Seelentag 2008, 5.
Zum Fernstraßennetz vgl. unten Abschnitt 3.7.1.
Iuv. 3.252-4.
Iuv. 3,236f.
Plin. n.h. 36.24.
Schönfelder 2000; zum keltischen Wagenbau Karl 2003.
Langdon a. a. O.
Die Anschirrung für nur ein Zugtier war natürlich auch bekannt, wie einige in der hier angeführten Literatur abgebildete Wandmalereien und Reliefdarstellungen belegen.
Etwa auf einer Wanddekoraktion in der Villa Regina in Bosco Reale, wo ein fest mit der Achse verbundenes Scheibenrad dargestellt ist (DNP6, 1101).
Das Abschmieren der Radnaben ist schon beim älteren Cato erwähnt.
DNP 6,1999, 1100, sv Landtransport, cf. Colum. 7.2.1.
DNP 6, 1104.
Vgl. den Beitrag über das griechische Bauwesen im vorliegenden Band Abschnitt 2.5.1.
Vgl. den Beitrag über das griechische Bauwesen im vorliegenden Band Abschnitt 2.5.2.
Zum aktuellen Stand der Diskussion zusammengefasst Anderson 1997, 171ff.. Vgl. auch Bernard 2010.
Die als Beleg hierfür in der Forschung häufiger angeführte Passage bei Suetonius (Tib. 49.2.) belegt die Verstaatlichung von Steinbrüchen nicht, denn dort ist nur angegeben, dass Tiberius Gemeinden und Privatleuten die Schürfreche für Erze (das ius metallorum) entzog.
Pensabene and Arthur 1985; so auch Fant 1999.
Unter Hadrian soll die ratio nach dem Vorbild der Militärorganisation reformiert worden sein, vgl. die Epitome de Caesaribus s.v. Hadrian; s. auch Anderson 1997, Anm. 157.
Eine der bekanntesten Katastrophen ereignete sich 27 n. Chr. in Fidenae (Fidena) bei Rom kurz nach der Fertigstellung des für Gladiatorenkämpfe in Holz errichteten Amphitheaters. Ursache war anscheinend die mangelnde Festigkeit des Baugrunds, in Verbindung mit Qualitätsmängeln bei der Zimmermannsarbeit. Nach Tacitus (ann. 4. 62f.) kamen bei dem Einsturz 50.000 Menschen ums Leben. Sueton (Suet. Tib. 40) spricht von 20 000 Toten. Tacitus schreibt den Einsturz nicht der Holzkonstruktion an sich zu, sondern der extrem billigen Bauausführung, die dem Besitzer – einem Freigelassenen namens Atilius – umso größeren Profit bringen sollte.
Dazu ausführlich hier S.
Dion Hal. 1.37.4.
Vitr. 2.9f. Als Herkunftsländer der Zeder nennt er Kreta, Syrien (d. h. den heutigen Libanon) und ,Africa‘, womit das heutige Algerien und Marokko gemeint sind.
Strab. 5.2.5.
Vitr. 2.9.16. Verwendet wurde Lärchenholz in Rom für Brücken.
Plin. n.h. 12ff.
Theophr. hist. plant.; caus. plant.
Vitr. 2.9f.
Vitr. 2.9.5.
Vitr. 2.10.1-2.
Plin. n.h. 16.36.
Suet. Aug. 28.3. Vgl. Cass. Dio 56.30.3–4.
Strab. 5.3.7.
Epit. de Caes. 13, 13.
Martial 7, 20, 20.
Cic. Att. 14.9.
Plut. Crass. 2
Entsprechendes Quellenmaterial ist zusammengestellt bei Bottke 1999, Kap. 5.4.
Plin. n.h. 36.24. Er erwähnt diese Tatsache übrigens im Zusammenhang seiner Ansicht, dass Rom die bedeutendsten Bauleistungen der Geschichte geschaffen habe.
Vgl. Vitr. 2.8.16.
Vitr. 2.8.16-18.
Vitr. 2.8.18.
Erstaunlich insofern, als Herculaneum am Fuße des Vesuv buchstäblich auf Puzzolanerde gegründet war, womit hoch belastbares, betonähnliches caementitium Mauerwerk kostengünstig hätte verwendet werden können.
Der Verputz ist im Inneren Hauses auch erhalten. Vitruv spricht ihn 2.8. 20 mit Selbstverständlichkeit an, und erwähnt dabei das Problem der Risse im Putz durch das Arbeiten des Holzes.
Das Bauen in Fachwerktechnik wurde in Rom sicher nie ganz aufgegeben, denn beispielsweise für das nachträgliche Einfügen von Trennwänden, die schon aus statischen Gründen kein hohes Gewicht haben durften, waren die leichten und dünnen Fachwerkwände gut geeignet.
Vgl. dazu den Artikel über das Bauen im Neolithikum von D. Kurapkat im Band I.
Vitr. 2.3.
Vitr. 2.3.1.
Stroh erhöht die Wärmedämmung des Ziegel, was von Vitruv jedoch nicht erwähnt wird.
Vgl. dazu Vitr. 2.8.16–18.
Vitr. 2.3.2.
Er führt hier (2.8.8ff.) unter anderem den Palast des Königs Mausolos an, der für sich auch das berühmte Mausoleum – eines der sieben Weltwunder – errichten ließ. Ein Beispiel für einen klassischen Tempel, bei dem die Cellawände über einem Orthostatensockel aus Lehmziegeln erbaut worden sind, wäre der Tempel der Despoina in Lykossoura.
Vitr. 2.8.8. Stillschweigend vorausgesetzt dürfte dabei sein, dass die Mauerkronen gesichert waren (dazu im folgenden) und die Außenflächen gegen Schlagregen durch Putz geschützt bzw.regelmäßig außen mit Lehm neu bestrichen wurden.
Vitr. 2.8.18. – Eine Bauweise, die man noch heute an Backsteinbauten des 19. oder 20. Jahrhunderts beobachten kann, bei denen über der eigentlichen Ziegelwand ein solches Gesims, ebenfalls aus Ziegeln, vorkragend aufgemauert ist.
Plin. n.h. 2.84.(82).
Stichworte, teilweise auch von Vitruv gestreift, wären hier: Schnelligkeit der Bauausführung, einfache Wiederverwendbarkeit des Materials, Wärmedämmung in Winter und Hitzeschutz im Sommer.
Vitr. 2.7.1.
Vitr. 2.7.
Vitr. 2.8.
Plin. n.h. 36.3 (3.) bzw. 37.1. Der Hymettos ist ein Berg in Attica, in dem bereits im 6. Jh. v. Chr. Marmor gebrochen wurde.
Plin. n.h. 36.7 (mit bezug auf Nepos). Mamurra war auch für einen – temporären – Theaterbau zuständig, nach dessen Niederlegung er die Säulen in sein Privathaus geschafft haben könnte.
Plin. n.h. 36.5 (6.)
Plin. n.h. 36.48.
Plin. n.h. 36.49; vgl. 10 (7).
Plin. n.h. 36.1.
Strab. 5.2.5.
Lehm enthält immer einen Anteil Ton. Ist dieser Anteil relativ gering, haben die Backsteine eine geringere Festigkeit.
Mittleilung des LWL http://www.lwl.org/pressemitteilungen/mitteilung.php?urlID=24843. Vgl. auch http://www.archaeologie-online.de/magazin/nachrichten/roemischer-ziegelbrand-brachte-hohe-leistung-und-gute-qualitaet-17670/.
Die Basilica wurde um 120 v. Chr. errichtet. Ohr and Rasch 1991.
Sie werden gesammelt im Band XV.1 des CIL.
Das gilt allerdings nicht für alle Formen von römischem Mauerwerk. Mehr dazu unten im Abschnitt über die Mauern.
Prominente Beispiele dafür sind etwa der zweite Dipteros im Heiligtum von Samos, der hellenistische Tempel von Dydima bei Milet, das Olympieion in Athen, und in Selinunt der sog. Tempel G. Bei den meisten dieser Bauten haben sicher auch andere Ursachen für die Bauunterbrechungen eine Rolle gespielt. Es bleibt aber bezeichnend, dass selbst die Initiativen des Kaisers Hadrian nicht zur Vollendung der genannten Tempel in Athen und Didyma ausgereicht haben.
Vitr. 2.5.1. Silex bezeichnet genaugenommen eine Basaltlava, wurde aber auch als allgemeine Bezeichnung für harten Stein verwendet.
Vitr. 2.5.
In der italienischen Literatur auch cocchiopesto genannt, vgl. dazu Marta 1990, 34. Wurde opus signinum für Fußböden verwendet, wurden die Masse, der auch größere Terrakotta-Fragmente beigemischt wurden, anschließend poliert, gefirnisst und poliert mit unterschiedlichen Rezepturen, die Leinöl, Wachs, aber auch Rotwein enthalten konnten. Ausführlich dazu Vassal 2006.
Der sog. Romancement.ist nicht antik, sondern ein Baustoff des späten 18. Jhs,, der als hydraulischer Kalk aus stark tonhaltigem Kalkmergel gebrannt wurde, und etwa ab Mitte des 19. Jhs. von dem neuentwickelten Portlandzement verdrängt wurde.
Daher halte ich die Überlegung von L. Lancaster, die einen Zusammenhang zwischen dem Bau der ersten römischen Aquaedukte und dem Aufkommen des opus caementitium sieht, für nicht überzeugend.
Das gilt etwa für den Stillwater Staudamm in Colorado. Die Parallelen beziehen sich auf die Zusammensetzung des Beton. Es wurde neben Portlandzement ca. 70% Flugasche aus Kohlekraftwerken – ein künstliches Puzzolan – anstelle des sonst üblichen Sandes verwendet. Auch die Verarbeitung dieses Betons mit relativ wenig Wasser und zusätzlichem Verdichten ähnelt der römischen Bautechnik. Vgl. Moore 1995.
Lancaster 2005b, 57f.
Vitr. 3.4; 6.8.
Marcellus-Theater (Rossetto 1995, 99), Circus von Arles (Sintès and Arcelin 1996, 78).
in Sardeis, Kleinasien: Hanfmann 1983; Maxentius-Basilica in Rom: Calabresi and Fattorini 2005, 77–79; Kolosseum in Rom: Lancaster 2005b, 57–59.
Vgl. Lancaster 2008 Abb. 10.1.
Grundlegend bis heute Lugli 1968, 140ff.. Sehr ausführliche und reich bebilderte Darstellung der Mauerwerksformen bei Adam and Mathews 1994, 127–150.
So am Amphitheater von Grand, s. Adam and Mathews 1994, 139. Der Fall ist das auch bei vielen Brücken- und Festungsbauten, s. u.
Der Abstand zwischen den durchbindenden Ziegelschichten beträgt häufig rund zwei Meter, s. Adam and Mathews 1994, 126.
Vitr. 2.8.1.
G. Lugli etwa bezeichnet in seiner grundlegenden Arbeit La tecnica edilizata als opus caementitium nicht jedes Gussmauerwerk bzw. den Gusskern, sondern nur Bruchsteinmauerwerk mit unregelmäßiger, kleinsteiniger Verblendung, vgl. Lugli 1968, 140ff..
Vitr. 2.8.1 und 5.
Plin. n.h. 36.51.
So am Capitolinum von Terracina (Mitte 1.Jh. v. Chr.), s. Kammerer-Grothaus 1974, 229.
Vgl. etwa die sehr ähnlichen Definitionen bei Lamprecht 1996, 40 (quadratum) und Lamprecht 1996, 43 (vittatum).
So nachgewiesen an den Stabianerthermen, s. Adam and Mathews 1994, 147 Fn. 59.
Suet. Tib. 37.1. Strenggenommen lag das Lager zur Zeit seiner Erbauung außerhalb der Stadt, weil das Gesetz verbot, dass bewaffnete Truppen sich in der Stadt aufhielten.
Zum Brand Tac. ann. 15.42.
Vitr. 2.8.3ff. Vitruv denkt bei der Sicherung des Verbandes aber nicht an opus mixtum, das er – wegen der marginalen Bedeutung von Backstein zu seiner Zeit – auch nirgendwo erwähnt, sondern an Bindersteine wie beim griechischen Emplektron, und an die Verwendung von Eisenklammern.
Vgl. zu den verschiedenen Erklärungsansätzen Adam and Mathews 1994, 143.
Vgl. die Angaben der Tabelle S. 39 in: Ulrich 2007. Das Odeion des Agrippa auf der Athener Agora hatte eine Holzdecke mit einer Spannweite von 25,75 m, ist aber der römischen Architektur zuzurechnen.
An der Traiansbrücke über die untere Donau und am Odeion des Herodes Atticus am Südabhang der Athener Akropolis, beide aus dem 2. Jh. n. Chr.
Die folgenden Abschnitte sollen lediglich versuchen, einige grundlegende Zusammenhänge der in Bogen und Gewölben wirkenden Kräfte deutlich werden zu lassen. Exakte Analysen sind ausgesprochen komplex, so dass im Kontext historischer Gebäude nach wie vor Fragen offen sind. Noch 1951 kam eine amerikanische Untersuchung zu dem Ergebnis: „A general survey of the methods in use for the design or analysis of a voussoir arch indicated that these were largely of an empirical nature.“ Pippard and Chitty 1951. Eine für das theoretische Verständnis des Tragverhaltens von Baukonstruktionen wichtige Vorgehensweise ist die Analyse der Stützlinien, die zu den Methoden der graphischen Statik gehört. Eine ausführlichere Darstellung, wie sich Stützlinien römischer Gewölbe bestimmen lassen, findet sich im Appendix 4 von Lancaster 2005a, 255ff. In den letzten Jahren wurden zudem vermehrt neu entwickelte numerische Verfahren zur Analyse historischer Bauten eingesetzt, vor allem die Finite-Elemente-Methode (FEM), sowie Materialuntersuchungen, durch die exaktere Daten zu Materialqualität in Berechnungen und Simulationen einfließen können.
Zit. nach Fitchen 1986, 72.
Strenggenommen ist jeder Bogen in der Architektur ein Tonnengewölbe. Im Folgenden werden als Bogen Gewölbe bezeichnet, deren Achse kleiner ist als die Spannweite.
Schon Vitruv empfiehlt für Thermen wegen der Feuchtigkeit Decken ex structura, also aus Mauerwerk statt aus Holz, gibt aber alternativ für Balkendecken auch die Konstruktion einer abgehängten Hohldecke aus Ziegeln an, die an Eisenstangen zu befestigen waren, um die Feuchtigkeit vom Gebälk fernzuhalten (Vitr. 5.10.3).
Beispielsweise am Serapeum der Villa Hadriana, s. Rasch 1985, 133. Stichkappen werden erst in der Barockarchitektur zu einer Normalform der Belichtung.
Vgl. die Liste bei Rasch 1985.
Vitr. 6.8.3.
Ward-Perkins 1988, 107f.; die am Pantheon von außen sichtbaren Entlastungsbogen sind hingegen durchbindend.
Im Orient bekannt war das aus Lehmziegeln erbaute, nubische Gewölbe, bei dem die Ziegel mit Seilen und Gewichten fixiert wurden, so dass der zu überdeckende Raum beim Bau leer bleiben konnte. Beispiele aus Ninive und Ktesiphon bei Hart 1965.
Bei einer Maueröffnung – Fenster, Tür oder Tor – konnte man den offenen Raum auch provisorisch, z. B. mit gestapelten Ziegelsteinen ausfüllen, die nach dem Aufmauern und Erhärten des Bogens wieder entnommen wurden, wie es schon bei Philon (2. Jh. v. Chr.) für den Bau eines Kragsteintores beschrieben ist (Philon, Buch 8 Paraskeuastika).
Die Mehrheit der Forscher nimmt ein solches, zentrales Lehrgerüst an; contra Adam and Mathews 1994, 175f.; Taylor 2003, 195–208.
Auf solchen Balkennestern beruhen auch die meisten Rekonstruktionen von hölzernen Dachtragwerken.
Hingewiesen sei hier nur auf die Belagerung von Rhodos 305/4 v. Chr. durch die Truppen des Königs Demetrios. Die Angaben zur Basislänge und zur Höhe des berühmten Belagerungsturmes des Athener Architekten Epimachos schwanken in den Quellen stark (Höhenangaben zwischen ca. 30 und 45m, vgl. Diod. 20.91.2; Plut. Demetr. 21.1; Vitr. 10.16.4).
Zum mehrgeschossigen Wohnbau in Fachwerktechnik vgl. oben Abschnitt 3.5.2.
Bei Dachstühlen, die lediglich die Lattung und die Dachziegel tragen mussten, sind die genannten freien Spannweiten allerdings schon früh deutlich überschritten worden (mit Tragwerken vom Typ der sog. Palladiana? Zur Bedeutung solcher Tragwerke in der Spätantike vgl. Valeriani 2006). Erwähnt sei als Beispiel dafür das theatrum tectum in Pompeji, das kurz nach 80 v. Chr. erbaut wurde, nachdem die Stadt von den Römern erobert und durch Sulla zur römischen Kolonie gemacht worden war. Der Bau war vom Typus her einem griechischen Odeion zu vergleichen. Das namensgebende Dach, dessen Konstruktion anhand der Baureste nicht rekonstruierbar ist, hatte eine freie Spannweite von ca. 25 m, was mit einfachen Balken nicht zu überdecken gewesen wäre.
Vgl. Abb. 20 bei Lancaster 2005a.
Zur Traiansbrücke s. unten S.
F. Rakob, Römische Kuppelbauten in Baiae, RM 95 (1988).
Rakob 1961, 138f.; Datierung „augusteisch“ bei 188, Abb. 447.
Abgebildet bei Adam and Mathews 1994, 425, Zeichnung F. A. Choisy.
Vgl. dazu ausführlich Lancaster 2005a, 29ff. sowie die Liste entsprechender Bauten, ebenda Appendix Catalogue 2D.
Zum Gewicht der unterschiedlichen Gesteinsarten der caementa umfassend Lancaster 2005b, 59ff.
Beschrieben mit Proportionsregeln für die Dimensionierung bei Vitr. 6.8.6.
Zum folgenden vgl. Lancaster 2005a, 268f.
Zur Verwendung von Eisenankern ausführlich Lancaster 2005a, 113ff.
Straccioli 2003; Radke 1971; Herzig 1974; Pekary 1968; Walser 1970; Casson 1974 [ND 1994]; Bender 1975; Chevallier 1976 [ND 1989]; Chevallier 1988; Radke 1971; Schneider 1982, 85–96; Schreiber 1985; Heinz 1988, 1–72; Sidebotham 1991; Laurence 1999; Nuber 2005; French 1981; Wiseman 1970; Davies 1998.
Dion. Hal. 3.67.5.
della Portella 2004 (org. italienisch 2003)
Appia teritur regina longarum viarum; Stat. silv. 2.2.
Strab. 5.3.6.
Liv. 38.28.3.
Liv. 41. 27.5. Die Angabe von G. Pisani Sartorio in della Portella (2004) 26, die Appia sei schon 191 v. Chr. bis Capua komplett gepflastert gewesen, ist unzutreffend.
Die Leuge war ein (ursprünglich keltisches?) Längenmaß, das eine Wegstunde bezeichnete. Sie wurde ab traianischer Zeit als Wegmaß verwendet und mit eineinhalb römischen Meilen gleichgesetzt (ca. 2,2 km).
Überblick über die in Südwestdeutschland nachgewiesenen Formen der stationes bei Seitz 2005.
Ulpian Dig. 43.8.2.20-24.
Liv. 1.33.6. Die Regierungszeit des Königs Ancus Marcius wird von der Tradition in die Jahre 640–616 v. Chr. gesetzt.
Caes. Gall. 4.17.
Zu den Brücken über den Bosporus und die Dardanellen siehe den Beitrag über die griechische Architektur im vorliegenden Band Abschnitt 2.6.9.
Vitr. 5.12.5(6).
Vitr. 5.12, 1–5.
Man könnte, wie etwa Fensterbusch in der entsprechenden Passage seiner Übersetzung, von einem Senkkasten sprechen. Das ist allerdings missverständlich insofern, als „Senkkasten“ in der heutigen Terminologie einen unten geschlossenen Kasten bezeichnet. Vitruvs Verfahren entspricht eher dem, was man heute als „Kofferdamm“ (engl. coffer dam) ansprechen würde.
CIL VI 1199a.b = CLE 899; Galliazzo and Chevallier 1995, 45.
So am Pont-Saint-Martin im Aostatal, vgl. O’Connor 1993, 169.
So beispielsweise bei Schneider 2005, 9.
Die Aufnahme zeigt spätere Reparaturbogen. Die originalen Segmentbogen sind jedoch gesichert durch die Ansätze der Bogen an Pfeilern, bei denen das Mittelstück der Bogen nicht mehr erhalten ist.
Cass. Dio 68.13 und Prok. aed. 4.6.11–18.
Die Darstellung ist in dieser Hinsicht nicht ganz eindeutig. Sicher scheint zu sein, dass der jeweils unterste Sprengbogen an dem Bohlenkasten unter den dreieckigen Böcken abgestützt war. Ob auch die mittleren Sprengbögen dort abgestützt waren (wie auf der Detail-Abbildung rechts), oder schon an den Streben der Böcke (wie auf der Detail-Abbildung links), ist uneinheitlich dargestellt.
Cic. Att. 3.1
Vgl. Donderer 1996, A121.
Zur Inschrift vgl. Donderer 1996, A142.
Vitr. 8.6.2; Frontin. de aq. 1.25.
Apollodor beispielsweise soll noch unter Hadrian die Aufrichtung der der ca. 30m hohen Statue der Luna geleitet haben, die der Kolossalstatue des Sol (die zuvor eine Kolossalstatue Neros war) beigefügt werden sollte. SHA Hadrian 19,12.
Vitr. 10.1f.
Belegt unter anderem durch Apollodors Schrift über die einfachen Kriegsmaschinen.
Vitr. 10.3ff. Der Uhren- und Orgelbau durch Architekten ist nur bei Vitruv bezeugt (vgl. Vitr. 9.)
Zu den Inschriften, die Schiffbauarchitekten nennen, s. Donderer 1996, 45f. und Katalog. Textquellen zum Schiffbau sind nicht erhalten.
Mit Ausnahme von Vitruv, der jedoch kein Neubauprojekt geleitet hat, cf. Frontin. de aq. 1.25.
Dig. 50.10.3.2.
Zur Terminologie der Inschriften vgl. Donderer 1996, 18–24.
Vitr. 1. praef. 2.
Vitr. 5.1.6–10.
Frontin. de aq. 1.25, vgl. Vitr. 8.6.2.
Auch hier fehlen allerdings für die erwähnten Projekte meist dezidierte Angaben. Explizit bestätigt ist für ihn in den Quellen nur die Traiansbrücke und das Traiansforum. Vor allem fehlt der Nachweis, dass er das Pantheon entworfen hat.
Vitruv erwähnt, dass diese Architekten sich nicht um Kommissionen bewarben, sondern von den Bauherrn angesprochen wurden; Vitr. 6. praef. 6. Vgl. aber für die Kaiserzeit Gell. 19.10.2.
Plut. Crass. 2.
Sicher unzutreffend als „slave architect Cyrus“ angesprochen bei Burford 1972, 126.
Cic. Att. 14.3.
Es handelt sich um eine kampanische Bauinschrift aus der Mitte des 1. Jhs. v. Chr., deren letzte Formulierung lautet: „Architekt (war) Hospes, der Sklave der Appia“. Vielleicht war die Namensnennung eine Bedingung der Besitzerin. Donderer 1996, A118.
Vgl. die entsprechenden Abschnitte im Artikel über das griechische Bauwesen.
Vitr. 1. praef. 2.
Donderer 1996, 41–45. Dort wird auch deutlich, dass innerhalb der Legionen für Architekten ein Aufstieg von der Fachabteilung zu einem regulären militärischen Kommando möglich war.
Dig. 50.6.7.
A. Victorinus, tätig unter Justinian: Donderer 1996, A24–29.
Zu den Freigelassenen und den Sklaven des Kaiserhauses allgemein s. Chantraine 1967.
Tac. ann. 15.42.
Zu Rabirius vgl. Anderson 1997, 55.
SHA Hadrian 19.13; Dieselbe Quelle, die Historia Augusta, enthält allerdings auch den – wenig glaubwürdigen – Bericht über die Ermordung Apollodors auf Befehl Hadrians, kann also nicht als durchgängig glaubwürdig eingestuft werden.
Vgl. Donderer 1996, 51–55 mit Sammlung der Belege.
Zur Ausbildung s. Stoll 2001; Donderer 1996, 57-61; Anderson 1997, 15ff..
Vitr. 6. praef. 6.
Das Material ist zusammengestellt bei Donderer 1996, 58 m. A. 204f.; vgl. auch Anderson 1997.
Rom bezog seinen Marmor in dieser Zeit – allerdings kaum zur Verwendung in der Architektur – aus dem Ägäisraum. Die Brüche von Carrara waren seinerzeit noch nicht erschlossen.
Dabei wird – etwa von Anderson 1997, 45 – angenommen, dass der in der Inschrift genannte Unternehmer (redem[ptor]) mit Namen L(ucius) Cocc(eius) identisch ist mit dem oben angesprochenen freigelassenen Architekten Lucius Cocceius Auctus; zurückhaltender hingegen Donderer 1996, A105, der zu bedenken gibt, das die in der Inschrift genannten Person auch der Freilasser der Auctus gemeint gewesen sein kann
Strab. 5.4.5.
Vitr. 6. praef. 4.; vgl. auch 4.8.7.
Donderer 1996, A155 mit entsprechendem Kommentar.
Freigelassene waren die im voraufgehenden Abschnitt schon genannten Architekten Chrysippus und Corumbus, wobei bei beiden nicht klar ist, ob ihr Freilasser selbst Architekt war oder nicht, und wenn ja, ob der Freilasser selbst freigeborener römischer Bürger oder seinerseits ein Freigelassener war. Vgl. zu beiden Anderson 1997, 33.
Edict Diocl. 7,74.
Dig. 19.2.13.3 (Ulpian).
Hist.Aug.Alex.Sever. 44,4.
Cod. Theod. 13.4.1.
Cod. Theod. 13.4.2.3.
Polybios kam als Geisel nach Rom, nachdem der Archäerbund, an dessen Leitung er beteiligt war, von den Römern vernichtend geschlagen worden war. Er hatte später Zugang zu führenden römischen Persönlichkeiten ('Scipionenkreis'), und wurde auch als Berater der Scipionen bei Feldzügen geschätzt.
Zu Catos Auffassungen vgl. etwa Plin. n. h. 29.14.
Cic. orat. 2.265.
Zum Tempel von Cori ausführlicher und mit der weiteren Literatur Osthues 2005, 67f.
Plin. n. h. 34.31; 36.42
Vell. 1.11; 2.1.
Vitr. 3.2.5.
Vgl. dazu ausführlicher die Angaben zum Marmorimport oben im Abschnitt über die Baumaterialien.
Nep. ap. Priscian 8.17.
Plin. n.h. 36.25f.
Cic. orat. 1.62. Mit der möglichen Verteidigung des Hermodoros durch M. Antonius will Cicero sagen, dass ein kompetenter Gerichtsredner auch sachgerecht über Fachgebiete sprechen könne, die nicht in sein eigenes Fachgebiet fallen.
Plin. n. h. 36.42. Allerdings hat der Hinweis bei Plinius eher anekdotischen Charakter, denn die Architekten Saura und Batrachus (wörtlich: Eidechse und Frosch) sollten ihr Werk trotz Verbot signiert haben mit kleinen Ritzzeichnungen, die ihre Namen bildlich darstellten; vgl. Donderer 1996, 31.
Plin. epist. 10.40.3.
Vgl. dazu den Beitrag über die griechische Architektur im vorliegenden Band Abschnitt 2.8.2
Vitr. 4. praef. 1.
Vitr. 7. praef. 12.
Prok. aed. 4.6.12–13.
Cass. Dio.68.13.
Plinius erwähnt Vitruv im Zusammenhang mit Holz (n.h. 16,1), Stein (n.h. 36,1) und Farbe (n.h. 35,1).
Bei Cetius Faventinus unter dem Titel de diversis fabricis architectoniae.
So bei Servius in seinem Vergil-Kommentar vom Ende des 4.. Jhs. n. Chr. (Serv. ad Aen. 6.43). Sidonius Apollinaris, Stadtpraefekt von Rom und später Bischof, zitiert ihn in seinen Briefen ebenfalls (Sidon epist. 4.3.5 und 8.16.10).
Vitr. 6.8.8.
Vitr. 1.1.18.
Vitr. 1. praef. 3.
Vitr. 6. praef. 4.
Vitr. 1. praef. 3.
Vitr. 6.8.3.
Vitr. 5.10.3–4.
Vitr. 6.8.7.
Vitr. 4.1.1f.
Vitr. 2.6.
Zur Entwertung der dorischen Ordnung, zum Tempel von Cori und zu Vitruvs Lösung des Eckkonflikts ausführlicher Osthues 2005.
Weitere Kandidaten für die Stellung als erster Rundbau von zwanzig oder mehr Metern Durchmesser mit Betonkuppel wären der sog. Mercurtempel in Baiae und der sog. ,Apollontempel‘ am Averner See, die beide ebenfalls zu Thermenkomplexen gehörten. Siehe oben S.
Vitr. 5.10.4.
bessales und sesquipedales, Vitr. 5.10.2.
Vgl. oben S.
Kurze, aber kritische Bewertung der praktischen Relevanz Vitruvs auch bei Anderson 1997, 187, sowie bei Jones 2000b.
Ein solcher Wandertempel ist aus Kassope in Nordwestgriechenland bekannt. Der Anlass für die Zerlegung und den Wiederaufbau des Tempels an anderer Stelle war die Gründung der Stadt Nikopolis (,Siegerstadt‘). Sie wurde von Augustus zum Gedenken seines Sieges bei Actium angelegt. Die Bewohner der umliegenden alten Gemeinden wurden gezwungen, in die neuangelegte Stadt umzusiedeln. Vgl. dazu Hoepfner and Schwandner 1994, 144, und weiter zu Wandertempeln die ebd. Anm. 324 genannten Literatur.
Sowohl die genaue Herkunft wie die Art des Gebäudes hat sich jedoch nicht bestimmen lassen. Zum Wrack s. Hellenkemper-Salies et.al. 1994.
Vgl. den Beitrag über die griechische Architektur im vorliegenden Band Abschnitt 2.3.6.
Vitr. 5.11.1; 6.3.10; 6.7.7. Vitruv bezieht sich damit summarisch auf die Bautraditionen Mittelitaliens, die er von denen der Kelten im Norden und der Griechen im Süden absetzt. Vgl. dazu Spoleto 2004.
Der Einfluss der alexandrinischen Architektur lässt sich zwar nur sehr begrenzt an Ausgrabungen in Alexandria selbst nachvollziehen, da die Stadt modern überbaut ist. Wichtige Hinweise gibt aber die Architektur der Cyrenaika im heutigen Lybien, die direkt von Alexandria beeinflusst gewesen sein dürfte; vgl. dazu Pesce 1950; speziell zum Konsolgeison Hesberg 1981.
Konchen, griechisch „Muschel“, lateinisch concha, bezeichnet eine im Grundriss runde Nische in Wänden, mit halbkuppelförmigem oberem Abschluss, der oft mit in Stuck ausgeführter Kassettierung ausgestaltet war.
Zu den pompeianischen Stilen grundlegend: Mau 1882; speziell zum ,Mauerstil‘ Laidlaw 1985.
Cocciopesto findet man früh im westlichen Teil Siziliens, in Selinunt und Solunt, d. h. von Griechen gegründeten Städten, die lange Zeit unter punischer Herrschaft standen.
Cocciopesto wurde bereits in archaischer Zeit von den Etruskern zur Abdichtung von Wasserkanälen verwendet, vgl. Ravelli and Howarth 1984.
Das Nebeneinander zweier Kulträume ist vereinzelt auch in Griechenland anzutreffen, etwa bei den Tempeln auf dem sog. Dörpfeld-Fundament auf der Athener Akropolis.
Das Atriumhaus ist bisher frühestens im 4. Jh. v. Chr. nachweisbar, und zwar in Etrurien wie auch in Rom. Allein aufgrund von Baubefunden wäre es daher nicht eindeutig zu sagen, ob es sich um einen etruskischen oder einen römischen Haustyp handelt; s. auch Barton 1996. Die Römer selbst schrieben das Peristylhaus aber den Etruskern zu, so Varro (LL 5.161.5) und auch Sextus Pompeius Festus (Paul. Fest. 12.18ff.).
Kompositkapitelle finden sich zuerst in flavischer Zeit (letztes Drittel des 1. Jhs. n. Chr.). Der Typus wurde noch in frühbyzantinischer Zeit.verwendet.
Die Integration der Agora in ein rechtwinkliges Straßenraster gilt als Konzept, das Hippodamos von Milet bei der Anlage des Piräus – des Kriegs- und Handelshafens von Athen – im ersten Viertel des 5. Jhs. v. Chr. erstmals entwickelt und verwirklicht hat; vgl. Hoepfner and Schwandner 1994.
Zur Basilika s. den folgenden Abschnitt.
Suet. Vesp. 9.
Eine Ausnahme davon ist die Basilica Aemilia; allerdings ist die Zuordnung der Bauglieder zu den verschiedenen Bauphasen bzw. Restaurierungen nicht mit Sicherheit möglich.
Zur Maxentiusbasilica s. oben S.
So an dem aus Lehmziegeln erbauten Palast des karischen Königs Maussolos, cf. Plin. n. h. 36,47. Plinius nennt hier den Palast des Königs als erstes (ihm bekanntes) Bauwerk mit Marmorinkrustationen, für die Marmorblöcke mit der Steinsäge in zu Platten zerschnitten wurden. Vitruv (2.8.10), auf den sich Plinius ausdrücklich bezieht, spricht allerdings nicht von gesägten Marmorplatten, sondern von Verputz, womit er einen Putz aus Kalk und Marmormehl gemeint haben könnte, der anschließend geschliffen worden sein dürfte („Sie sind so glatt verputzt, daß sie die Durchsichtigkeit von Glas zu haben scheinen“). Zu römischen Inkrustationen vgl. Bitterer 2013.
Die Steinsäge war bereits in augusteischer Zeit bekannt; Vitruv erwähnt eine Säge mit gezahntem Blatt für das Schneiden weicher Tuffe, Vitr. 2.7.2.
Vespasion hat die Vorteile der vorgeschlagenen Verfahrensweise sicherlich erkannt, denn er honorierte den Vorschlag, obwohl er ihn nicht aufgriff; Suet. Vesp. 18.
Plut. Per. 10.
Vitr. 2.8.5f.
Sen. ep. 90.32.
Noch häufiger, „als die Zahl der registrierten Beispiele vermuten lässt“, Ward-Perkins 1988, 177.
Nur die vier die Kuppel tragenden Pfeiler sind aus Naturstein errichet.