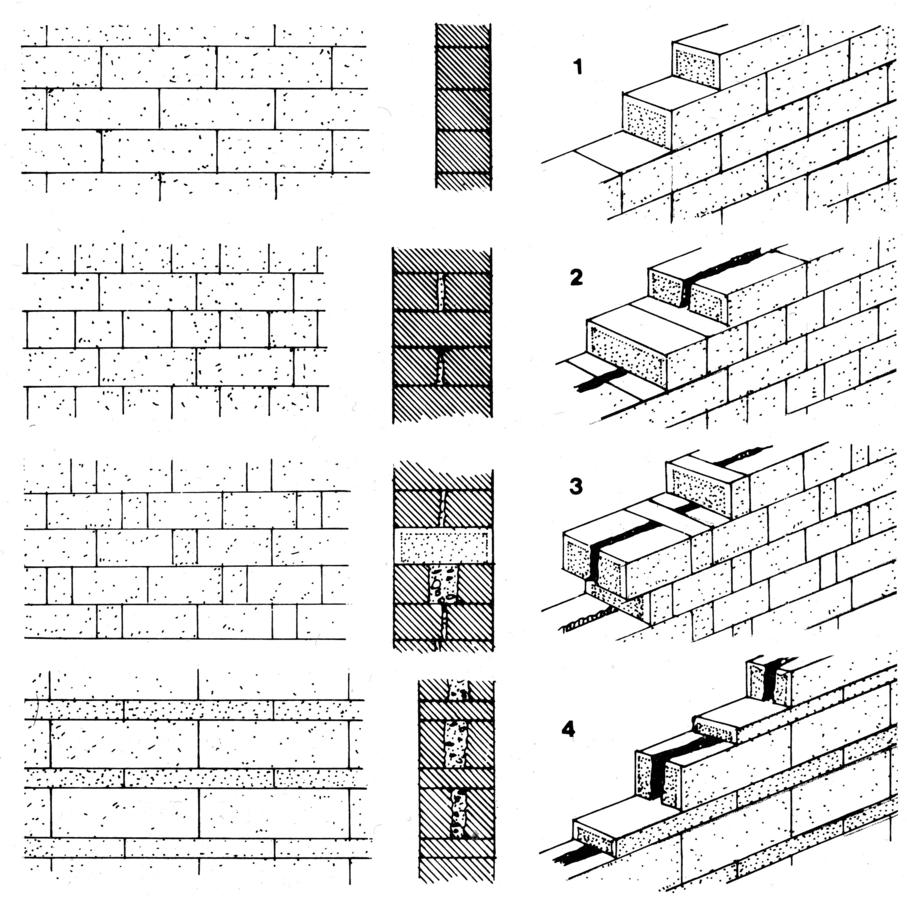2.1 Historische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen der Entwicklung der griechischen Architektur
Dieser Gegensatz zwischen der relativen Homogenität der Architektur und der Vielfalt der Entwicklungen auf gesellschaftlicher und staatlicher Ebene bedeutet keineswegs, dass die Architektur eine von der übrigen Entwicklung losgelöste Sphäre gewesen wäre. Die Beziehungen sind nur nicht so offensichtlich wie in anderen Epochen. So lässt sich beispielsweise innerhalb der Architekturentwicklung selbst keine Erklärung dafür finden, warum etwa die größten, und damit technisch in mancher Hinsicht schwierigsten Bauprojekte keineswegs, wie in vielen anderen Epochen, nicht erst am Ende der Periode realisiert worden sind, sondern im Gegenteil schon sehr früh, nämlich in hoch- und spätarchaischer Zeit. Erklärbar ist das nur, wenn man die Projekte im politischen Kontext sieht, zu dem sie gehörten: Sie waren Werke der älteren Tyrannis, von deren Megalomanie sich spätere Staatswesen erkennbar absetzen wollten. Auch die Organisation des Bauwesens hat sich im Gefolge der gesellschaftlichen Entwicklung nachhaltig verändert. Während die frühen Tyrannen offenbar große Teile ihrer Untertanen für ihre Projekte pauschal zum Dienst verpflichteten, haben die Demokratien die Projekte in vergleichsweise kleine Baulose aufgegliedert, die – soweit erkennbar – unter Leitung eines Architekten von privaten Unternehmern realisiert wurden. Des Weiteren wird man beispielsweise auch die prominente Stellung, die das korinthische Kapitell in hellenistischer Zeit einnahm (und später von den Römern aufgegriffen wurde), kaum erklären können ohne Bezug auf den besonderen Repräsentationsanspruch der hellenistischen Königshäuser, der sich eben nicht in übermäßig großen Bauwerken manifestiert hat.
Als Bezugsebene für entsprechende Überlegungen soll nachfolgend ein ganz knapper Abriss der gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen der hier betrachteten Epochen vorangestellt sein.1
2.1.1 Archaische Zeit (8.–6. Jh.)
Spätestens zu Beginn der archaischen Epoche, eventuell auch etwas früher, entsteht die Polis, der griechische Stadtstaat, der gleichermaßen Siedlungsform und autonome politische Einheit ist. Die Stadt als reine Siedlungsform wurde als ἄστν bezeichnet. Zur Polis gehörte stets ein meist naturräumlich definiertes Umland, die χὼϱα, für die Produktion der Nahrungsmittel. Wohl häufiger entstand die Polis nicht durch natürliches Wachstum, sondern durch einen formellen politischen Zusammenschluss den συνοικισμόϛ (das ‚Zusammenwohnen‘) verschiedener Dörfer und Weiler, wie etwa Athen auf Initiative des legendären Gründers Theseus.2 Man kennt heute etwa siebenhundert solcher autonomen griechischen Städte. Nur im Norden des Festlandes, in Aitolien
Große Bedeutung für den Prozess der Urbanisierung, und sicher in archaische Zeit zu datieren, ist die sog. ältere Kolonisation. Ihr Schwerpunkt fällt in die Zeit von ca. 750 bis 550/40.3 Ausgelöst vor allem durch Nahrungsmangel, aber auch durch schwere Fraktionierungen in der Bürgerschaft bis hin zum Bürgerkrieg, oder auch durch kriegerische Verdrängung, sendete eine Mutterstadt (μητρόπολιϛ), manchmal auch mehrere Städte gemeinsam, Kolonisten aus. Die Koloniestädte waren politisch unabhängig von ihren Mutterstädten – Steuern werden nur ausnahmsweise abgeführt – und gaben sich selbst Verfassungen. Häufig bildeten die Familien der ersten Kolonisten den späteren Adel. Kolonien wurden meist in unbesiedelten Gebieten niedergesetzt, aber gleichwohl meist sehr früh befestigt. Koloniestädte konnten innerhalb von relativ kurzer Zeit wiederum selbst zu Metropoleis neuer Kolonien werden. Schwerpunkte der älteren Kolonisation waren der nördliche Ägäisraum
Die griechischen Gesellschaft der archaischen Epoche unterscheidet sich in politischer Hinsicht von den vorhergehenden Epochen – der späten Bronzezeit, d. i. in Griechenland
Die Aristokratien vergaben öffentliche Ämter auf jeweils ein Jahr, meist als Wahlamt. (Die Bestimmung der Amtsträger durch das Los ist eine spätere, demokratische Verfahrensweise, weil dadurch die Organisation von Stimmkontingenten durch einflussreiche Adelige verhindert wurde.) Eine Trennung zwischen den ‚Beamten‘ und der Priesterschaft gab es in der Regel nicht, vielmehr gehörte zu den Amtspflichten eines Teils der Beamten wesentlich die Ausübung kultischer Handlungen. Erbliche Priesterämter gab es nur in einigen Heiligtümern.
Parallel zu diesen Aristokratien gab es etwa seit dem 7. Jahrhundert in allen Teilen des griechischen Siedlungsgebietes auch bedeutende Stadtstaaten, die von Alleinherrschern, den sog. Tyrannen, beherrscht wurden. Zu diesen Poleis zählten im Mutterland beispielsweise in Korinth
Der politische Partikularismus der Griechen, der mit der Polisbildung verbunden war, erklärt die hohe Bedeutung regionaler oder gemeingriechischer, ‚panhellenischer‘ Heiligtümer. Zwar wurden die Heiligtümer durch einzelne Städte oder Städteversammlungen kontrolliert, doch galt der Zugang zu den Heiligtümern und den dort abgehaltenen periodischen Festen als Recht aller Griechen. Nur sehr selten wurden einzelne Poleis von der Teilnahme an den Festen und Spielen ausgeschlossen, und das auch nie auf Dauer. Die Heiligtümer erhielten bedeutende Stiftungen von den Städten, etwa den Zehnten der Kriegsbeute, die dem Kultinhaber des Heiligtums geweiht wurde. Für die Entwicklung der Architektur von erheblicher Relevanz waren die Gebäudestiftungen in den Heiligtümern. So bauen einzelne Städte dort eigene ‚Schatzhäuser‘ zur Aufbewahrung von wertvollen Weihgeschenken. Große Tempelbauten wurden entweder durch die verwaltenden Städte finanziert, oft mit Kriegsbeute, oder durch Sammlungen unter den Städten mit besonderer Beziehung zum jeweiligen Heiligtum. Erst ab der Spätklassik wurden Bauten in den panhellenischen Heiligtümern auch von Einzelpersonen gestiftet.
2.1.2 Klassische Zeit (5. und 4. Jh.)
Das fünfte Jahrhundert war im Mutterland durch zwei große Konflikte bestimmt: die Auseinandersetzung mit dem Perserreich, die v. a. die erste Jahrhunderthälfte bestimmte, und den ‚peloponnesischen‘ Krieg zwischen Athen und Sparta, der die Entwicklungen im letzten Drittel des Jahrhunderts dominierte. Im Westen setzten sich die Griechen, annähernd zeitgleich mit dem Sieg über die Perser im Osten, auch gegen eine weitere antike Großmacht durch: Unter den Tyrannen von Syrakus
Die Perserkriege brachten den Griechen im Ergebnis ein teilzerstörtes Land und reiche Beute. Beides galt insbesondere für Athen
Die neugewonnene Machtstellung Athens
Die Rivalität zwischen Athen
Im folgenden 4. Jahrhundert kämpften zunächst die großen griechischen Stadtstaaten untereinander um die Vorherrschaft (Hegemonie), die jedoch von keiner der beteiligten Poleis dauerhaft etabliert werden konnte. Der vorläufige Gewinner dieser Auseinandersetzungen war der alte gemeinsame Feind vom Anfang des fünften Jahrhunderts, das Perserreich, das hauptsächlich durch Geldmittel schon zuvor massiven Einfluss auf den Ausgang des peloponnesischen Krieges zwischen Athen und Sparta genommen hatte. Der allgemeine Landfrieden von 386 mit Zusicherung der Autonomie der Städte wurde offen den Persern zugeschrieben (‚Königsfrieden‘).
Entscheidend zurückgedrängt wurde der persische Einfluss etwa ab der Mitte des Jahrhunderts durch den Aufstieg des makedonischen Königshauses unter Philipp II.
2.1.3 Hellenistische Zeit (323 bis 31)
Als Epochenbegriff bezeichnet der Hellenismus die Zeit vom Tod Alexanders
Die Ausbreitung der griechischen Kultur als das bestimmende Merkmal der Epoche hatte ihre politische Basis in den Ergebnissen des Alexanderszuges
Diese zunächst durch Eroberungen bedingte Ausbreitung führte zur Übernahme der griechischen Kultur auch durch Staaten und Städte, die niemals von Griechen erobert oder beherrscht worden waren. Ein prägnantes Beispiel dafür ist der mittelitalische Hellenismus, dem auch Rom
Die zunächst noch selbständige hellenistische Staatenwelt unterschied sich bereits grundlegend von der Polisgesellschaft der klassischen Zeit. Auf der einen Seite entstanden als Territorialstaaten die hellenistischen Großreiche der Antigoniden (Makedonien
In griechischen Mutterland entstanden in dieser Phase Staatenbünde, mit denen die autonomen Poleis ihre Freiheit zu sichern suchen. Staatenbünde waren zwar an sich schon viel früher entstanden, doch waren sie in älterer Zeit meist Organisationen direkter oder indirekter Herrschaft einzelner Poleis wie Sparta
Neben den alten Poleis stand die schon angesprochene große Zahl neuer Städtegründungen im Osten, vor allem auf dem Gebiet der heutigen Türkei
Gemeinsam war den alten und den neuen Städten in hellenistischer Zeit, dass das urbanistische Niveau der Städte oft weit höher lag als das der klassischen Poleis. Die Anzahl und die Qualität öffentlicher Bauten stieg erheblich. Viele Städte verfügten über politische und Handelsmärkte, die von Säulenhallen (Stoen) eingefasst, und deren Freiflächen gepflastert wurden. Hinzukamen Theater, Gymnasien und Palästren für Sport und Freizeit, öffentliche Bibliotheken und Amtsgebäude für die Verwaltung. Die meisten dieser Gebäudetypen waren an sich älter, wurden in hellenistischer Zeit aber sehr viel häufiger gebaut, und nicht selten mit sehr viel mehr Aufwand. Ein weiterer Unterschied zur klassischen Epoche war der aufkommende Luxus im Bereich der Wohnhäuser wohlhabender Privatleute. Vorbild waren die Paläste der hellenistischen Herrscher, die ihrerseits keine Vorbilder in archaischer und klassischer Zeit hatten. Der private Wohlstand der Oberschicht führte zudem zur Monumentalisierung der Sepulkralarchitektur. Es entstanden z. B. Grabanlagen mit mehreren Räumen, und teilweise unterirdischen Grabkammern.
Die frühe Phase des Hellenismus war, trotz der vielen Kriege, per saldo in vielen Gebieten eine Periode der Moderne und des Wohlstands. In die umgekehrte Richtung verlief die Entwicklung allerdings nach den Eroberungen der Römer. Ihr Ziel war nicht die Entwicklung, sondern die Ausbeutung der Städte, die bis zur Plündung und Zerstörung sowie zur Versklavung der Wohnbevölkerung reichte, wenn die Städte in Aufstände gegen die römische Herrschaft verwickelt waren. Die Zerstörung Korinths
2.2 Bauverwaltung
Das Prinzip, Entscheidungen und Abläufe von öffentlichen Bauprojekten durch Inschriften dauerhaft und öffentlich zu dokumentieren, ist fast so alt wie der griechische Werksteinbau: die ältesten Fragmente solcher Aufzeichnungen datieren in die Mitte des 6. Jahrhunderts. Wirklich fassbar wird die Verwaltungsorganisation in Inschriften aber erst ab der Mitte des 5. Jahrhunderts in Athen
Die Inschriften lassen sich, entsprechend ihrer Bedeutung im Bauprozess, etwa folgendermaßen typisieren:8
Baubeschlüsse öffentlicher Gremien, teilweise mit Bestimmungen für die Konzeption und Durchführung des jeweiligen Projektes,
Projektbeschreibungen;
Stücklisten mit technischen Spezifikationen, teilweise mit Angabe der jeweiligen Lieferanten;
einzelne Leistungsverträge zwischen Baukommissionen und Unternehmern und deren Abrechnung;
periodische Rechenschaftsberichte der Baukommissionen zur Herkunft und Verwendung von Geldmitteln:
allgemeine, gesetzliche Regeln für das Bauen, und speziell für die vertraglichen Beziehungen von Auftraggebern und Unternehmern (‚Bauvertragsrecht‘ bzw. ‚Verdingungsordnungen‘).
Hinzukommen noch Angaben in Dokumenten der allgemeinen Finanzverwaltung, die vor allem die Baufinanzierung oder Mittelzuweisung betreffen, sowie Ehrenbeschlüsse und Ehreninschriften, die auf Bauaktivitäten der Geehrten Bezug nehmen.
In ihrem Aufbau entsprechen diese Inschriften meist den üblichen Regeln für die Dokumentation von Beschlüssen und Verwaltungsvorgängen. Am Anfang der Inschriften, im sog. ‚Praeskript‘, wird meist angegeben, um welches Gremium es sich handelt, wer Mitglied war und gegebenenfalls in welcher Funktion, und die Datierung.
Gewisse Schwierigkeiten für die Interpretation der Urkunden ergeben sich erstens aus der dezentralen politischen Struktur, d. h. der politischen Autonomie der Poleis. Keiner Stadt war es verwehrt, individuelle Organisationsformen und Amtsbezeichnungen festzusetzen. Selbst in Phasen, in denen die politische Autonomie der Poleis massiv beschränkt wurde, blieb das Bauwesen stets einer der wenigen Bereiche, in denen sich die Autonomie der Städte noch geltend machen konnte. Sprachlich sind die auch in amtlichen Urkunden verwendeten Dialekte kaum ein Problem, eher die Interpretation der handwerklich-technischen Termini. Die bei weitem größte Schwierigkeit in der Auswertung der Bauinschriften liegt jedoch in ihrer Erhaltung: Fast immer sind nur mehr oder weniger große Bruchstücke der Inschriften erhalten, manchmal auch Abschnitte durch Erosion oder Zweitverwendung der Steine unleserlich. Die Zuverlässigkeit der Ergänzungen der Texte durch die Herausgeber ist pauschal nicht zu beurteilen. Vor allem dann, wenn mehr oder weniger standardisierte Formulierungen in periodischen Berichten, Listen, bei Praeskripten usw. verwendet wurden, sind Ergänzungen problemlos möglich. Oft jedoch sind für die Interpretation zentrale Begriffe ergänzt, die zwar das Richtige treffen können, naturgemäß jedoch nicht als Beleg für den entsprechenden Sachverhalt herangezogen werden können.
2.2.1 Die Bauherren
In den gemeingriechischen Heiligtümern trat als Bauherr entweder das leitende Gremium des Heiligtums auf, oder aber auswärtige Stifter. Die Mitglieder der Gremien, die den Heiligtümern vorstanden, wurden meist von der Stadt delegiert, auf deren Territorium das Heiligtum lag, wie für die Boulé von Olympia
Als Person bekannte Bauherrn sind zunächst meist Alleinherrscher wie Könige oder Tyrannen. Den Herrschern der sog. älteren Tyrannis der archaischen Zeit schreiben die antiken Quellen häufig die Initiative für große Bauprojekte zu: Polykrates von Samos
Aus dem 5. Jahrhundert kennt man vereinzelt ‚private‘ Stifter, meist Adelige, die aus wohlhabenden Familien stammten und öffentliche Ämter wahrnahmen. Ab dem späten 4. Jahrhundert kennt man auch Stifter, die durch Gewerbe zu Vermögen gekommen waren. In hellenistischer Zeit hängen städtische Bauprojekte zunehmend stärker von der Finanzierung durch lokale Honoratioren ab. Aufgrund entsprechender Ehrungen und Danksagungen durch die Städte sind einige von ihnen namentlich bekannt.
2.2.2 Baufinanzierung
Erstaunlich ist, dass trotz der oft enorm hohen Kosten und der Probleme mit unzureichenden Finanzierungen, die ja durch Bauten wie die oben genannten bekannt gewesen sein müssen, in den Quellen sich kaum Hinweise auf Kalkulationen von Gesamtbaukosten finden, und zwar auch dort nicht, wo der Baubeschluss erhalten ist. Einfach war die Finanzierung wohl nur dann, und erforderte auch keine weitergehende Finanzplanung
2.2.3 Zuweisungen aus öffentlichen Kassen und Abtretungen von städtischen Einnahmen
Ein bekanntes Beispiel für eine Mischfinanzierung ist der Bau des Parthenon in Athen
Keine Rolle bei der Finanzierung von Bauten spielten in Athen
2.2.4 Eigenmittel der Heiligtümer
Eine Mischfinanzierung, bei der Eigenmittel21 eine Rolle spielten, ist schon für die archaische Zeit aus Delphi
2.2.5 Stiftungen
Stiftungen spielten von Anfang an in den Heiligtümern eine zentrale Rolle bei der Finanzierung. Etwa ab dem 4. Jahrhundert bekamen Stiftungen auch in den Städten immer mehr Gewicht, weil die Poleis wegen des wirtschaftlichen Niedergangs durch die endlosen Kriege selbst für Reparaturen auf die Mittel von Privatleuten angewiesen waren.
Eine sehr früh bereits fest etablierte Form der Stiftung war die Weihung von Kriegsbeute durch Städte oder Einzelherrscher, denn die Vorstellung, ein Sieg sei ohne die Hilfe der Götter denkbar, galt offenbar als Hybris. Gängige Praxis war die Weihung des Zehnten aus der Beute. Üblich waren keine Barspenden, sondern – neben Teilen der Kriegsbeute selbst (wie etwa Waffen) – entsprechend aufwändige Weihgeschenke, die vor allem in den überregionalen Heiligtümern der Selbstdarstellung und Propaganda der Sieger dienten. Viele der bedeutendsten Tempelbauten sind in diesem Sinne als Sieges-Weihgeschenke aufzufassen, wie etwa der Zeustempel in Olympia
Einzelherrscher traten als Euergeten schon früh auf. Nach Plinius
Wohlhabende Privatpersonen als Euergeten von Bauwerken traten vereinzelt bereits früh auf. Schon Themistokles
Die Stiftungen durch Einzelpersonen entwickelten im Laufe der Zeit eigene, relativ feste Formen.38 Der Stifter wurde von der empfangenden Stadt oder dem Heiligtum mit dem Titel Euergetes (‚Wohltäter‘) oder Proxenos mit Niederlassungsrecht (‚Gastfreund‘) geehrt. Die entsprechenden Beschlüsse der Gremien wurden in Form von Inschriften veröffentlicht. Bei bedeutenden Spenden konnte auch eine Ehrenstatue dekretiert werden, oder dem Stifter das Recht zugesprochen werden, eine solche auf eigene Kosten an prominenter Stelle aufzustellen.
2.2.6 Kreditfinanzierungen, Subskriptionen und Umlagen
 Talent) erhielt und vom Pharao Amasis
Talent) erhielt und vom Pharao Amasis
Soweit erkennbar, wurde von einem älteren Finanzierungsinstrument
2.2.7 Unentgeldliche Arbeit
Frondienste der Bevölkerung bei Bauprojekten sind lediglich für die sog. Ältere Tyrannis bekannt. So ließ etwa Aristodemos
Berichte über Kriegsgefangene, die zur Mitarbeit an Bauprojekten herangezogen wurden, gibt es aus Sizilien
Sklavenarbeit spielt hingegen eine erstaunlich geringe Rolle. Inschriftlich bekannt ist die Steinmetzarbeit der Tempelsklaven in Didyma
2.2.8 Projektmanagement
Ein nur periodisch tagendes Gremium mit umfassender Zuständigkeit wie der Rat einer Stadt oder eines Heiligtums konnte naturgemäß nicht selbst ein Bauprojekt leiten, bei dem ständige Präsenz erforderlich war. Demgemäß wurden die Projekte immer delegiert an einen Repräsentanten des Bauherrn, der zwischen diesem und den Ausführenden vermittelte. Zwei Formen dafür lassen sich unterscheiden. Die erste, weil historisch ältere Form ist die Übergabe des Projekts zur Durchführung an eine einzelne Person mit umfassenden Kompetenzen. Die zweite Form ist die Delegation des Projektes an eine Behörde. Was sich hingegen nirgendwo belegen lässt, sind zwei aus anderen Epochen und Kulturen als Standard bekannte Organisationsformen, nämlich die Übergabe der Bauleitung an den entwerfenden Architekten49 oder eine Bauhütte. Es ist zudem kein Architekt nachweisbar, der als Inhaber eines Bauunternehmens ein komplettes Bauprojekt übernommen hätte.50 Charakteristisch ist für das Bauwesen vielmehr, dass die Oberleitung stets – in Gremien mindestens mehrheitlich – bei Personen lag, die Bauen nicht als Beruf betrieben.
Das archaische System der personalen Gesamtverantwortung
Die Projektleitung durch eine einzelne Person (oder Familie) findet man ausschließlich in archaischer Zeit. Die konkreten Nachrichten darüber sind mehr als spärlich und lassen kaum mehr als die Grundform der Organisation erkennen: Ein sonst unbekannter Agathokles
Die hier angenommene Verpflichtung zum Nachschießen privater Mittel dürfte einige Eckpunkte der archaischen Organisationsformen erklären. Erstens wäre dadurch verständlich, warum die Projektleiter stets reiche Adelige waren und keine kommerziellen Unternehmer, denn nur der Adel konnte sich leisten, erforderlichenfalls Eigenmittel zuzuschießen, die einen Unternehmer nicht hatte oder die ihn ruiniert hätten. Das sicherte zugleich die Exklusivität der Aufgabe, also Prestige für den Leiter, und machte die Aufgabe damit für den Adel würdig. Das Prestige-Motiv wiederum erklärt, weshalb die Bauleitung nicht, wie später, jährlich wechselte, denn nur wenn der Bau als Ganzer einer Person zugeschrieben werden konnte, war der Prestigewert entsprechend hoch, und damit attraktiv für Mitglieder führender Kreise. Es würde schließlich erklären, warum aus keinem dieser Projekte Abrechnungsurkunden, wie sie später üblich wurden, bekannt sind, denn wenn die Projekte ohnehin unterfinanziert waren, war eine Finanzkontrolle durch den Bauherrn überflüssig oder sogar kontraproduktiv, weil sie die persönliche Integrität des adeligen Bauleiters in Zweifel gezogen hätte. Die beschriebene Form der Bauleitung entspräche damit allgemein den Strukturen einer Adelsgesellschaft, die bürokratische Strukturen kaum kannte, und in der personale Beziehungen und Wertesysteme dominierten. Der Normalfall dürfte gewesen sein, dass der vom Adel gebildete Rat einfach eines seiner Mitglieder mit der Gesamtverantwortung beauftragte.
Die überlieferten Nachrichten zeigen jedoch auch die problematische Seite dieser Verfahrensweise. Der erwähnte Agathokles
Die Baubehörden der klassischen und hellenistischen Zeit
Bekannt sind jedoch vor allem die ständigen Behörden, die ausschließlich mit der Leitung von Bauprojekten betraut waren. Hierher rechnen vor allem die Teichopoioi, eine in verschiedenen Städten nachweisbare, ständige Kommission für die Stadtmauern.63 Ähnliche Behörden sind die für die Straßen in Athen
2.2.9 Baukommissionen
„[(Die Phyle) Leontis hatte die Prytanie inne. Beschlossen haben der Rat und da]s [Vol]k, [… war Epistates, Gl]aukosstellte den Antrag: [Für die Athena Ni]ke soll man eine Priesterin, welche d[urch das Los] aus sämtlich[en] Athenerinnen [bestimmt wird, einsetz]en und das Heiligtum mit einer Tür ausstatten in der Weise, wie Kallikrates in seinem Entwurf es festlegt; den Auftrag vergeben sollen die Poletai in der Prytanie der (Phyle) Leontis. […] Einen Tempel soll man bauen in der Weise, wie Kallikrates in seinem Entwurf festlegt, sowie einen Altar aus Marmor. vacat. Hestiaios stellte den Antrag: Drei Männer soll man wählen aus dem Rat; diese sollen, wenn sie gemeinsam mit Kallikrat[es] den Entwurf ausgearbeitet haben, in[formieren den Ra]t, in welcher Weise die Auftr[agsvergabe erfolgen soll…].“
Die stark ergänzten Reste der ersten Zeilen sind das sog. Formular, die den Text als Volksbeschluss (psephisma) ausweisen. Ergänzbar ist es vor allem deshalb, weil es sich um weitgehend standardisierte Formulierungen handelt. Die Angabe der Prytanie datiert den Monat, da die Prytanen nur 35 Tage amtierten. Die Jahresdatierung durch Angabe des Namens des jährlich bestimmten Oberbeamten (archon eponymos) fehlt. Die Inschrift wird wegen der Buchstabenformen (dreigestrichenes Sigma) auf ca. 450 datiert. Der Beschluss durch das Volk und den Rat bedeutet, dass verfassungsgemäß der Beschluss der Volksversammlung vom Rat vorberaten worden war. Dessen probuleuma im ersten Abschnitt der Inschrift wird ergänzt von dem angenommenen Zusatzantrag des Hestiaios.
Inhaltlich sah der Beschluss vor: die Zuweisung einer eigenen Priesterin an das bereits bestehende Heiligtum der Athena Nike (südlich vom Eingang zur Akropolis), den Verschluss des offenbar bereits ummauerten Heiligtums (temenos) durch eine Tür, und den Bau von Altar und Tempel. Der entwerfende Architekt Kallikrates
Erst durch den Zusatzantrag wurde eine spezielle Kommission aus drei Ratsmitgliedern eingesetzt. Ihre Aufgabe war die Vorbereitung der Auftragsvergabe, d. h. ein Leistungsverzeichnis zu erstellen, das als Basis für die Ausschreibung und Vergabe der Werkverträge an verschiedene Unternehmer dienen konnte. Ein Generalunternehmer war offensichtlich nicht vorgesehen, denn sonst wäre keine vorbereitende Kommission erforderlich gewesen, sondern die Volkversammlung hätte direkt den Generalunternehmervertrag ausschreiben und vergeben können. Solche Generalunternehmer sind aus Athen
Um nun das Leistungsverzeichnis zu erstellen, war ein Bauentwurf erforderlich, aus dem das Leistungsverzeichnis abgeleitet werden konnte. Hier liegt der Grund, warum der Architekt Kallikrates
Es sind hier folglich zwei alternative Organisationsmodelle benannt, wobei das Probuleuma für das ältere Modell der Arbeitsteilung zwischen Architekt und ständiger Ausschreibungsbehörde steht, der Zusatzantrag hingegen für die Kooperation von Architekt und Ratsmitgliedern in einer Kommission speziell für dieses Projekt.
Aus der zeitgleichen Arbeit der Parthenon-Kommission (aktiv ab 449) ist bekannt, dass die Kommissionen die Vertragstexte nicht nur formulierte, sondern – nach Bestätigung durch die Volksversammlung, wie im Nike-Dekret vorgesehen – auch die Prüfung und Abrechnung der Vertragsleistungen vornahm. Das wiederum bedeutete, dass die Kommission während der gesamten Projektdauer aktiv war, und die Gelder für den Bau verwaltete, wie für die Parthenon-Kommission ebenfalls belegt ist.
Für die These, dass diese Übertragung der Bauverwaltungsaufgaben von der allgemeinen und ständigen Behörde hin zu speziellen Baukommissionen in dieser Zeit erfolgte, spricht auch eine Inschrift aus dem Heiligtum von Eleusis
Baukommissionen trugen unterschiedliche Amtsbezeichnungen.70 Teils wurden sie einfach allgemein als Epistatai (‚Aufseher‘)71 oder Epimeleten (‚Verwalter‘)72 des jeweiligen Projekts bezeichnet, teils bezieht sich die Bezeichnung auf die Funktion (in Delphi
Die Wahl der Kommissionsmitglieder erfolgte in Athen
Die Amtsperiode blieb in den Beschlüssen meist ungenannt, weil sie den allgemeinen Regeln für die Ausübung von Ämtern entsprach. Ämter wurden als Jahresämter vergeben.84 Vereinzelt war die Amtszeit auch kürzer, wie etwa die des Sekretärs einer Kommissionen in Epidauros mit nur sechs Monaten.85 Die Amtsperiode war also stets wesentlich kürzer als die Bauzeit selbst mittelgroßer Projekte. Da Verlängerung bzw. Wiederwahl nur in Ausnahmefällen vorkam,86 bestand für kein Mitglied die Möglichkeit, wie in archaischer Zeit ein Bauprojekt vollständig zu leiten oder zu kontrollieren. Honorierung ist in einigen Fällen bekannt. Sie liegt jeweils auf dem Niveau der Handwerkerlöhne, eher sogar darunter. Die Epistaten einer Kommission in Eleusis
Die interne Struktur der Kommissionen kennt nur zwei besondere Positionen: den Architekten und Grammateus (‚Schreiber/Sekretär‘). Die Tatsache, dass nie ein Vorsitzender einer Kommission ausgewiesen wird, und zudem, dass die bekannten Kommissionen stets eine ungerade Zahl von Mitgliedern hatten, deutet daraufhin, dass bei unterschiedlichen Meinungen in den Kommissionen abgestimmt wurde, also niemand eine Leitungskompetenz hatte.
Der Kern der Aufgabenstellung war die sachgemäße Verwendung der bereitgestellten Gelder. Das zeigen bereits die älteren Rechenschaftsberichte. Sie nennen die Summe der übernommenen oder neu vereinnahmten Geldmittel, führen die Ausgaben auf (Leistung, Leistungsnehmer, Betrag), sowie die am Ende der Amtsperiode verbliebenen Mittel. Im einzelnen erwähnt wurden der Ankauf von Baumaterialien, die Abrechnung von Werkaufträgen oder die Bezahlung der Handwerker im Tageslohn, sowie die Schlichtung diesbezüglicher Streitfälle. Für letztere konnten gegebenenfalls auch Gerichte herangezogen werden. Mit diesen in den Inschriften greifbaren, eher verwaltungstechnischen Aufgaben und Kompetenzen dürfte die Bedeutung der Kommissionen jedoch noch nicht in jedem Falle angemessen bestimmt sein. Wäre die Arbeit etwa der Parthenon-Kommission auf die bloße Kassenverwaltung beschränkt gewesen, hätte sich wohl kaum jemand wie Perikles – der seinerzeit führende Politiker Athens
Über ihre Tätigkeit hatten die Kommissionen Rechenschaftsberichte abzufassen, die als Inschriften veröffentlicht wurden, also auf Stein und ohne Möglichkeit zur nachträglichen Korrektur bzw. Manipulation. Die Berichtsperioden waren teilweise auch kürzer als die Amtsperioden, wie aus Epidauros
Der offensichtliche Zweck der berichtspflichtigen Kommissionen, die Verhinderung von Unterschlagungen, scheint nicht in jedem Falle durch die neuen Organisationsformen erreicht worden zu sein. Immerhin ein prominenter solcher Fall ist literarisch überliefert für eine Kommission, die man auch aus originalen Inschriften kennt. Für die Schaffung der Gold-Elfenbein-Statue der Athena im Parthenon durch Phidias
2.2.10 Die Syngraphé als Arbeitsgrundlage der Baukommissionen
In dem oben erwähnten Nikedekret war vorgesehen, dass der Tempel nach dem Plan des Architekten Kallikrates
Die Inschrift enthält eine Art Bauplan in Form eines Textes, der bis heute Grundlage für verschiedene Rekonstruktionsvorschläge für die Skeuothek gewesen ist. Jenseits der damit verbundenen Probleme stellt sich im hier diskutierten Kontext vor allem die Frage, warum dieser Text in die Volksversammlung eingebracht und dort auch beschlossen worden ist. Heute würde selbst bei Großprojekten kein Parlament über Blaupausen diskutieren. Die naheliegende Vorstellung, in der direkten Demokratie des athenischen Staates hätte sich die Volksversammlung bis ins Detail mit ihren Bauprojekten befasst, ist bei genauerer Betrachtung kaum tragfähig. Wenn die Volksversammlung sich wirklich mit dem Entwurf als solchem hätte auseinandersetzen wollen, hätte zumindest die Grundrissdisposition in dem Antrag vollständig angegeben sein müssen. Das ist aber nicht der Fall, denn trotz des beachtlichen Umfangs des Textes fehlen dort entwurfsbestimmende Angaben, wie etwa das Joch der beiden inneren Stützenstellungen95.
Umgekehrt sind dort aber wiederum Angaben enthalten, die soweit ins Detail gehen, dass man sich nicht vorstellen kann, dass darüber eine Aussprache in diesem Rahmen hätte stattfinden sollen, wie beispielsweise die Abmessungen der Platten der obersten Schicht des Fundaments, oder die Anzahl der Fundamentplatten unter den Stützen. Beurteilen konnten solche konstruktiven Einzelheiten ohnehin allenfalls Baufachleute, sicherlich jedoch nicht die Mitglieder der Volksversammlung. Nach meinem Verständnis findet sich der Schlüssel für die Antwort auf die Frage, warum solche Projektbeschreibungen trotzdem der Versammlung vorgelegt wurden, in dem schon zitierten Baubeschluss für den Niketempel, bzw. genauer gesagt dem Zusatzantrag des Hestiaios
Aus der Inschrift lassen sich darüber hinaus wichtige Schlussfolgerungen für das Bauwesen dieser Zeit in Athen
2.3 Planung und Bauentwurf
Die hohe Bewertung der planerischen Leistung ist allerdings für den heutigen Betrachter der antiken Ruinen keineswegs evident, und zwar paradoxerweise um so weniger, je mehr dieser Bauten er besucht: Wer etwa die Ruinen der acht dorischen Ringhallentempel von Agrigent
Die Auflösung dieses vermeintlichen Widerspruchs besteht vor allem darin zu erkennen, dass die Architekturordnungen den Architekten Baumuster und Typenarsenale keineswegs so klar definiert vorgaben, dass deren Umsetzung eine Frage allein der Handwerkstechnik war. Zwar gewährleistete der Kanon auf der einen Seite im Bereich Gestaltung der Bauglieder Formen, deren ästhetische Qualität bis heute unbestritten ist. Auf der anderen Seite schuf er aber zugleich Probleme, da die Ordnungen in bestimmtem Sinne nicht widerspruchsfrei waren. Griechische Architekten hatten sich mit spezifischen Systemzwängen auseinanderzusetzen, die sie als Kollektiv selbst geschaffen hatten. Folglich hatten sie sich mit Problemen zu beschäftigen, die es in den Architekturen anderer Epochen schlicht nicht gab. Es ist eines der Hauptanliegen dieses Beitrags, diese spezifischen Probleme der griechischen Architektur zu verdeutlichen. Oder etwas schlichter und allgemeiner gesagt: Es soll etwas von dem deutlich werden, worüber die Architekten überhaupt nachgedacht haben, obwohl sie scheinbar doch ‚immer dasselbe‘ gebaut haben.
Die wichtigste Quelle für die Analyse antiker Entwurfsverfahren sind die Bauten selbst. Schriftquellen dazu gab es zwar in der griechischen Antike nicht wenige, denn Architekten haben sowohl ihre Werke kommentiert sowie systematische Fragen in Texten behandelt. Allerdings sind alle diese Schriften verloren. Von ihrer Existenz wissen wir nur durch die Bücher des römischen Architekten Vitruv
Eine weiteres Methodenproblem der Rekonstruktion des Entwurfsvorgangs aus den Bauten selbst hängt mit den antiken Maßsystemen zusammen. Schon H. Riemann hatte die Forderung aufgestellt, dass ein vollständig rekonstruierter antiker Bauentwurf auch in antiken Maßeinheiten darstellbar sein müsse. Das Grundproblem dabei ist, dass die Griechen – die anders als die Römer nie zu einer staatlichen Einheit gefunden haben – unterschiedliche Maßeinheiten verwendeten, wie schon durch Herodot Fuß) mit 52,1–3 cm. Direkte Quellen zu den verwendeten Maßen gibt es nur wenige.
Fuß) mit 52,1–3 cm. Direkte Quellen zu den verwendeten Maßen gibt es nur wenige.
Haufig tritt nun aber der Fall auf, dass zwei metrisch gemessene Maße zwar in klarer Proportion zueinander stehen, jedoch nicht in antiken Maßeinheiten formulierbar sind: Die 16 Daktyloi eines Fußes lassen beispielsweise ein Teilung in fünf gleiche Teile nicht ohne Rest bzw. Brüche mit großen Nennern zu. Die Frage nach der verwendeten Maßeinheit hat zu einer Vielzahl von Publikationen und Vorschlägen geführt, die ausgesprochen wenig konsensfähige Ergebnisse gebracht haben. Es mag hier genügen darauf hinzuweisen, dass beispielsweise für den jüngeren Aphaiatempel auf Ägina
2.3.1 Die Architekturordnungen und ihre Verwendung
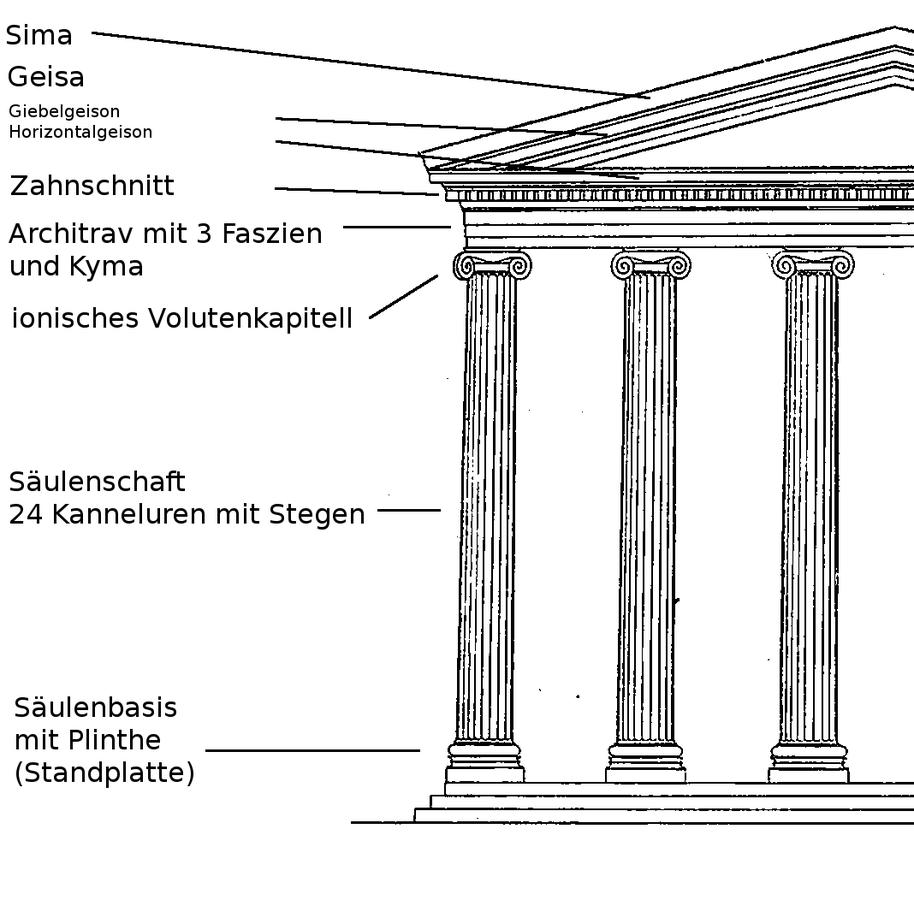
Abb. 2.1: Ionische Ordnung (Wiegand and Schrader 1904, Abb. 67, modifiziert).
Eine ionische Ordnung ist auf Abb. 2.1 dargestellt. Den Fuß der Säule bildete die auf eine quadratischen Standplatte (Plinthe) gestellte Rundbasis, deren kanonische attische Form aus der Folge von Wulst – Kehle – Wulst gebildet wurde. In archaischer Zeit wurden in den ostgriechischen Siedlungsgebieten alternativ auch Basen samischen und ephesischen Typs verwendet, wobei letztere in der Spätklassik wieder aufgegriffen wurde.109
Der Schaft der Säule hatte bei kanonischer Ausbildung 24 Kanneluren, die durch Stege von einander abgegrenzt wurden. Die beiden verbundenen Voluten des Kapitells ruhten auf einem ionischen Kyma (‚Eierstab‘). Den oberen Abschluss des Kapitells bildete eine dünne Platte. Der Architrav, der die Säulen verband, war an der Front durch drei nach oben vorkragende Faszien (Leisten) gegliedert und wurde von einem schmalen Kyma bekrönt. Über dem Architrav folgte entweder direkt ein Zahnschnitt (wie auf der Abbildung), oder aber es wurde dazwischen ein Fries eingeschoben. Letzterer konnte reliefiert sein oder glatt belassen bleiben (‚Blankfries‘). Darüber folgte das Geison, d. h. ein Traufgesims. Die Sima, die den Dachrand bildete, gehörte nicht mehr zu den spezifischen Baugliedern der Ordnung.
Alle Elemente der dorischen Ordnung (Abb. 2.2) unterschieden sich von denen der ionischen Ordnung. Eine Basis gab es in der dorischen Ordnung nicht, der Säulenschaft ruhte unmittelbar auf dem Stylobat. Die kanonischen zwanzig Kanneluren liefen in spitzen Graten direkt gegeneinander, also ohne trennenden Steg wie im Ionischen, und waren zudem deutlich weniger tief als dort. Dorische Säulenschäfte waren darüber hinaus stets weniger schlank als ionische Schäfte. Das dorische Kapitell bestand aus dem Hypothrachelion, d. h. dem oberen Auslauf der Kanneluren, der von Anuli (kleine Leisten) abgeschlossen wurde, darüber dem Echinus, ursprünglich einem Wulst, der in klassischer Zeit tendenziell auf einen Kegelstumpf reduziert wurde, und dem abschließenden Abakus, einer quadratischen Platte ohne Ornament. Die Formen des Gebälks wurden bestimmt durch den Triglyphenfries. Er bestand aus einer alternierenden Reihe von Triglyphen und Metopen, wobei bis in das 4. Jahrhundert jeweils zwei Triglyphen und zwei Metopen einem Joch entsprachen, später auch drei oder – vor allem bei Kleinarchitekturen – noch mehr. Die Form der Triglyphen war bestimmt durch die drei vertikalen Glyphen (Kerben), im Zentrum zwei und an den Ecken jeweils ein Halbglyph. Die Glyphen waren im Schnitt meist leicht stumpfwinklig, später auch rechtwinklig. Bekrönt wurden die Triglyphen, ebenso wie die Metopen, von einer einfachen Faszie (Leiste). Die Metopen waren meist einfache Platten, konnten aber auch mit Reliefs versehen werden. Der Architrav hatte ebenfalls eine durchgehende obere Leiste, und dazu, nur im Bereich der Triglyphen, eine Regula, d. h. eine weitere, etwas niedrigere Leiste, an der sechs Guttae (konische Tropfen) angearbeitet waren. Das Geison, d. h. das umlaufende Gesims, war durch Mutuli (Nagelplatten) gegliedert, die ebenfalls den Rhythmus des Frieses wiederholten. Die Mutuli waren üblicherweise mit drei Reihen zu je sechs Guttae verziert. Die vertieften Teile des Gesims zwischen den Mutuli werden als Viae bezeichnet. Der Wechsel von Mutuli und Viae erfolgte so, dass jedem Triglyphen ein Mutulus entsprach, jeder Metope ein Mutulus und zwei Viae. Im Gegensatz zum Horizontalgeison war die Unterseite der Giebelgeisa nicht ornamentiert, sondern als einfache Traufnase ausgebildet. Die Stirn der Geisa war in der Regel mit einem schmalen Kyma bekrönt. Die Sima über dem Gesims war – wie im Ionischen – kein Teil der Ordnung.
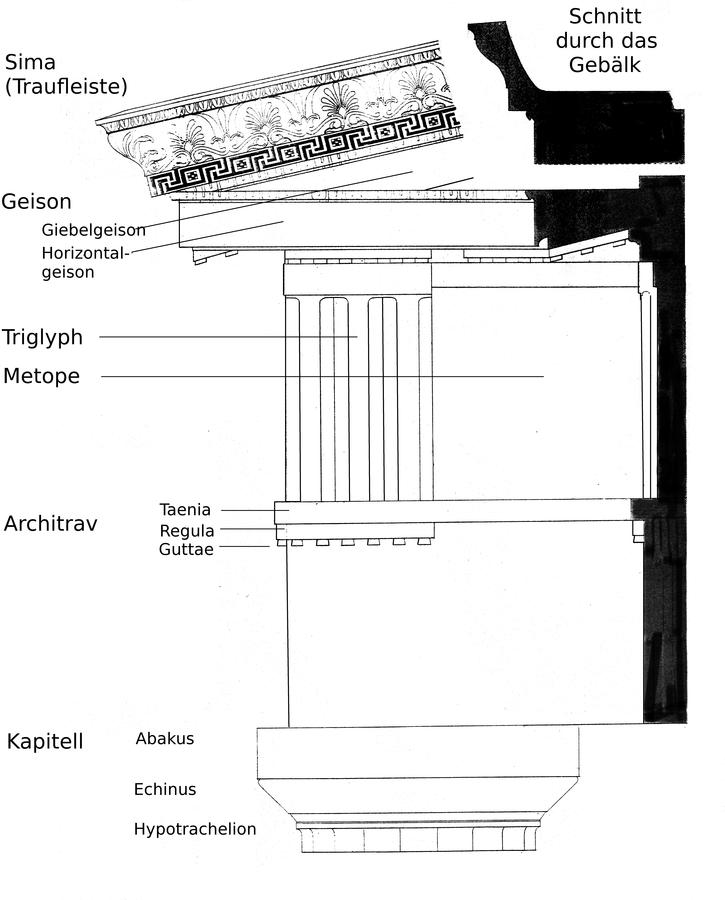
Abb. 2.2: Dorische Ordnung (Adler and Curtius 1892, Tf. 26, modifiziert).
Zu den Ordnungen gehörten neben den beschriebenen Formen der Bauglieder von Stützenstellungen auch bestimmte Formen der Ausbildung von freistehenden Mauerzungen. Sie wurden jeweils seitlich durch vorspringende Leisten verstärkt, im Ionischen mit gleicher Tiefe, im Dorischen asymmetrisch, wobei die schmalere Leiste der Außenseite der Mauerzunge zugeordnet war. Durch diese verstärkenden Leisten lief die Mauer in eine Art von Pfeiler aus, der als Ante bezeichnet wird. Bekrönt wurde die Ante in beiden Ordnungen wie eine Säule von einem je eigenen Kapitelltypus, der der rechteckigen Form des Antenpfeilers entsprach. Im Sockelbereich von Wänden und als oberer Wandabschluss wurden oft profilierte Leisten verwendet, sog. Kymatien, wobei ionische und dorische allerdings relativ frei eingesetzt wurden, häufig kombiniert mit dem sog. lesbischen Kyma (einer Art Blattwelle). 110
Der strukturelle Unterschied zwischen den beiden Ordnungen im Bereich der Stützenstellungen besteht darin, dass im Dorischen die Gebälkformen durch ihre horizontale Gliederung einen Rhythmus haben, der auf die Säulenstellung Bezug nimmt. Daraus ergaben sich für den Bauentwurf spezifische Anforderungen und Probleme, die in der ionischen Ordnung mit ihrer ungegliederten, bandförmigen Ornamentik nicht auftraten (s. u.). Als System betrachtet, hat die dorische Ordnung daher eine höhere Komplexität, und war für entwerfenden Architekten entsprechend die anspruchsvollere Aufgabe. Umgekehrt war die Ausbildung der Formen der Bauteile im Ionischen differenzierter, und forderte entsprechend mehr Können auf Seiten der Steinmetzen und mehr Arbeitsaufwand.
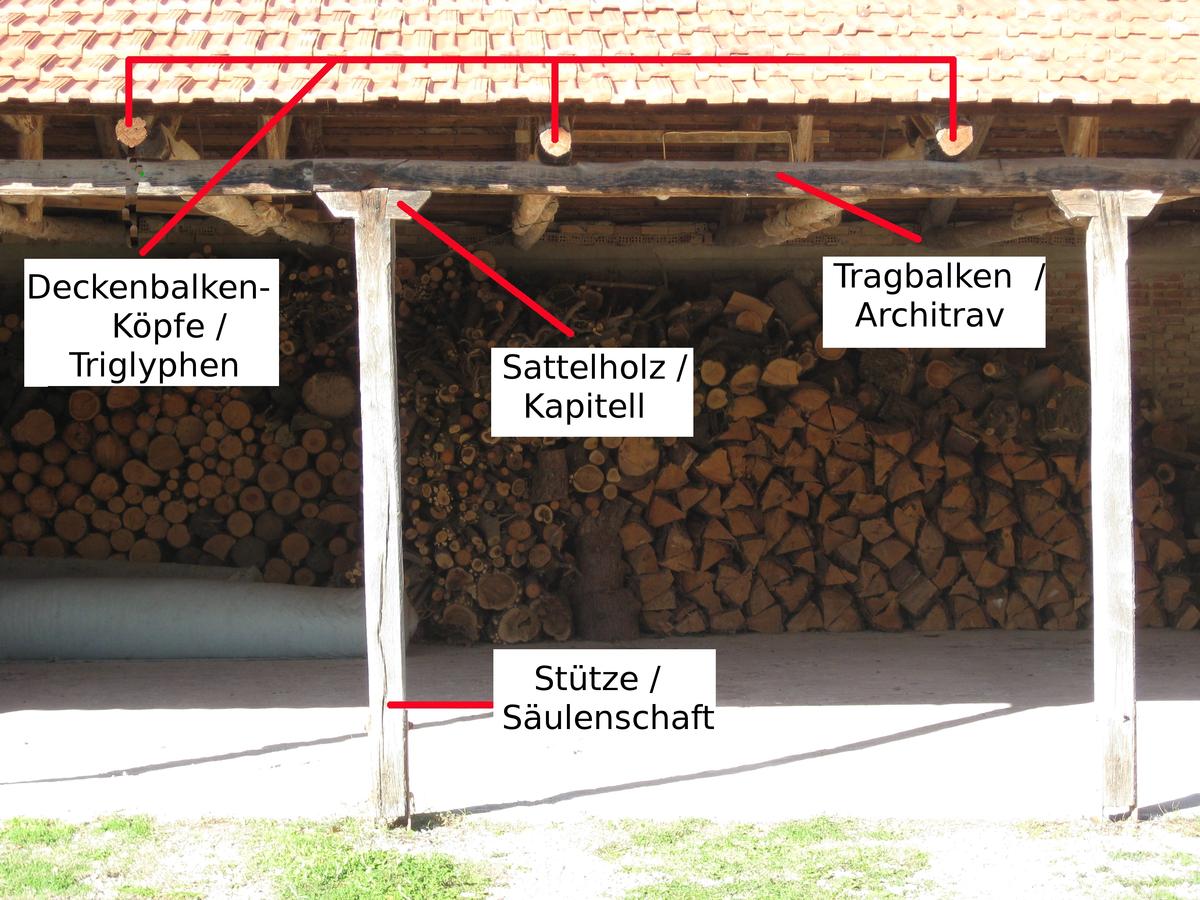
Abb. 2.3: Moderne Stützenstellung aus Holz mit Angabe der entsprechenden Termini der antiken griechischen Architekturordnungen (W. Osthues).
Die Ausbildung der elementaren Formen beider Ordnungen lässt sich historisch nicht mehr nachvollziehen, denn sie sind auch an den ältesten der erhaltenen Resten von Steinbauten bereits gültig ausgebildet. Sicher ist nur, dass es sich nicht um Übernahmen aus älteren Kulturen des östlichen Mittelmeers
Was sich hingegen auf Basis einer Vielzahl empirischer Befunde beobachten lässt, ist die weitere Entwicklung der Ordnungen. Dazu zählt in erster Linie die schon angesprochene Beschränkung der Freiräume bei der Ausgestaltung der Formen in klassischer Zeit. Das ist allerdings nicht mit einer Standardisierung gleichzusetzen, denn trotz der strikten Ähnlichkeit der Bauteile ist es in Griechenland
In hellenistischer Zeit verloren die Ordnungen, in allerdings begrenztem Umfang, an Verbindlichkeit. Die Vermischung der Elemente beider Ordnungen innerhalb von Säulenstellungen tritt allerdings nie an Ringhallentempeln auf, die vielleicht durch ihre sakrale Bedeutung stärker als andere Gebäudetypen den kanonischen Ordnungen verpflichtet waren. Vereinfachungen von Formen sind jedoch auch dort zu beobachten.119 Die wichtigste fassbare Entwicklung innerhalb der Ordnungen betraf jedoch nicht die Grundform der Bauglieder, sondern ihre Proportionen. Die Formen der ältesten Säulenstellungen waren stets massiv, um nicht zu sagen, wuchtig ausgebildet,120 was vielleicht mit der mangelnden Erfahrung hinsichtlich der Belastbarkeit des Steinmaterials zu Beginn des Monumentalbaus zusammenhängt. Umgekehrt findet man am Ende der Entwicklung, im Hellenismus, schlanke Säulen und leichte Gebälke, mit denen man sicherlich die tatsächliche Belastungsgrenze von Stütze-Gebälk-Systemen in Stein erreicht hatte. Beide geschilderten grundlegenden Tendenzen, die lange Zeit zunehmende Verbindlichkeit der Ordnungen und die immer gestreckteren Proportionen, gelten jedoch nicht absolut, so dass Datierungen nicht immer darauf gegründet werden können. Das illustriert das Beispiel des kleinen Tempels von Kardaki
Dass zwei so restringierende Architekturordnungen ihre dominierende Stellung fast ein halbes Jahrtausend lang behaupten konnten, erklärt sich paradoxerweise durch ihre Flexibilität: Ihre technische Struktur als Stütze-Gebälk-Systeme war für fast alle Bauaufgaben und Gebäudetypen der Griechen verwendbar. Da die Formen der Bauglieder, obwohl ursprünglich dem Bereich der Sakralarchitektur zugeordnet, keinen direkten Bezug zum Kultus hatten, konnte man gleichsam mit Selbstverständlichkeit auf sie zurückgreifen, als man begann, auch öffentliche Bauten monumental auszugestalten. Die Profanisierung der ‚Würdeformen‘ (W. Hoepfner) gestattete es den hellenistischen Monarchen und Einzelherrschern, sie an ihren Palästen (die es zuvor nicht gab) zu verwenden, und dadurch angeregt fanden die Ordnungen schließlich Eingang in die Sphäre der luxuriösen privaten Peristylhäuser. Selbst in die ‚Unterwelt‘ drangen die Ordnungen ein, denn ebenfalls aus hellenistischer Zeit finden sich vor allem in Makedonien
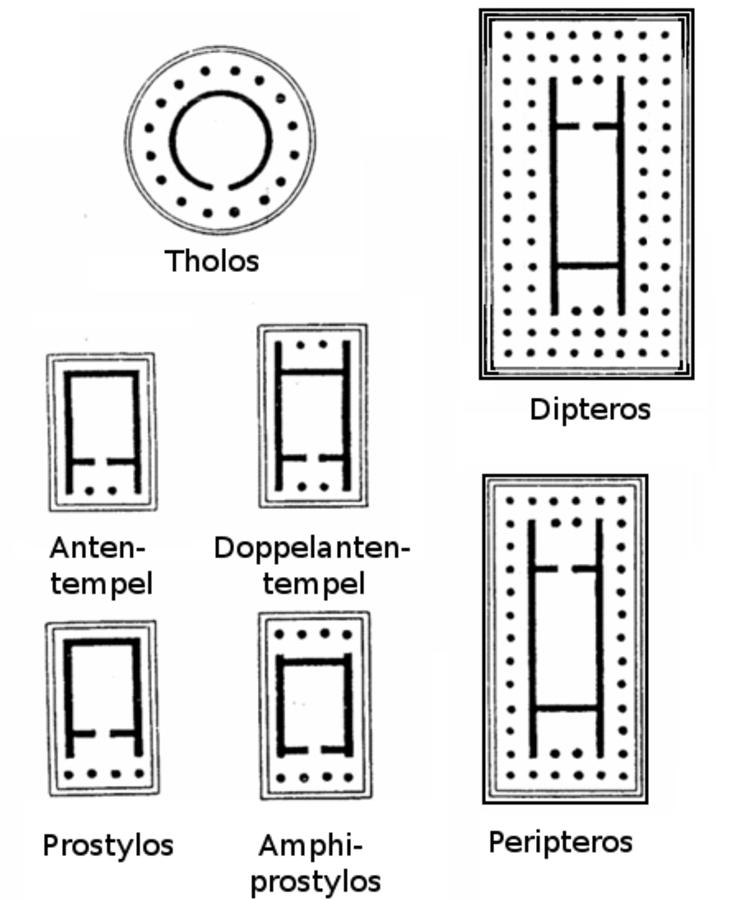
Abb. 2.4: Grundrissformen griechischer Tempeltypen (W. Osthues).
Das technische Potential der Ordnungen als Stütze-Gebälk-Systeme wird daran deutlich, dass alle in der Epoche neuen Gebäudetypen ohne fundamentale technische Neuerungen auskommen konnten. Die Ordnungen bildeten geradezu eine Art von Baukasten, in dem alles zu finden war, was man brauchte. Wenn man etwa die Propyläen, die große Toranlage am Eingang zur Athener Akropolis genau betrachtet, wird man dort praktisch kein einziges Bauteil finden, dass nicht auch – mit anderer Dimensionierung – am Parthenon vorkommt. Im selben Sinne ließe sich aus den Baugliedern eines Ringhallentempels eine Risalit-Stoa, eine Säulenhalle mit monumentalem Eingang, zusammensetzen. Eine Tholos, d. h. ein Rundtempel, unterscheidet sich im Querschnitt in keiner Weise von einem Peripteros.123 Teilweise sind die Gebäudetypen direkte Kombinationen von Grundrissen unterschiedlicher Gebäudetypen. Ein Peripteros, seiner Ringhalle entkleidet, ergibt einen Anten- oder Doppelantentempel (Abb. 2.4). Eine Ringhalle, nach innen gewendet, ergibt ein Peristyl (einen Säulenhof), wie man ihn in kleinerer Form von den Säulenhöfen luxuriöser Privathäuser kennt und in größeren Dimensionen von den Agorai, den öffentlichen Platzanlagen im Zentrum von Städten. Was hier nur zur hypothetischen Veranschaulichung der universellen Verwendbarkeit der Bauglieder der Architekturordnungen angeführt worden ist, war in der Antike übrigens durchaus eine reale Option, denn bedingt durch den Verzicht auf Bindemittel wie Mörtel im griechischen Werksteinbau124 konnten Bauten abgetragen und an anderer Stelle neu errichtet werden.125 Häufig wurden Hallenbauten abgetragen und deren Bauglieder an anderen Gebäuden weiterverwendet.126 Auch die Römer haben nach der vollständigen Eroberung Griechenlands wiederholt Säulenstellungen abgetragen und in ihrer Hauptstadt an öffentlichen Plätzen oder in Privathäusern wiederverwendet.127
Die Beschränkung der griechischen Bautechnik auf Stütze-Gebälk-Systeme hat die Entwicklungsmöglichkeiten der griechischen Architektur allerdings gleichwohl auch beschränkt. Das gilt vor allem für die maximale lichte Breite von Räumen, die ohne Innenstützen kaum zwölf Meter überschritten hat. Man braucht in diesem Zusammenhang nur darauf zu verweisen, welche enormen neuen Möglichkeiten des Bauens den Römern der Einsatz von gemauerten oder gegossenen Gewölben erschlossen hat.128 Interessanterweise ist die Grenze, die die Verwendung von Stütze-Gebälk-Systemen den griechischen Architekten gesetzt hat, keineswegs absolut in dem Sinne, dass Wölbtechniken den Griechen nicht bekannt gewesen wären. Keilsteintechnik für Bogen und Gewölbe sind nachweislich spätestens ab der Mitte des 4. Jahrhunderts in Griechenland
2.3.2 Die Probleme des Grundrissentwurfs der Ringhallentempel
Die beiden Architekturordnungen bestanden im Kern aus zwei Komponenten: dem seit dem Neolithikum bekannten Konstruktionsprinzip von Stütze und Gebälk, und einem genuin griechischen Arsenal von Formen, die das Aussehen von Stütze und Gebälk bestimmten. Wie kompliziert, und teilweise fast verworren die Diskussion um die griechischen Entwurfsverfahren im Einzelnen auch immer sein mag, so hat sie doch eines zweifelsfrei gezeigt: Die griechischen Architekten haben aus diesen Architekturordnungen Systeme entwickelt, innerhalb derer die Dimensionierungen nahezu aller Bauglieder in Abhängigkeitsbeziehungen zu einander stehen. Die Entwurfsdiskussion versucht im Kern nichts anderes, als diese Abhängigkeitsbeziehungen an den Ergebnissen der Bauaufnahmen, also der modernen Vermessung der Bauten, nachzuvollziehen. Ein Entwurf oder eine bestimmte Methode des Entwerfens gilt dann als gesichert, wenn angegeben werden kann, wie der Architekt das System interpretiert hat, d. h. ausgehend von welchen primären Größen er die weiteren Größen durch welche Formen der Ableitung bestimmt hat, und wie er dabei mit bestimmten, innerhalb der Ordnungen gegebenen Systemzwängen umgegangen ist.
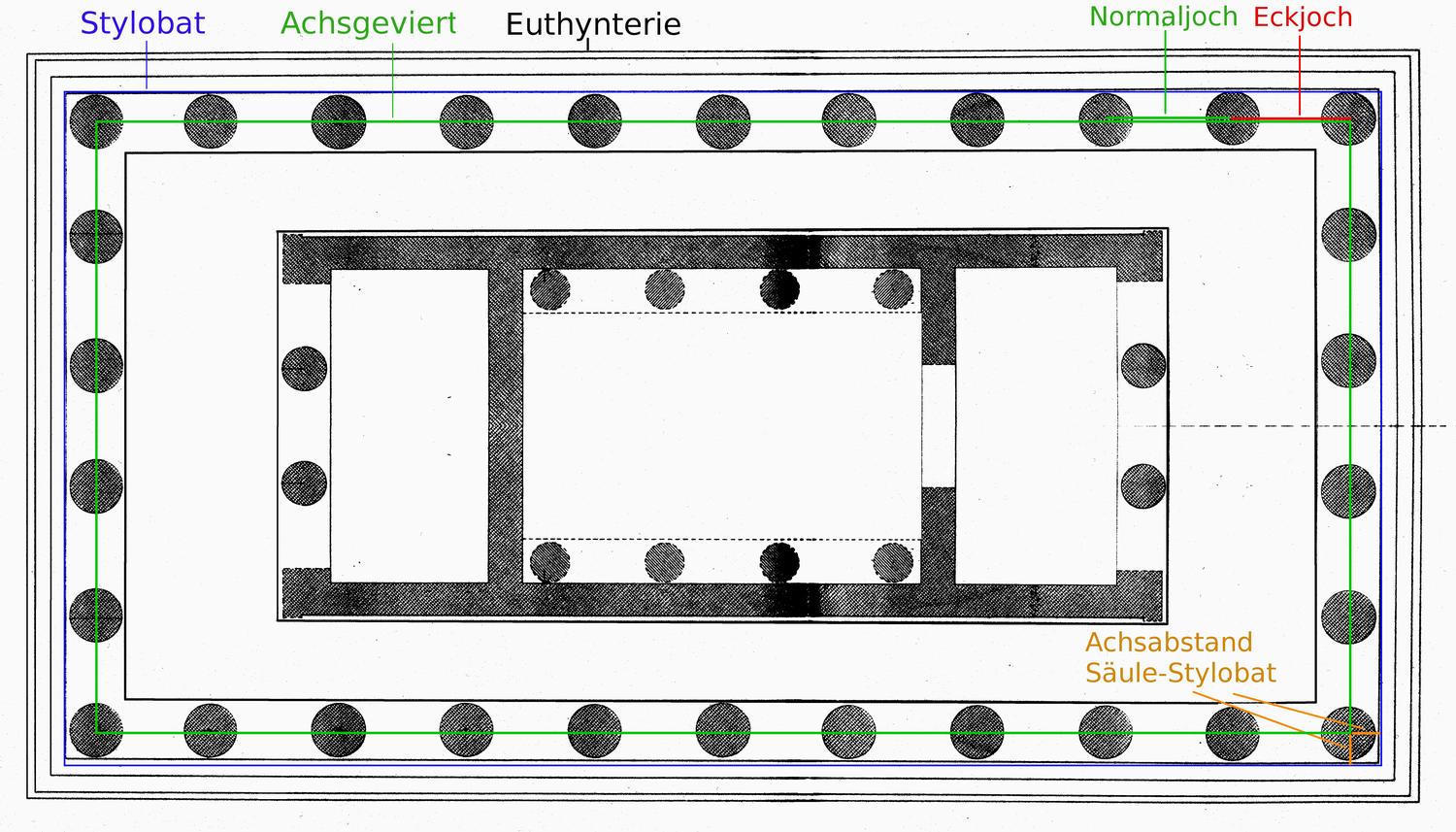
Abb. 2.5: Grundriss eines dorischen Peripteraltempels (Adler and Curtius 1892, Tf. 24, ergänzt und modifiziert).
Die Diskussion um den griechischen Bauentwurf konzentriert sich sehr weitgehend auf den Typus des Ringhallentempels, und dort wiederum vor allem auf den dorischen Peripteros.130 Das hängt damit zusammen, dass kein anderer Gebäudetypus in allen Epochen gleichermaßen und in hinreichend großer Zahl gebaut worden ist, was Voraussetzung dafür ist, die Entwicklung der Entwurfsverfahren vergleichend analysieren zu können.
Die Grundrisse fast aller Peripteraltempel kann man als eine Kombination von Rechtecken beschreiben, die ineinander verschachtelt sind. Für die Ringhalle sind das die folgenden (Abb. 2.5): die Euthynterie als Oberkante des Fundaments, die Unterstufe und die mittlere Stufe,131 der Stylobat bzw. die Oberstufe, auf der die Säulen stehen, und das Achsgeviert als (gedachte) Verbindung der Mittelpunkte der Ecksäulen. Die genannten Rechtecke haben bei vielen archaischen und bei fast allen klassischen und späteren Peripteroi umlaufend absolut gleiche Abstände. So sind an Fronten und Flanken die Auftritte der Stufen gleich tief, die Säulen stehen jeweils gleich weit entfernt von der Stylobatkante usw. (siehe Abb. 2.5, dort angegeben für den Abstand Ecksäule-Stylobatkante).132 Diese identischen Abstände bedeuten nun aber, dass trotz des identischen Mittelpunkts die Proportionen der Rechtecke nicht exakt gleich sein können. Die Proportionen aller Rechtecke wären nur dann dieselben, wenn Länge und Breite jeweils um einen anteilig oder proportional gleichen, nicht aber um einen absolut gleichen Betrag vergrößert oder verkleinert worden wären. Die äußeren Rechtecke sind daher stets etwas gedrungener proportioniert als die inneren. Dieser Sachverhalt hatte erhebliche Konsequenzen für den Entwurf einer Ringhalle mit umlaufend einheitlicher Säulenstellung.
Es ist heute weitgehend unumstritten, dass der Ausgangspunkt der Entwürfe früher Ringhallentempel die Festlegung der Maße für Länge und Breite des Stufenbaus war, und zwar so, dass Länge und Breite in einem ganzzahligen proportionalen Verhältnis zu einander standen. Diese Vorgehensweise lag gewissermaßen in der Natur der Sache selbst. Der Architekt musste bei Baubeginn als erste konkrete Entwurfsentscheidung Länge und Breite des Stufenbaus angeben, damit die entsprechend bemessenen Fundamente gelegt werden konnten. Länge und Breite des Stufenbaus dabei in ein proportionales Verhältnis zu bringen, ergab sich aus dem Gebäudetypus. Jede umlaufende Säulenstellung hat eo ipso ein ganzzahliges proportionales Verhältnis von Fronten zu Flanken durch die jeweilige Anzahl der Säulen: Bei x Säulen an der Front und y Säulen an den Flanken folglich
 . Damit die vorgesehene Zahl von Säulen an Fronten und Flanken später auf dem Stufenbau Platz finden konnten, lag es daher nahe, den Stufenbau entsprechend wie
. Damit die vorgesehene Zahl von Säulen an Fronten und Flanken später auf dem Stufenbau Platz finden konnten, lag es daher nahe, den Stufenbau entsprechend wie
 zu proportionieren. Also etwa: Stylobatlänge zu -breite wie
zu proportionieren. Also etwa: Stylobatlänge zu -breite wie
 für einen Peripteros mit
für einen Peripteros mit
 Säulen (
Säulen (
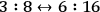 ). Dass das Stylobatrechteck zum Ausgangspunkt des Entwurfs gemacht wurde und keines der anderen, oben genannten Rechtecke, lag einfach daran, dass frühe Peripteroi oft ohnehin nur zwei Stufen hatten. Der Grundgedanke einer solchen Vorgehensweise lässt sich demnach als Anwendung einer Formel beschreiben: ‚Stylobatproportion = Säulenverhältnis‘. Angewandt ist diese Formel unstreitig an einigen der frühesten Bauten, wie am Heraion von Olympia
). Dass das Stylobatrechteck zum Ausgangspunkt des Entwurfs gemacht wurde und keines der anderen, oben genannten Rechtecke, lag einfach daran, dass frühe Peripteroi oft ohnehin nur zwei Stufen hatten. Der Grundgedanke einer solchen Vorgehensweise lässt sich demnach als Anwendung einer Formel beschreiben: ‚Stylobatproportion = Säulenverhältnis‘. Angewandt ist diese Formel unstreitig an einigen der frühesten Bauten, wie am Heraion von Olympia Säulen hätte man die Achsweiten also durch 5 bzw. 14 Joche teilen müssen. Erklärend dafür darf man wohl annehmen, dass die frühen Baumeister deshalb nicht mit Achsgevierten und Jochen – wie oben für den Entwurf einer regelmäßigen Säulenstellung gefordert – kalkuliert hatten, weil ein solches Vorgehen ein grundlegend anderes Verständnis von der Anlage der Ringhalle erfordert hätte. Achsgeviert und Joch sind abstrakte planerische Größen, reine Abstandsmaße, keine realen Objekte wie Säulen und Stylobatkanten. Das Kalkulieren mit Planungsgrößen statt realen Objekten ist eine Abstraktion, zu der die frühen Baumeister sicher noch nicht vorgedrungen waren.
Säulen hätte man die Achsweiten also durch 5 bzw. 14 Joche teilen müssen. Erklärend dafür darf man wohl annehmen, dass die frühen Baumeister deshalb nicht mit Achsgevierten und Jochen – wie oben für den Entwurf einer regelmäßigen Säulenstellung gefordert – kalkuliert hatten, weil ein solches Vorgehen ein grundlegend anderes Verständnis von der Anlage der Ringhalle erfordert hätte. Achsgeviert und Joch sind abstrakte planerische Größen, reine Abstandsmaße, keine realen Objekte wie Säulen und Stylobatkanten. Das Kalkulieren mit Planungsgrößen statt realen Objekten ist eine Abstraktion, zu der die frühen Baumeister sicher noch nicht vorgedrungen waren.
Man kann nun keineswegs unterstellen, dass die frühen Baumeister diese Jochdifferenzierung überhaupt als Fehler ihrer Entwürfe angesehen hätten. Das wurde allerdings in der Folgezeit offensichtlich so gesehen, denn bei jüngeren Bauten der archaischen Zeit ist die Jochdifferenzierung stets erkennbar reduziert, und bei den klassischen Ringhallentempeln vollkommen beseitigt. Als Entwurfsziel wird daher die Reduktion der Jochdifferenzierung von nahezu allen Forschern anerkannt. Über die Methoden, mit denen die Architekten geeignetere Stylobatproportionen bestimmten, besteht jedoch keine Einigkeit. Die Diskussion zeigt vielmehr grundsätzliche Auffassungsunterschiede hinsichtlich der Art des antiken Entwerfens. Die oben angeführte Vorgehensweise für die Bestimmung des Stylobatverhältnisses (‚Stylobatproportion = Säulenverhältnis‘) ist eine Formel, bei der die Stylobatlänge zu kurz gerät, so dass dort die Säulen gedrängter stehen als an der Front. Einige Forscher nehmen nun an, dass die Architekten das Prinzip, die Stylobatproportion aus dem Säulenverhältnis anhand einer Formel abzuleiten, niemals aufgegeben, sondern lediglich optimiert hätten. Das Ziel der Optimierung wäre also eine Variante der Formel, die längere Flanken ergibt, so dass auf den Langseiten genügend Raum ist, um die Säulen in annähernd gleichem Abstand aufzustellen wie an den Fronten. Konkret bedeutet das folgendes für das obige Rechenbeispiel mit
 Säulen: Die obige Formel ergibt
Säulen: Die obige Formel ergibt
 bzw.
bzw.
 bzw.
bzw.
 . Für ein einheitliches Joch wäre eine gestrecktere Proportion von etwa
. Für ein einheitliches Joch wäre eine gestrecktere Proportion von etwa
 erforderlich gewesen.134 Diese gestrecktere Proportion ließ sich annähernd durch eine einfache Modifikation der alten Formel ermitteln. Der Grundgedanke dabei war einfach folgender: Wenn bei der alten Formel die Langseite zu kurz geriet, die Säulen dort entsprechend zu dicht stehen würden, dann ließ man dort eine Säule weg, wodurch die verbleibenden Joche größer ausfielen, und damit den Frontjochen ähnlicher waren. Die alte Formel konnte so beibehalten werden, nur dass mit einer Säule mehr gerechnet wurde, als an den Langseiten errichtet wurden. Das bedeutet für das Beispiel mit
erforderlich gewesen.134 Diese gestrecktere Proportion ließ sich annähernd durch eine einfache Modifikation der alten Formel ermitteln. Der Grundgedanke dabei war einfach folgender: Wenn bei der alten Formel die Langseite zu kurz geriet, die Säulen dort entsprechend zu dicht stehen würden, dann ließ man dort eine Säule weg, wodurch die verbleibenden Joche größer ausfielen, und damit den Frontjochen ähnlicher waren. Die alte Formel konnte so beibehalten werden, nur dass mit einer Säule mehr gerechnet wurde, als an den Langseiten errichtet wurden. Das bedeutet für das Beispiel mit
 Säulen eine Stylobatproportion wie
Säulen eine Stylobatproportion wie
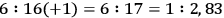 . Damit lag man schon nahe am Sollwert von
. Damit lag man schon nahe am Sollwert von
 für eine Säulenstellung ohne Jochdifferenzierung. J. J. Coulton hat für einige westgriechische Bauten eben diese Vorgehensweise als Planungsregel
für eine Säulenstellung ohne Jochdifferenzierung. J. J. Coulton hat für einige westgriechische Bauten eben diese Vorgehensweise als Planungsregel
Nach Coulton wurde in nacharchaischer Zeit mit noch weiter optimierten Formeln entworfen. Ihm zufolge ging man dabei allerdings nicht mehr vom Säulenverhältnis, sondern vom Joch und Jochverhältnis aus, berechnete daraus aber wiederum formelhaft die adäquaten Stylobatmaße. Das Joch an den Anfang des Entwurfs zu stellen, hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man ein einheitliches Jochmaß an Fronten und Flanken erreichen wollte anstelle der Jochdifferenzierung, dann war der einfachste Weg, diese einheitliche Normaljoch zu Anfang des Entwerfens endgültig festzulegen. Das bedeutete allerdings, dass die Maße für den passend bemessenen Stufenbau aus dem Joch abgeleitet werden mussten, also Fronten und Flanken nicht mehr, wie vorher üblich, die zuerst festzulegenden Größen des Entwurfs bleiben konnten. Konkret würde das folgendermaßen berechnet werden (‚later mainland rule‘): Festlegung des Jochs für Fronten und Flanken auf einen gemeinsames Maß (das sog. Normaljoch); anschließend Berechnung der Stylobatmaße durch Multiplikation des Normaljochs mit der Anzahl der Joche für Fronten bzw. Flanken plus einen Faktor x. Also in obigem Rechenbeispiel: bei
 Säulen bzw.
Säulen bzw.
 Jochen Stylobatmaße wie
Jochen Stylobatmaße wie
 . Dabei ist
. Dabei ist
 stets ein Bruchteil des Jochs. Coulton hat dafür verschiedene Werte vorgeschlagen, z. B.
stets ein Bruchteil des Jochs. Coulton hat dafür verschiedene Werte vorgeschlagen, z. B.
 ,
,
 oder auch
oder auch
 . Es sind darüber hinaus noch weitere Varianten vorgeschlagen worden, die formelhaft aus dem Säulenverhältnis abgeleitete Rechtecke zum Ausgangspunkt des Entwurfs machen, z. B. ‚Euthynterie-Proportion
. Es sind darüber hinaus noch weitere Varianten vorgeschlagen worden, die formelhaft aus dem Säulenverhältnis abgeleitete Rechtecke zum Ausgangspunkt des Entwurfs machen, z. B. ‚Euthynterie-Proportion
 Säulenverhältnis‘.137
Säulenverhältnis‘.137
Zu der formelhaften Ableitung der Stylobatproportionen bzw. -maße gehört bei Coulton noch ein zweiter grundlegender Aspekt des griechischen Entwerfens, der direkt mit dem Konzept der Formeln zusammenhängt: Wenn nämlich geeignete Abmessungen des Stufenbaus allein anhand einer Formel (und ggfs. des Jochmaßes) zuverlässig berechnet werden konnten, dann konnte auf Basis dieser wenigen Daten bereits mit der Errichtung des Stufenbaus begonnen werden, bevor noch weitere Teile des Baus durchgeplant worden wären. Coulton hat diese These vom ‚incomplete preliminary planning‘, angeregt durch die Arbeit von Bundgaard (1957) über den attischen Architekten Mnesikles
Eine vollkommen andere Sicht der Entwicklung ist vor allem unter deutschen Bauforschern vorherrschend. Die Grundpositionen dieser Sichtweise sind bereits 1934 von Hans Riemann in seiner Dissertation formuliert worden. Sie unterscheiden sich von den Auffassungen Coultons vor allem in zwei wesentlichen Annahmen. Erstens wird davon ausgegangen, dass bei Baubeginn zumindest in allen Hauptdimensionen individuell ausgearbeitete Bauentwürfe vorgelegen hätten. Zweitens wird der Übergang zur klassischen Epoche grundsätzlich anders interpretiert, denn die Architekten hätten aus den Erfahrungen mit den älteren Entwurfsverfahren radikale Konsequenzen gezogen: Statt weiter anhand von Formeln nach Stylobatproportionen und -maßen zu suchen, die im Ergebnis doch nie ein exakt einheitliches Normaljoch zuließen, stellte man – wie auch Coulton annimmt – das Normaljoch an den Anfang des Entwurfs und berechnete daraus die entsprechenden Stylobatmaße. Auf diese Weise konnte, wie schon angegeben, das Normaljoch gar nicht verfehlt werden.138 Der Preis dafür war allerdings, dass die nunmehr als abgeleitete Größe bestimmten Stylobatmaße kein einfach proportioniertes Rechteck mehr ergaben. Bei solchen Entwurfsanalysen werden die Stylobatmaße der Bauten mit Normaljoch daher nicht mehr, wie bei den archaischen Bauten, als Schlüssel zur Dechiffrierung des Entwurfs angesehen, sondern als „gleichgültig und abgeleitet“.139 So hat beispielsweise H. Bankel (1993), der umfassend den Entwurf des jüngeren Aphaiatempels auf Ägina
An sich hätte sich bei den vom einheitlichen Joch ausgehenden Entwürfen immer mindestens ein einfach proportioniertes Rechteck ergeben, zwar nicht beim Stylobat, wohl aber beim Achsgeviert, denn Länge und Breite des Achsgevierts sind in diesem Fall ja stets Vierfache des Jochs als gemeinsamem Grundmaß. Im obigen Rechenbeispiel der Ringhalle mit
 Säulen würden sich
Säulen würden sich
 Joche ergeben, mithin ein Achsgeviert von
Joche ergeben, mithin ein Achsgeviert von
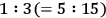 . Bei ionischen Ringhallen mit Normaljoch ist das auch der Fall. Da an dorischen Ringhallen die Eckjoche – aus Gründen, auf die noch zurückzukommen sein wird – meist um einen bestimmten Betrag verengt bzw. ‚kontrahiert‘ wurden, ging auch die Proportion des Achsgevierts bei dorischen Ringhallen wieder verloren. H. Riemann hat daher angenommen, dass die klassischen Bauten des Mutterlands stets in zwei Planphasen entworfen wurden: zunächst ohne Eckkontraktion, mit proportioniertem Achsgeviert, und anschließend umgearbeitet auf eine Version mit Eckkontraktion, und entsprechend ohne proportionertes Achsgeviert. Es ist allerdings evident, dass man die von Riemann angenommene erste Planphase mit proportioniertem Achsgeviert an einem erhaltenen Bau niemals nachweisen kann, da sie nicht ausgeführt wurde.
. Bei ionischen Ringhallen mit Normaljoch ist das auch der Fall. Da an dorischen Ringhallen die Eckjoche – aus Gründen, auf die noch zurückzukommen sein wird – meist um einen bestimmten Betrag verengt bzw. ‚kontrahiert‘ wurden, ging auch die Proportion des Achsgevierts bei dorischen Ringhallen wieder verloren. H. Riemann hat daher angenommen, dass die klassischen Bauten des Mutterlands stets in zwei Planphasen entworfen wurden: zunächst ohne Eckkontraktion, mit proportioniertem Achsgeviert, und anschließend umgearbeitet auf eine Version mit Eckkontraktion, und entsprechend ohne proportionertes Achsgeviert. Es ist allerdings evident, dass man die von Riemann angenommene erste Planphase mit proportioniertem Achsgeviert an einem erhaltenen Bau niemals nachweisen kann, da sie nicht ausgeführt wurde.
Man kann den klassisch-mutterländischen, vom Joch ausgehenden Entwurf als Paradigmenwechsel gegenüber dem archaischen, vom Stylobat ausgehenden Entwurf verstehen. Während die ältere Form des Entwerfens vom Stufenbau, gewissermaßen vom Ganzen, ausgeht, wird im jüngeren Verfahren ein einzelnes Element, eben das Joch, zum Ausgangspunkt gemacht. Oder anders gesagt: der ältere Entwurf verläuft von außen nach innen, der jüngere umgekehrt von innen nach außen. Vor allem aber ist das jüngere Verfahren in dem oben schon angesprochenen Sinn eine Abstraktion, denn hier folgt der Entwurfsprozess nicht mehr dem Bauprozess – also gleichsam der Reihenfolge der Fragen, die die Handwerker im Verlauf des Bauprozesses an den Architekten stellten, zuerst nach den Fundamentmaßen, dann den Stufenmaßen, dann der Säulenposition usw. – sondern der Entwurfsprozess sieht den Bau als ein Gesamtsystem, das von seinem zentralen Element her konstruiert werden muss.
Ein noch weiter gehender Schritt in die prinzipiell gleiche Richtung ist der Entwurf auf Basis eines Moduls. Der Abstraktionsgrad ist bei dieser Form des Entwerfens noch höher, denn während beim Joch-Entwurf ein zentrales Strukturelement des Baus, die Kombination zweier Säulen in einem fixierten Abstand, zum Ausgangspunkt der weiteren Planung gemacht wird, ist beim modularen Entwurf der Ausgangspunkt kein Architekturelement, sondern das Maß selber, eben der Modulus, der Ausgangspunkt. Er dient als universelle Einheit, mit der alle realen Bauglieder durch Teilung oder Multiplikation dimensioniert werden. Prägnante Beispiele für Grundrisse, die auf einem streng modular aufgebauten System basieren, sind Grundrisse, die ein dem Modul entsprechendes Raster zeigen. Zu ihnen gehört der spätklassische Athenatempel von Priene
Das modulare Entwurfsverfahren ist eines von zwei Entwurfsverfahren, die man auch jenseits der Bauten selbst belegen kann, denn es wird von Vitruv
2.3.3 Die Integration von Grund- und Aufriss
Grundsätzlich gab es für beide Ordnungen keinen Grund, den einmal beschrittenen Weg der Systematisierung auf die Grundrissebene zu beschränken, und in der Tat hatte man schon weit vor der Einführung des Normaljochs damit begonnen, die Entwürfe von Grund- und Aufriss zu integrieren. Das Mittel dazu war die Dimensionierung der Bauglieder. Ein zweifellos sehr altes Instrument, mit dem sich eine strukturierte Dimensionierung der Maße von Grund- und Aufriss – also die Verzahnung beider Planungsebenen – bewerkstelligen ließ, war die Verwendung von Proportionen. Sie lassen sich häufig an der Gesamtstruktur oder an zentralen Elementen der Strukturen nachweisen, etwa indem die Breite einer Säulenstellung in einfachem proportionalen Verhältnis zur Höhe der Säulenstellung steht. Für solche Beziehungen gibt es viele Varianten. Eine der häufiger zu findenden ist das Verhältnis von Joch zu Säulenhöhe, nicht selten
 (bzw. 22
(bzw. 22
 32). Auch bei der Säule selbst wird nicht selten der untere Durchmesser (gewissermaßen der Grundriss der Säule) im Verhältnis zur Höhe angegeben, wie auch von Vitruv
32). Auch bei der Säule selbst wird nicht selten der untere Durchmesser (gewissermaßen der Grundriss der Säule) im Verhältnis zur Höhe angegeben, wie auch von Vitruv
Proportionen waren zudem ein praktikables Instrument, um Entwurfsideen darzustellen und unter Fachleuten zu kommunizieren. Die Säulenstellungen vieler Bauten unterschieden sich ohnehin im Wesentlichen durch ihre Proportionen, und nur in sehr viel geringerem Maße durch Details bei der jeweiligen Ausbildung der Formen, die durch die Architekturordnungen zunehmend strikter vorgegeben waren. Folglich dürften Architekten eine recht genaue Vorstellung davon gehabt haben, welche Proportionen an den Bauten ihrer Zeit und welche an den älteren gewählt worden waren. Da sie die Bauten ständig vor Augen hatten, konnten sie sich sehr leicht ein Bild davon machen, welche Auswirkungen etwa die Änderung des Verhältnisses zwischen Säulenhöhe und Gebälkhöhe auf das Erscheinungsbild einer Fassade haben würde. Aus den gleichen Gründen verwendet heute noch die Bauforschung sehr häufig Proportionen als Instrument für den Vergleich von Bauentwürfen oder zur Identifikation von Bautraditionen, und nicht zuletzt als Mittel für die Datierung, da die Proportionierungen sich meist den Epochen zuordnen lassen. Man darf schließlich auch ziemlich sicher sein, dass die Proportionierung der einzelnen Bauglieder einen wesentlichen Teil der verlorenen Schriften griechischer Architekten ausgemacht haben, denn Vitruv
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass diese die Gesamtmaße bestimmenden Proportionen verkettet werden konnten mit den Dimensionierungen weiterer Bauglieder. So konnte die aus dem Joch abgeleitete Gesamthöhe des Gebälks durch weitere proportionale Festlegungen auch zur Binnengliederung des Gebälks herangezogen werden (Verhältnis der Höhen von Architrav, Fries und Geison). Nach dem Muster solcher Proportionsketten ist Vitruvs ionischer Tempelentwurf strukturiert.146 Die Verwendung von Proportionsketten führt bereits bei wenigen Schritten häufig zu Brüchen mit sehr großen Nennern. Einige Autoren haben daraus gefolgert, dass griechische Architekten fortgeschrittene Kenntnisse der Bruchrechnung gehabt haben müssten. Im letzten Kapitel dieses Beitrags wird darauf näher eingegangen. Dort findet sich auch eine Beispielrechnung.
Eine andere Form, Grund- und Aufrissentwurf miteinander zu verzahnen, war der schon angesprochene modulare Entwurf. Bei dieser Vorgehensweise ist die Integration von Grund- und Aufriss keine eigenständige Entwurfsentscheidung, sondern bereits in der Entwurfsmethodik verankert, denn wenn alle Entwurfsgrößen durch Teile oder Vielfache des Modulus dimensioniert werden, dann sind die Grund- und Aufrissmaße per se proportional mit einander verbunden. Man kann hier also nicht nur über den Grundriss, sondern auch über den Aufriss ein Raster legen, das aus dem Modul gebildet ist.
In der dorischen Architektur waren die Beziehungen zwischen Grund- und Aufriss wesentlich komplexer, denn dort gab es, anders als in der ionischen Architektur, strukturelle Bezüge zwischen Grund- und Aufriss jenseits der reinen Dimensionierung der Bauglieder. Diese Bezüge ergaben sich daraus, dass in der dorischen Ordnung zwei Gruppen von Baugliedern existierten, die diskrete Einheiten darstellten: die Säulenstellung mit ihrem Wechsel von Säule und Säulenzwischenraum (Interkolumnium), die den Grundriss bestimmt, und den Triglyphenfries des Gebälks mit seinem Wechsel von Triglyphen und Metopen, der zum Aufriss gehört. Bezüge zwischen diesen beiden Gliederungen waren schon weit vor der Einführung des Normaljochs etabliert worden. In der kanonischen Form des sog. Zwei-Triglyphen-Systems war der Triglyphenfries des Gebälks mit der Säulenstellung durch einen gemeinsamen Rhythmus synchronisiert, indem jeder Säule und jedem Interkolumnium jeweils ein Triglyph zugeordnet ist, also immer ein Triglyph über jeder Säule und ein weiterer zwischen den Säulen.
Auch wenn diese Zuordnung von Säulen und Triglyphen dem modernen Betrachter selbstverständlich erscheint, so war sie es doch nicht: Die Abstimmung der Position beider Elemente war ein eigener, bewusst vorgenommener Schritt, der weder von der dorischen Ordnung als ein System, noch historisch aus der älteren Holzarchitektur hervorging. Das veranschaulicht bereits das oben gezeigte Bild einer modernen Stützenstellung aus Holz (Abb. 2.3), denn dort ist die Lage die Deckenbalken keineswegs auf die Position der Stützen abgestimmt. In der Antike war es zunächst auch nicht anders, denn die Triglyphen waren anfangs tatsächlich relativ willkürlich, ohne Bezug auf die Säulenstellung auf dem Gebälk verteilt. Das zeigt noch der älteste der großen sizilischen Tempelbauten, der Apollontempel von Syrakus zueinander verhalten, bzw. das Joch zur Triglyphenbreite wie
zueinander verhalten, bzw. das Joch zur Triglyphenbreite wie
 .147
.147
Hier zeigt sich nun aber die Eigendynamik der gewissermaßen nur erst begonnen Systematisierung: Solange die Joche an den Fronten breiter waren als an den Flanken, mussten auch die Triglyphen bzw. Metopen an Fronten und Flanken unterschiedlich breit ausfallen. Genauer gesagt, entweder waren die Triglyphen breiter, oder die Metopen, und dann war die
 Proportion nicht realisierbar. Oder aber die Proportion wurde bewahrt, dann waren weder die Triglyphen- noch die Metopenbreiten einheitlich. Das war auch deutlich sichtbar, weil hier ein weiterer Zusammenhang wirkt: Architrav und Fries mussten aus konstruktiven Gründen gleich hoch sein, wie umlaufende Quaderschichten. Das Verhältnis von Höhe zu Breite der Triglyphen bzw. der Metopen musste daher unterschiedlich ausfallen: Bei umlaufend gleicher Frieshöhe waren über den kürzeren Jochen Triglyphen und Metopen jeweils schlanker als über den längeren Jochen. Diese Differenzen reproduzierten sich schließlich in den vom Fries abhängigen Gliederungen: Analog zu den unterschiedlichen Breiten von Triglyphen und Metopen an Fronten und Flanken mussten auch am Geison die Mutuli und Viae unterschiedlich bemessen werden, und ebenso die von der Triglyphenbreite abhängigen Regulae, und selbst die Zwischenräume zwischen den Tropfen der Regulae mussten unterschiedlich bemessen werden. Macht man sich alle diese Maß- und Proportionsunterschiede im Gebälk bewusst, die sich aus der Verschiedenheit der Joche an Fronten und Flanken ergaben, wird nachvollziehbar, woher der Impetus kam, nach Entwurfsverfahren zu suchen, die ein einheitliches Joch an allen Seiten ermöglichten. Die Systematisierung der Grundrisse im Sinne des Normaljochs war vermutlich sogar angestoßen durch die vielen Maß- und Proportionsunterschiede im Gebälk bzw. im Aufriss. In der ionischen Ordnung gab es keine vergleichbaren Abhängigkeiten zwischen Joch und Gebälkgliederung, weil ionische Gebälke nur kontinuierliche, nicht rhythmisierte Ornamentformen hatten (Faszien und Kymatien), die wie ein elastisches Band auf beliebige Jochmaße hin gedehnt oder gestaucht werden konnten.
Proportion nicht realisierbar. Oder aber die Proportion wurde bewahrt, dann waren weder die Triglyphen- noch die Metopenbreiten einheitlich. Das war auch deutlich sichtbar, weil hier ein weiterer Zusammenhang wirkt: Architrav und Fries mussten aus konstruktiven Gründen gleich hoch sein, wie umlaufende Quaderschichten. Das Verhältnis von Höhe zu Breite der Triglyphen bzw. der Metopen musste daher unterschiedlich ausfallen: Bei umlaufend gleicher Frieshöhe waren über den kürzeren Jochen Triglyphen und Metopen jeweils schlanker als über den längeren Jochen. Diese Differenzen reproduzierten sich schließlich in den vom Fries abhängigen Gliederungen: Analog zu den unterschiedlichen Breiten von Triglyphen und Metopen an Fronten und Flanken mussten auch am Geison die Mutuli und Viae unterschiedlich bemessen werden, und ebenso die von der Triglyphenbreite abhängigen Regulae, und selbst die Zwischenräume zwischen den Tropfen der Regulae mussten unterschiedlich bemessen werden. Macht man sich alle diese Maß- und Proportionsunterschiede im Gebälk bewusst, die sich aus der Verschiedenheit der Joche an Fronten und Flanken ergaben, wird nachvollziehbar, woher der Impetus kam, nach Entwurfsverfahren zu suchen, die ein einheitliches Joch an allen Seiten ermöglichten. Die Systematisierung der Grundrisse im Sinne des Normaljochs war vermutlich sogar angestoßen durch die vielen Maß- und Proportionsunterschiede im Gebälk bzw. im Aufriss. In der ionischen Ordnung gab es keine vergleichbaren Abhängigkeiten zwischen Joch und Gebälkgliederung, weil ionische Gebälke nur kontinuierliche, nicht rhythmisierte Ornamentformen hatten (Faszien und Kymatien), die wie ein elastisches Band auf beliebige Jochmaße hin gedehnt oder gestaucht werden konnten.
Das Eckproblem
Der Eckkonflikt war ein Symmetrieproblem in dem Sinne, dass das Eckjoch und das Normaljoch niemals völlig identisch sein konnten. Entweder für das Joch, oder für die Triglyphen- oder die Metopenbreite konnte das jeweilige Normalmaß nicht übernommen werden.148 Der Konflikt entstand durch die Unvereinbarkeit zweier Prinzipien, nämlich erstens dem Grundsatz, dass die Architrave stets breiter waren als die Triglyphen, und zweitens dem in der griechischen Architektur stets beachteten Grundsatz, dass ein dorischer Fries immer mit einem Triglyphen beginnen und enden sollte. Die Breite der Architrave war konstruktiv bestimmt, da sie das übrige Gebälk und große Teile der Dachlast tragen mussten. In der Regel hatten die Architrave eine Breite von etwa vier Zehnteln des Jochs, das sie überdecken. Die Breite der Triglyphen war hingegen rein formal festgelegt. Sie entsprach fast immer etwa zwei Zehnteln des Jochs, was sich wiederum aus der oben angesprochenen
 Proportion von Triglyphen- zu Metopenbreite ergibt.149 Diese Differenz führte nun dazu, dass der Triglyph an der Ecke des Gebälks nicht – wie der Architrav unter ihm und die übrigen Triglyphen über den Säulen – in der Achse der Säule bzw. des Architravs platziert werden konnte, sondern nach außen versetzt werden musste (siehe Abb. 2.6). Der Konflikt ist ein klassisches Dilemma: Hätte man den Triglyphen über der Ecksäule in die Achse der Säule verschoben, hätte außen an den Triglyphen noch das Fragment einer Metope angefügt werden müssen, damit Fries und Architrav gleich lang gewesen wären. Ein solches Metopenfragment wurde jedoch niemals toleriert. Platzierte man den Triglyphen jedoch an der Ecke, ergab sich, wie auf der Abbildung dargestellt, ein Achsversatz zwischen Triglyphen- und Säulenachse.
Proportion von Triglyphen- zu Metopenbreite ergibt.149 Diese Differenz führte nun dazu, dass der Triglyph an der Ecke des Gebälks nicht – wie der Architrav unter ihm und die übrigen Triglyphen über den Säulen – in der Achse der Säule bzw. des Architravs platziert werden konnte, sondern nach außen versetzt werden musste (siehe Abb. 2.6). Der Konflikt ist ein klassisches Dilemma: Hätte man den Triglyphen über der Ecksäule in die Achse der Säule verschoben, hätte außen an den Triglyphen noch das Fragment einer Metope angefügt werden müssen, damit Fries und Architrav gleich lang gewesen wären. Ein solches Metopenfragment wurde jedoch niemals toleriert. Platzierte man den Triglyphen jedoch an der Ecke, ergab sich, wie auf der Abbildung dargestellt, ein Achsversatz zwischen Triglyphen- und Säulenachse.
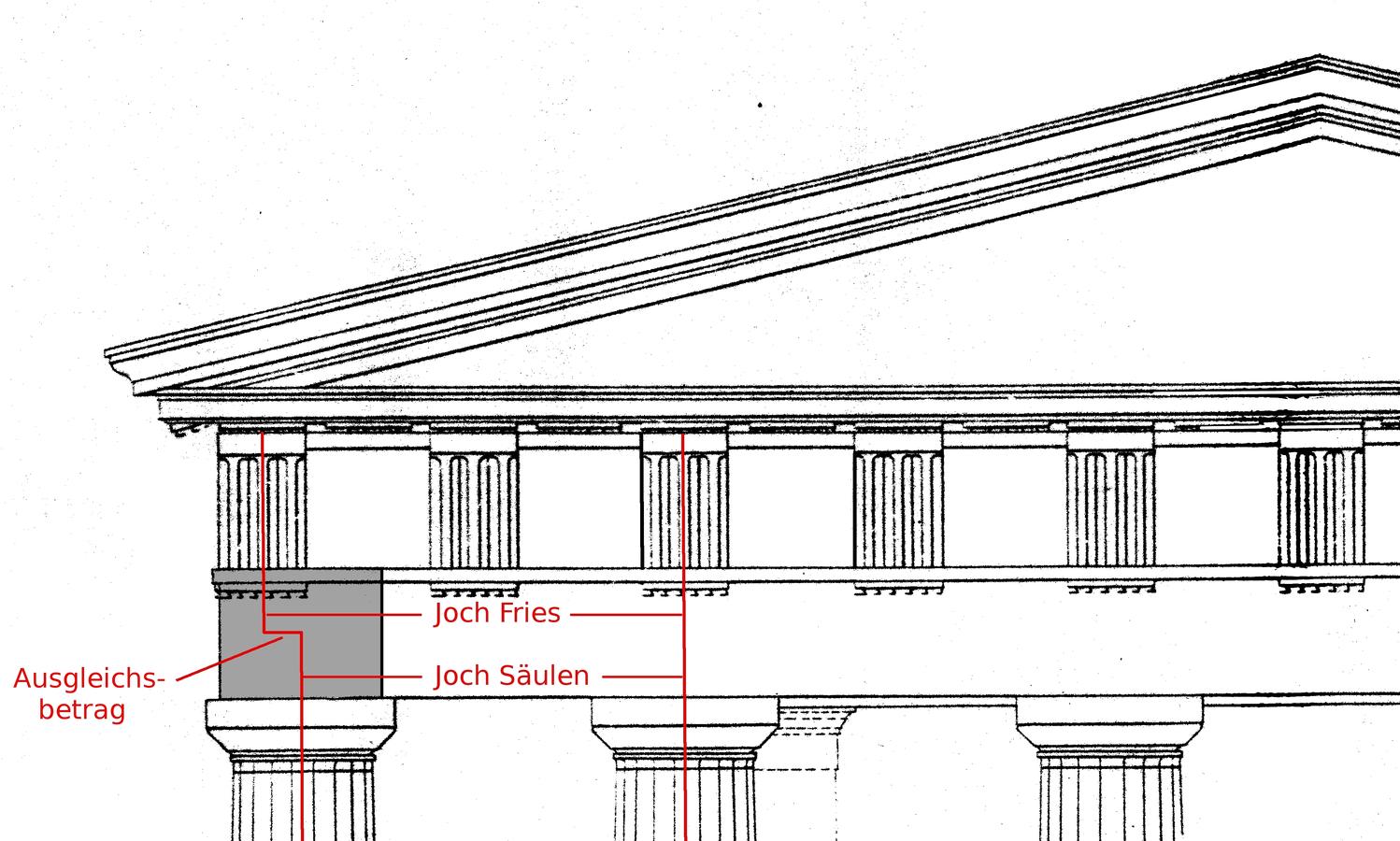
Abb. 2.6: Dorischer Eckkonflikt (Adler and Curtius 1892, Tf. 24, modifizierter Ausschnitt).
Dieser Achsversatz bedeutete, dass an der Ecke der Säulenstellung der Achsabstand der letzten beiden Säulen stets kleiner sein musste als der Achsabstand der Triglyphen über diesen beiden Säulen. Wenn die Achsabstände bzw. Säulenjoche alle gleich groß waren, so waren die Achsabstände der Triglyphen über dem Eckjoch größer als normal. Oder umgekehrt, wenn die Abstände der Triglyphen durchgehend einheitlich waren, dann waren die Achsabstände zwischen den Ecksäulen kleiner als normal (sog. Eckkontraktion). Natürlich war auch eine Kombination dieser beiden grundlegenden Vorgehensweisen möglich, d. h. eine Kombination aus Eckkontraktion und Dehnung der Achsabstände der Triglyphen über dem Eckjoch (Abb. 2.7).
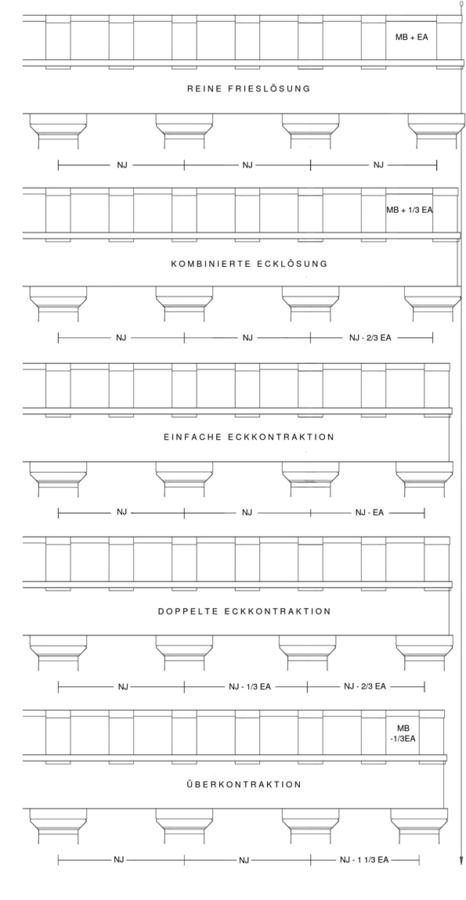
Abb. 2.7: Übersicht über die Lösungen des dorischen Eckkonflikts (Osthues 2005).
Nahezu alle denkbaren Varianten, den Eckausgleich in der Säulenstellung und bzw. oder im Fries abzutragen, sind im Laufe der Zeit realisiert worden. Ihnen allen gemeinsam war allerdings, dass sie immer nur verschiedene Gestaltungen des Eckausgleichs darstellten, denn eine Lösung im Wortsinne, bei der an der Ecke der Säulenstellung überhaupt keine Unregelmäßigkeiten aufgetreten, war unter den oben angegebenen Bedingungen nicht möglich.150
Der Eckkonflikt ist war ein Entwurfsproblem, das, wie die Geschichte seiner Lösungen zeigt, die griechischen Architekten in erheblichem Umfang beschäftigt hat. So hat es über einhundert Jahre gedauert, bis die letzte der entwickelten Lösungen, die einfache Eckkontraktion, realisiert worden war.151 Auch danach wurde die Thematik offenbar weiter verhandelt, was daraus hervorgeht, dass keine der verschiedenen Lösungen sich jemals vollständig durchgesetzt hat. Einen ‚Schluss der Debatte‘ hat es also nie gegeben, obwohl er sozusagen beantragt wurde: Renommierte Architekten der späten Klassik und des Hellenismus wie Pytheos
Systematisch gesehen, war das Eckproblem kein ursprüngliches Problem der dorischen Ordnung selbst. Es war ein Problem, das sich erst aus dem immer weiter gesteigerten Anspruch auf Systematisierung ergab.
Hätte man nämlich, wie noch am Apollontempel in Syrakus
Konsequenzen für den Bauentwurf
Eine der oben erwähnten Lösungen für den Eckkonflikt, die sog. einfache Eckkontraktion, hat besondere Bedeutung sowohl für das antike Entwerfen selbst als auch für die oben schon skizzierte moderne Diskussion dieser Verfahren. Bei der einfachen Eckkontraktion wurde der Triglyphenfries vollständig aus normal bemessenen Triglyphen und Metopen gebildet. Der Ausgleichsbetrag wurde allein durch die Kontraktion des Eckjochs realisiert. Das Eckjoch musste dafür gegenüber dem Normaljoch exakt um den Betrag verkürzt werden, der sich aus der Differenz von Architrav- und Triglyphenbreite ergab. Wäre dieser Betrag verfehlt worden, hätte der Fehler im Triglyphenfries durch verlängerte oder verkürzte Metopen bzw. Triglyphen über dem Eckjoch ausgeglichen werden müssen. Der Fries wäre damit nicht mehr völlig regelmäßig gewesen.
Prinzipiell hatten die Architekten zwei Möglichkeiten, das Maß für die Verkürzung des Eckjochs zu bestimmen. Sie konnten dieses Maß anhand einer Formel berechnen, und zwar derselben Formel, die Richard Koldewey in seinem großen Werk über die westgriechischen Tempelbauten formuliert hat: {AB – TB}
 . Das heißt, das Eckjoch musste um die halbe Differenz von Architrav- und Triglyphenbreite gegenüber dem Normaljoch verkürzt werden.154 Dass diese Formel in der Antike bekannt war, ist zwar nicht zu beweisen, aber keinesfalls unwahrscheinlich. Sie könnte in den leider vollständig verlorenen Schriften griechischer Architekten über ‚Symmetrien dorischer Tempel‘ enthalten gewesen sein. Die Lektüre solcher Architekturschriften für die Ausbildung zum Architekten wird bereits von Xenophon
. Das heißt, das Eckjoch musste um die halbe Differenz von Architrav- und Triglyphenbreite gegenüber dem Normaljoch verkürzt werden.154 Dass diese Formel in der Antike bekannt war, ist zwar nicht zu beweisen, aber keinesfalls unwahrscheinlich. Sie könnte in den leider vollständig verlorenen Schriften griechischer Architekten über ‚Symmetrien dorischer Tempel‘ enthalten gewesen sein. Die Lektüre solcher Architekturschriften für die Ausbildung zum Architekten wird bereits von Xenophon
Hieraus ergibt sich eine eindeutige Schlussfolgerung für die oben referierte Diskussion um die griechische Entwurfspraxis. Für Bauten mit einfacher Eckkontraktion sind die beiden Annahmen von Coulton157 und anderen nicht haltbar. Man kann nicht von ‚incomplete preliminary planning‘ sprechen, wenn bei der Verlegung der untersten Fundamentplatten die Gebälkmaße bereits nachweisbar fixiert worden waren. Ebensowenig können die Stylobatproportionen nach Faustregeln (‚rules of thumb‘) festgelegt worden sein, die keinen Bezug zum Gebälk hatten. Denn selbst wenn ein qua Formel festgelegter Stylobat annähernd für die einfache Eckkontraktion geeignet gewesen wäre, so blieb es doch von drei weiteren Faktoren abhängig, ob der Fries tatsächlich regelmäßig ausfallen konnte oder nicht: dem Achsabstand der Säulen von der Stylobatkante,158 der Architrav- und der Triglyphenbreite. Dass diese drei Faktoren mehr oder minder zufällig, ohne entsprechende Vorausplanung in genau passendem Verhältnis zu einander gestanden hätten, ist kaum vorstellbar.
Umgekehrt ist es – mit Coulton – durchaus plausibel anzunehmen, dass an Bauten, bei denen die Eckkontraktion zwar vorhanden war, aber nicht genau dem Ausgleichsbetrag entsprach, so dass weitere Anpassungen im Gebälk notwendig wurden, die Größe der Eckjoche aus der Anwendung von Grundrissformeln resultierte. Das ließ sich praktisch auch leicht realisieren, denn wenn der Baufortschritt den Fries erreicht hatte, konnte dort einfach ausgemessen werden, um wie viel länger oder kürzer als das Normalmaß die Triglyphen und Metopen über dem Eckjoch sein mussten.
2.3.4 Architekturordnungen und Bauentwurf: Architektur als ‚System‘
Die griechischen Architekturordnungen waren zunächst nichts weiter als ein einfaches, nahezu universelles bautechnisches Grundmuster (Stütze – Gebälk), verbunden mit den spezifisch griechischen Formen für Kapitell, Architrav, Geison usw. Die Herausbildung dieser Formen in der frühen Holzarchitektur ist nahezu nicht mehr zu verfolgen. Was man aber nachzeichnen kann, ist die schrittweise Transformation der alten Ordnungen in Systeme, mit stabilen Ordnungsprinzipien, einer großen Zahl von Abhängigkeiten und systemspezifischen Problemstellungen. Diese Transformation setzte voraus, dass die Ordnungen, wenn sie auch ursprünglich keine Systeme waren, so doch gewissermaßen systemfähig waren. Grundmuster wie etwa der Antentempel oder auch der Peripteraltempel gab es bereits in hocharchaischer Zeit, nur wurden sie dort noch mehr oder weniger mit freier Hand abgesteckt,159 später jedoch konstruiert nach Maß und Zahl, und mit hohem Anspruch an Exaktheit. Einen ansatzweise ähnlichen Prozess hat es auch in der Vasenmalerei gegeben. Deren Ornamentformen wurden ebenfalls zunächst mit freier Hand aufgemalt, doch waren viele dieser Formen im Grundsatz geometrisch (Halbkreise, Spiralen, Mäander usw.), so dass schon in protogeometrischer Zeit die zuvor aufgemalten Formen mit dem Zirkel in den Ton aufgerissen werden konnten. Genauso sind die Voluten des ionischen Kapitells, geometrisch gesehen Spiralen, in der frühesten Zeit noch freihändig ausgearbeitet worden, später jedoch mit dem Zirkel konstruiert worden. Die bei weitem wichtigste Voraussetzung, die die Transformation der alten Ordnungen in Systeme möglich gemacht hat, lag aber wohl in der Bautechnik. Das zeigt die Gegenüberstellung mit anderen elementaren Techniken des frühen Bauens: Mauern aus Lehmziegeln waren, strukturell gesehen, ein Kontinuum ohne innere Gliederung, das entsprechend wie ein Band beliebig verlängert oder verkürzt werden konnte. Stützenstellung wie in den griechischen Ordnungen bestanden dagegen aus diskreten Einheiten, die immer eine – regelmäßige oder unregelmäßige – Gliederung hatten, und auch nur um mindestens eine Einheit verlängert oder verkürzt werden konnten. Nur solche gegliederten, rhythmisierten Strukturen, nicht aber bandartige Strukturen wie Mauern konnten bei fortgeschrittener Systematisierung überhaupt zu Problemen wie Jochdifferenzierung oder Eckkonflikt führen. Und noch ein zweiter Aspekt der Stützenstellungen hat in diesem Zusammenhang grundlegende Bedeutung: Stützenstellungen, über Eck angeordnet, tragen das Prinzip des Entwerfens in Proportionen immer schon in sich. Allein das bloße Abzählen der Stützen an Fronten und Flanken zur Benennung ihrer jeweiligen Längen führt direkt zum Planen bzw. Entwerfen in ganzzahligen Verhältnissen.
Aber auch wenn diese elementaren Strukturen der frühen Holzarchitektur gleichsam eine geeignete objektive Basis für die späteren Entwurfssysteme darstellten, so handelt es sich bei der folgenden Entwicklung doch keineswegs um irgendeine Form von Eigendynamik eines Systems. Der entscheidende Impuls für alles weitere war der subjektive Gestaltungsanspruch der griechischen Architekten. Das illustriert schon die Tatsache, dass auch in vielen anderen Epochen und Regionen ebenfalls mit Stütze und Gebälk gebaut wurde, ohne dass daraus vergleichbare Systeme entwickelt worden sind. Die Systematisierung der alten griechischen Ordnungen war ein längerer Prozess. Das entsprechende Interesse der Architekten ist bereits frühzeitig erkennbar, wenn auch zunächst in der schlichten Form, gewissermaßen „Ordnung im Säulenwald“ (G. Gruben) zu schaffen. Zu den ersten solchen Eingriffen zählt die Verpflichtung auf strikte Uniformität funktional gleichartiger Bauglieder. Sie ist offenbar erst in der Steinarchitektur durchgesetzt worden, denn an einigen alten Bauten wie etwa die sog. Basilica in Paestum
Die zweifellos anspruchsvollste Aufgabe bei der Transformation des alten, gleichsam freihändigen Umgangs mit den Ordnungen in eine klar strukturierte Bauplanung war der scheinbar schlichte Anspruch, auch die Jochmaße an Fronten und Flanken zu vereinheitlichen. Uniforme Jochmaße waren viel schwieriger zu realisieren als uniforme Kapitellprofile. Im Kontext dieser selbst gestellten Aufgabe wird auch aus dem Architekten des alten Typs, dessen Stellung dadurch bestimmt ist, dass er handwerklich und technisch qualifizierter ist als die übrigen Steinmetzen, der Architekt im modernen Sinne, dessen primäre Aufgabe das Entwerfen des Bauplans ist. Die geschilderten Schritte auf dem Weg zur Eliminierung der Jochdifferenzierung geben hier einige aufschlussreiche Einblicke. Der erste Schritt in diese Richtung, also die westgriechische Methode, eine der für die Stylobatproportion kalkulierten Säulen der Langseite wegzulassen, war noch reiner Pragmatismus, sozusagen ein handwerklicher Kunstgriff, der kein theoretisches Konzept voraussetzt. Ähnlich wie in einem Brettspiel entnahm man der Grundrissfigur einen Spielstein und passte die Postion der übrigen ein wenig an, und schon war die Figur im Sinne der Regelmäßigkeit deutlich optimiert.
Die später gefundenen Lösungen sind aber schon Ergebnisse einer Analyse der Ringhalle als Struktur, denn sie implizieren eine doppelte Abstraktionsleistung, wie zuvor schon gezeigt wurde: Zum einen war bei diesen Lösungen nicht die Anzahl der Baukörper, d. h. die Anzahl der Säulen, sondern das Verhältnis ihres Abstands voneinander, also das Joch als reines Maß der Ausgangspunkt entsprechender Entwurfsverfahren. Zum anderen emanzipierte sich beim vom Joch ausgehenden Entwerfen der Entwurfsprozess endgültig vom Bauprozess. Der Entwurfsprozess hatte sein eigenes Muster, das keine bloße Vorwegnahme der am Bau notwendigen Schritte mehr war, denn das einheitliche Normaljoch ließen sich nur realisieren, wenn bei der Planung das Joch – oder für den einheitlichen Triglyphenfries das Gebälk – zum Ausgangspunkt gemacht wurde, während das Bauen stets und immer mit dem Legen der Fundamente für den Stufenbau begann. Das modulare Entwerfen war letztlich nur eine weiter getriebene, gleichsam noch abstraktere Variante dieser Verfahren, denn dort wurde gar nicht mehr von einer zentralen Baugruppe wie dem Joch oder dem Gebälk ausgegangen, sondern von einem reinen Maßsystem, einem dem Modul entsprechenden Raster, in das die Grund- und Aufrisse wie in Millimeterpapier eingezeichnet werden konnten. Bei allen diese Verfahren ergab sich zudem zwangsläufig eine wesentlich größere Planungstiefe als notwendig war, solange man mit den älteren Formeln gearbeitet hatte, bei denen eine Jochdifferenzierung akzeptiert werden musste.
Für diese Entwicklung lassen sich keine äußeren Anstöße jenseits des Interesses der Architekten an systematischer Strukturierung angeben. An Stabilität hatte es selbst den Bauten mit vergleichsweise großer Jochdifferenzierung nie gemangelt: Immerhin stehen noch heute Joche der Apollontempel von Korinth
Es bleibt daher die Frage, woher der Impuls zur Strukturierung der Entwürfe seine außerordentliche Intensität, und vor allem seine Dauerhaftigkeit bezog. Man könnte den Anspruch auf strikte Systematik des Entwerfens mit der im Werksteinbau geforderten Präzision in Verbindung bringen, d. h. die Übertragung eines baukonstruktiven Prinzips auf das Entwerfen. Im Werksteinbau ohne Einsatz von ausgleichenden Bindemitteln wie Mörtel war ein exakter Fugenschluss bei manchen Baugruppen zwingend, beispielsweise bei den Lagerfugen von Säulentrommeln, denn bei einem Schaft mit zehn Horizontalfugen zwischen den Trommeln würde die Stabilität der Säule spürbar beeinträchtigt, wenn sich das Lagerspiel von unpräzise gearbeitete Fugen addiert – die Säule würde wackeln. Man kann in diesem Sinne fragen, ob die Präzision in der Schichtung der Säulentrommeln nicht darauf geführt haben sollte, mit der gleichen Präzision auch den Abstand zwischen den Säulen festzulegen. Das ist auch gemacht worden.160 Man findet zudem Belege für eine technisch kaum noch begründbare Präzision an Baugruppen, die kaum Stabilitätsprobleme aufwerfen.161 Eine Fetischisierung von Präzision lässt sich aber trotz solcher Beispiele keineswegs generell unterstellen. Viele Bauten zeigen vielmehr umgekehrt, dass die Baumeister und Handwerker sehr genau wussten, wo Exaktheit aus technischen Gründen gefragt war, und wo nicht. So zeigen die Abakusbreiten dorischer Kapitelle selbst am Parthenon Unterschiede, die im Bereich von Lagerfugen unmöglich hätten toleriert werden können. Einen Weg, der direkt von bautechnisch geforderter Präzision zur strikten Systematisierung von Bauentwürfen führen würde, gibt es demnach nicht. Strapaziert man den Gedanken etwas weniger, bleibt es gleichwohl plausibel anzunehmen, dass zumindest die Baumeister der archaischen Zeit einen Begriff von Qualität entwickelt hatten, der auch beim Entwerfen einen ‚sauberen Fugenschluss‘ verlangte.
Spätestens für die Zeit ab dem 5. Jahrhundert kann man zeigen, dass der vielleicht aus dem ambitionierten Handwerk stammende Anspruch, Größenverhältnisse durch Proportionen in ein klar strukturierten Zusammenhang zu bringen, auch jenseits der Architektur vielfach formuliert worden ist. In allgemeiner Form waren Maß und Zahl als Gesetz des Kosmos schon eine frühe theoretische Grundposition der Pythagoreer. Aufgegriffen wurde dieser Gedanke in der Folge auch von Philosophen wie Platon
Konkreter mit der Entwicklung der Architektur verbinden lassen sich ästhetische Theorien mit explizitem Bezug zur Praxis, die Proportionen ins Zentrum der künstlerischen Arbeit gestellt haben, wie etwa der berühmte – wenn auch im Einzelnen kaum bekannte – Kanon des Polyklet
Übersehen sollte man bei dem Bezug auf solche Theorien allerdings nicht, dass es dafür noch ein zweites Motiv gab. Das Entwerfen wird durch diese Bezugnahmen von einer ursprünglich zum Handwerklichen gehörenden Tätigkeit zu einer angewandten Wissenschaft. Dieser Anspruch ist lange vor Vitruv
2.3.5 Bauzeichnungen
Eine weitere Funktion der Zeichnungen
Vor diesem Hintergrund, sowie der prominenten Stellung der Geometrie innerhalb der griechischen Wissenschaften, und schließlich der geradezu ins Auge springenden Geometrie der Formen der griechischen Architektur, ist es kaum überraschend, dass vor allem die frühe Forschung mit Selbstverständlichkeit davon ausgegangen ist, dass die griechischen Architekten ihre Bauten mit Stift, Lineal und Zirkel entworfen haben. Nach Aufmaß angefertigte Grund- und Aufrissdarstellungen antiker Ruinen wurden daher von vielen Forschern nach geometrischen Konstruktionslinien abgesucht, die aufzeigen sollten, welche Grundsätze und welche Schrittfolgen die Entwürfe widerspiegeln.168
Aber schon der hier mehrfach zitierte Hans Riemann, und nach ihm viele der Architekten, die selbst an Aufnahmen antiker Bauten gearbeitet haben, haben zeichnerische Entwurfsverfahren für die archaische und klassische Zeit mit verschiedenen Einwänden bestritten. So wird darauf verwiesen, dass für das Zeichnen von Plänen, deren Maßstab ausreichend groß war, um Details präzise abgreifen zu können, kein geeigneter Zeichengrund verfügbar war. Antike Papyrosblätter von Büchern hatten eine Breite von nur ca. 45 cm, und wurden bei Buchrollen zwar aneinander geklebt, jedoch ist über große Formate nichts bekannt. Zudem werden weder in Inschriften noch in literarischen Quellen jemals entsprechende Baupläne erwähnt. Hinzukommt, dass für die Visualisierung von Entwurfsideen in Grundrissplänen oder Fassadenaufrissen in den beiden frühen Epochen kaum Bedarf bestanden haben dürfte, da angesichts der Typengebundenheit und der strukturellen Ähnlichkeit der Bauten leicht vorstellbar war, welchen Effekt Änderungen der Proportionen haben würden.169 Akzeptiert werden von diesen Autoren, auch für die früheren Epochen, allein Werkrisse für die Konstruktion von Architekturdetails (dazu ausführlich unten).
Die Annahme, dass die Vitruv
Es gibt jedoch auch ältere Bauten, deren Grundrisse kaum anders als geometrisch ausgearbeitet worden sein können, nämlich die Rundtempel. Für die spätklassische Tholos in Delphi
Fasst man das bisher Angeführte zusammen, so wird man zwar keinen Grund haben zu bezweifeln, dass für den Bau der kanonischen Tempelformen in der Tat kein Anlass bestand, Bauzeichnungen
Eine wesentlich verbesserte Grundlage für das Verständnis der Bedeutung von Zeichnungen
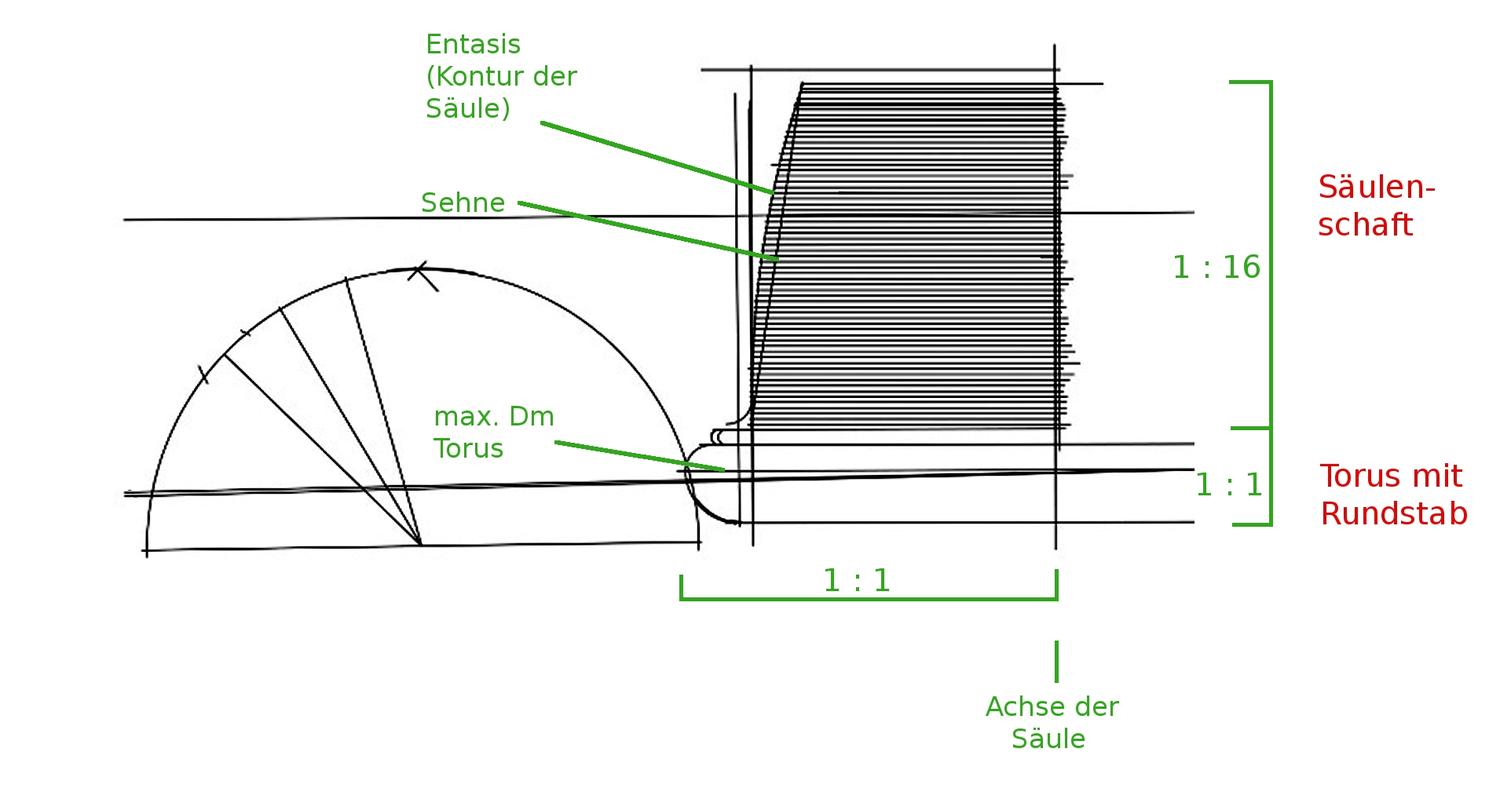
Abb. 2.8: Konstruktionszeichnung eines Säulenschaftes mit angearbeitetem Torus auf einer Wand des Adytons am hellenistischen Apollontempel in Didyma
Unter den erhaltenen Werkrissen findet sich ausschließlich  , so dass in dieser Ebene ein Daktylos der Zeichnung einem Fuß am ausgeführten Werkstück entspricht. Die sechzig parallelen Linien im Abstand von einem Daktylos entsprechen folglich einer Schaftlänge von 60 Fuß oder ca. 18 m. Ohne diesen reduzierten Maßstab wäre der Schaft auf der wesentlich niedrigeren Wand gar nicht darstellbar gewesen.
, so dass in dieser Ebene ein Daktylos der Zeichnung einem Fuß am ausgeführten Werkstück entspricht. Die sechzig parallelen Linien im Abstand von einem Daktylos entsprechen folglich einer Schaftlänge von 60 Fuß oder ca. 18 m. Ohne diesen reduzierten Maßstab wäre der Schaft auf der wesentlich niedrigeren Wand gar nicht darstellbar gewesen.
Die Länge jeder dieser parallelen Linien, gemessen zwischen der Konturlinie und der Achse, gibt so den (halben) Durchmesser des Schaftes auf der Höhe an, die diese jeweilige Linie bezeichnet. Der Radius des Unterlagers der untersten Säulentrommel entspricht also der Länge der untersten Linie zwischen Achse und Kontur, der Radius des Oberlagers der obersten Trommel der Länge der obersten Linie usw. Bei der Ausarbeitung der Endform des Schaftes ergab sich damit für jeden Fuß Höhe der zugehörige Sollwert für den Radius des Schaftes.
Der Werkriss diente nicht allein als Maßvorgabe für die Steinmetzen, die die Maße mit dem Stechzirkel an dem Riss abgreifen konnten, sondern diente zugleich der Konstruktion der Entasis
Die Zeichnung des Torus (Wulst) unter dem Schaft ist ebenfalls zugleich Maßvorgabe und Konstruktion. Sein äußeres Profil war zunächst durch zwei Viertelkreise angegeben, deren Einstichpunkte auf der horizontalen Linie liegen, die die Lage des maximalen Durchmessers des Torus angibt. Der untere Viertelkreis ist jedoch ein zweites Mal gezeichnet worden, wobei der neue Einstichpunkt unterhalb der horizontalen Linie lag, wodurch die Kurve unten stärker einzieht als beim ersten Einstichpunkt. Ähnliche Überarbeitungen einer zuvor entwickelten Grundform lassen sich auch an einem zweiten Riss nachweisen, auf dem Gebälk und Giebel des Naïskos dargestellt sind, eines kleinen tempelförmigen Baus innerhalb des Adyton. Dieser Riss gibt allerdings, anders als der Schaftriss, nicht die tatsächlich ausgeführte Form wider, denn der Naïskos, von dem sich Werkstücke erhalten haben, war deutlich weniger breit als auf dem Riss. Die Zeichnung ist, gerade weil sie verworfen worden ist, definitiv ein Teil des Entwurfsprozesses gewesen.
Entwurfszeichnungen
Vor dem Hintergrund der hier zuletzt beschriebenen Werkrisse ist davon auszugehen, dass zeichnerische Formen des Entwerfens vor allem bei der Konstruktion von Detailformen schon sehr früh eine erhebliche Rolle gespielt haben – wahrscheinlich eine weit größere als in der Grundrissentwicklung.
2.3.6 Paradeigma und Anagraphé
Neben den Bauten selbst und den Werkrissen geben auch die Inschriften Hinweise auf die Arbeitsweise der griechischen Architekten. Zwei Termini spielen hier eine besondere Rolle.
Paradeigma, ‚Beispiel‘, bedeutet zweierlei: zum einen ein einzelnes Exemplar einer Menge gleichartiger Objekte, zum anderen das Vorbild oder Muster für eine Menge entsprechender Objekte. Die letztgenannte Bedeutung ist sicher die, die in den Bauinschriften gemeint ist. Die ältere Deutung der Inschriften sah in Paradeigmata Modelle
Im allgemeinen wird die Interpretation von Paradeigma im Sinne eines Modells von ganzen Gebäuden heute abgelehnt.183 Geltend gemacht wird vor allem, dass Modelle für die grundsätzliche Abstimmung mit dem Bauherrn angesichts der Typengebundenheit der griechischen Architektur kaum erforderlich gewesen sein können. Als Instrument für die Darstellung eines Entwurfs für die Handwerker auf der Baustelle wären Modelle ungeeignet gewesen, denn die Maßstabsreduktion hätte es kaum ermöglicht, die Größen und Formdetails von einzelnen Baugliedern am Modell abzugreifen.
Sehr viel plausibler ist die Deutung von Paradeigma als Musterexemplar für die Anfertigung von Bauteilen mit komplexer Form, die für ein Gebäude in Serien hergestellt werden mussten. Einige dieser Bauteile sind auf andere Weise, also durch Beschreibung oder zweidimensionale Zeichnung, gar nicht vollständig darstellbar. Das gilt vor allem für das korinthische Kapitell. In einem Fall hat sich ein solches Musterstück wahrscheinlich erhalten. Im Heiligtum von Epidauros
Weiterhin gibt es inschriftliche Hinweise auch auf ionische Musterkapitelle. Eine dieser Inschriften stammt aus der Zeit, als Athen
Neben Kapitellen, die nicht rotationssymmetrische Formen hatten wie das dorische Kapitell (hier genügte zur Ausarbeitung eine Schablone mit dem Kapitellprofil), haben auch für alle Elemente der plastischen Bauornamentik sicher Modelle bereitgestellt sein müssen, etwa für die Simen (Traufrinnen) mit Wasserspeiern in Form von Löwenköpfen und die Akrotere, d. h. die floralen oder figürlichen Schmuckelemente an den Ecken und Firsten der Dächer.
Auch einfachere Formen wurden durch Paradeigmata definiert. Eindeutig ist der Hinweis auf die Aufbewahrung eines Musterstücks für die Dachziegel der Skeuothek, des im letzten Kapitel schon erwähnten Arsenals im Hafen von Piräus
Paradeigmata gab es zudem auch für die Verbindungselemente. Inschriftlich nachweisbar ist das Musterstück eines Dübels für die Vorhalle des Telesterions von Eleusis
Aus Holz waren hingegen die Kisten, die in der Skeuothek für die Aufbewahrung der Schiffsausrüstung dienten, für die es ebenfalls ein Paradeigma des Architekten gab.188 Auch aus Holz war eine beiderseits weiß gestrichene Platte (Pinax), die in den Inschriften aus Delos
Weit weniger eindeutig interpretierbar in den Inschriften als der Terminus Paradeigma ist der der Anagraphé. Das Grundproblem ist, dass das zugehörige griechische Verb sowohl ‚aufschreiben‘ bedeuten kann, wie etwa das Einmeißeln einer Inschrift in einen Stein, wie auch ‚auf etwas aufzeichnen‘, also die graphische Darstellung eines Objekts. Zweifelsfrei ist, dass Anagraphé in den Bauinschriften stets auf Anweisungen des Architekten an die Handwerker bezogen ist.
Das prägnanteste Beispiel ist die sog. ‚Prostoon‘-Inschrift.190 In ihr werden Aufträge vor allem für die verschiedenen Typen von Werksteinen aufgelistet (Stufenblöcke, Stylobatplatten, Metopen, Triglyphen, Geisa u. a.), jeweils getrennt in Aufträge für das Brechen der Steine, den Transport vom Steinbruch zum Heiligtum sowie für Ausarbeitung und Versatz der Bauglieder. Der Auftrag etwa für die Ausarbeitung und den Versatz der dorischen Geisa (Kraggesimse) lautet folgendermaßen:
„To make 47 Doric [Pentelic191] geisa according to the specification to be provided by the architect [πϱὸϛ τὸν ἀναγϱαφέα ὅν ἄν δῶι ὁ αϱχιτέκτων], length 6’, breadth 3’, thickness 1
’, including two corner geisa, and hoist them up an join them so that they fit closely everywhere, without damage – width of joint-fillets
‘ – and connect them with clamps and dowels in molten lead, and level off the upper face of the course.“192
Die Formulierung πρὸϛ τὸν ἀναγραφέα ὅν ἄν δῶι ὁ αρχιτέκτων wurde in der Inschrift nicht weniger als elf Mal verwendet.193 Sie kommt in ähnlicher Form häufig in Bauinschriften vor.194 Was sie inhaltlich bezeichnet, ist im Grundsatz klar, denn die explizit gegebenen Maßangaben definieren lediglich einen rechteckigen Quader von
 Fuß, nicht aber ein dorisches Geison. Entsprechend muss die Anagraphé die zusätzlich notwendigen, die Form bestimmenden Angaben zur Ausladung der Hängeplatte, zur Neigung der Oberseite und der Nagelplatten (Mutuli), Höhe der Tropfen (Guttae), Traufnase (Scotia) usw. enthalten haben. Unklar bleibt aber, in welcher Form diese Informationen nachgereicht werden sollten. Bundgaard, der sich ausführlich mit der Deutung des Begriffs Anagraphé beschäftigt hat, kam zu keinem eindeutigen Ergebnis,195 und schiebt entsprechend in die oben zitierte Übersetzung in Klammern als Alternative ein: „[…] according to the specifications (possibly: the diagram) to be provided by the architect.“ Anders Maier, der den Begriff in einer Mauerbau-Inschrift von 337/6 mit „Aufrisse“ bzw. „Baurisse“ übersetzt, und zwar gerade mit Referenz auf die Prostoon-Inschrift.196 Am wahrscheinlichsten ist m. E., dass ein Werkriss gemeint ist, der das Profil des Geisons darstellte, und von dem die Steinmetzen die einzelnen Maße mit dem Stechzirkel abgreifen konnten. Ein solches Profil brauchte jeder Steinmetz für die Weiterarbeit, nachdem die Seitenflächen des Quaders ausgearbeitet worden waren. Noch heute wird in jeder monographischen Darstellung eines griechischen Baus für das Geison eine Profilzeichnung
Fuß, nicht aber ein dorisches Geison. Entsprechend muss die Anagraphé die zusätzlich notwendigen, die Form bestimmenden Angaben zur Ausladung der Hängeplatte, zur Neigung der Oberseite und der Nagelplatten (Mutuli), Höhe der Tropfen (Guttae), Traufnase (Scotia) usw. enthalten haben. Unklar bleibt aber, in welcher Form diese Informationen nachgereicht werden sollten. Bundgaard, der sich ausführlich mit der Deutung des Begriffs Anagraphé beschäftigt hat, kam zu keinem eindeutigen Ergebnis,195 und schiebt entsprechend in die oben zitierte Übersetzung in Klammern als Alternative ein: „[…] according to the specifications (possibly: the diagram) to be provided by the architect.“ Anders Maier, der den Begriff in einer Mauerbau-Inschrift von 337/6 mit „Aufrisse“ bzw. „Baurisse“ übersetzt, und zwar gerade mit Referenz auf die Prostoon-Inschrift.196 Am wahrscheinlichsten ist m. E., dass ein Werkriss gemeint ist, der das Profil des Geisons darstellte, und von dem die Steinmetzen die einzelnen Maße mit dem Stechzirkel abgreifen konnten. Ein solches Profil brauchte jeder Steinmetz für die Weiterarbeit, nachdem die Seitenflächen des Quaders ausgearbeitet worden waren. Noch heute wird in jeder monographischen Darstellung eines griechischen Baus für das Geison eine Profilzeichnung
Für die hellenistische Zeit lässt sich belegen, dass Anagraphé nicht allein einen Werkriss bezeichnete, also eine Darstellung einer Form für den ausführenden Steinmetz, sondern auch eine Konstruktionszeichnung
2.4 Materialien
2.4.1 Holz
Im Steinbau hatte Holz als Baustoff eine quantitativ wie strukturell hohe Bedeutung. Verwendet wurde es in der Regel in etwa derselben Weise wie noch im Steinbau der frühen Neuzeit, nämlich für die Ausstattung der Bauten mit Türen, Fenstern und Treppen, und vor allem für Decken und Dachstühle. Nur wenn ein Bau hohe Ansprüche demonstrieren sollte, wurde das standardmäßig verwendete Holz durch Stein substituiert. Vor allem Tür- und Fensterlaibungen wurden in Stein gefertigt, seltener Kassettendecken. Am Tempel von Sangri auf Naxos
Noch höher war die Bedeutung des Holzes im Lehmziegelbau, also vor allem bei Wohnhäusern, und in der Frühzeit auch bei öffentlichen und sakralen Bauten. Es diente hier zusätzlich zur Aussteifung von Mauern (wie auch an Stadtmauern) und Wänden, und zum Schutz von Mauerzungen (Anten). Zudem waren an Lehmziegelbauten auch Stützen und Gebälke regelmäßig in Holz ausgeführt.
Des Weiteren wurde Holz auf den Baustellen für Werkzeuge201 und Meßzeuge sowie für Maschinen (Gerüste, seltener Kräne) benötigt. Auch brauchte man Holz für das Brennen der Dachziegel und das Schmelzen des Bleis für den Verguss von Eisenklammern. Holzkohle – selten reine Kohle202 – war beim Schmieden der Beschläge, Dübel, Klammern und Werkzeuge erforderlich.
Kaum bekannt sind hingegen reine Holzkonstruktionen.203 Sie werden aber bei Brücken vielfach üblich gewesen sein.204 Ansonsten lassen sich nur einige nur für temporäre Nutzung errichtete Bauten belegen, deren Holz also wiederverwendet werden konnte, wie das ältere Dionysos-Theater am Südabhang der Athener Akropolis.205 Die Gründe für das weitgehende Fehlen reiner Holzkonstruktionen liegen kaum in klimatisch bedingter hoher Brandgefahr – Lehmziegelbauten waren kaum weniger gefährdet –, sondern in den hohen Kosten für hochwertiges Bauholz. Nicht sicher bekannt sind zudem freitragende Holzkonstruktionen ganzer Gebäude (wie Fachwerkhäuser), obwohl die erforderlichen Kenntnisse und Techniken aus dem Schiffbau, und vor allem aus dem Gerüstbau bekannt gewesen sein müssen, denn mit Hilfe der Gerüste und Winden wurden Bauglieder von über 10 to Gewicht versetzt (s. Abb. 2. 15). Nicht nachweisbar verwendet wurde Holz für Fundamentierungen, denn man kennt keine Pfahlgründungen in sumpfigem Gelände, obwohl auf solchem Untergrund einige der größten Tempelbauten errichtet worden sind (Heratempel auf Samos
Holzarten und ihre Verwendung
Anforderungen hinsichtlich der Biege- und Druckfestigkeit stellten vor allem die Tragwerke der Dächer, die die Last der Ziegel und einer eventuell darunter liegenden Lehmschicht zu tragen hatten. Bei den Deckenbalken erforderte die freie Länge entsprechende Dimensionierungen. Die Beschränkung der freien Spannweiten der Decken auf kaum über 12 m dürfte darauf zurückzuführen sein. Bei Decken, auf die Estrich aufgebracht werden sollte (mehrgeschossige Stoen), durfte das Holz nicht zu sehr auf Temperaturschwankungen reagieren, um Rissbildungen im Estrich zu vermeiden. Insbesondere bei den großen Tempeltüren (Höhe bis über 10 m) war das Alterungsverhalten (Verzug) und die Resistenz gegen Fäulnis bei Feuchtigkeit bei der Auswahl, neben ästhetischen Aspekten wie Maserung, zu berücksichtigen. Dasselbe galt für Hölzer, die für Steinverbindungen als Dübel und Schwalbenschwanz-Klammern eingesetzt wurden.208
Das Fachwissen, das sich die Zimmerleute – sicher auch im Austausch mit den Schiffbauern – über die Eigenschaften der lieferbaren Hölzer erworben hatten, muss erheblich gewesen sein, und galt offenbar als so zuverlässig, dass sich wissenschaftliche Autoren wie Theophrast
| Baugruppe | Holzart | Ort/Bau |
|---|---|---|
| Säulen | Eichenholz | Heraion, Olympia |
| Stützten | Eichenholz | salle hypostyle, Délos |
| Dachstühle | Pinie | Klaros, Delos |
| Tanne | Epidauros, Delphi, Delos1 | |
| Zeder | Ephesos, Artemision | |
| Zypresse | Parthenon, Delphi (alkmaionidischer Apollontempel) | |
| Decken | Tanne | Delphi, Eleusis |
| Buchsbaum | Erechtheion | |
| Ulme | Delos, Apollontempel | |
| Zeder | Delos, Apollontempel | |
| Zypresse | Epidauros, Asklepiostempel | |
| Eiche | salle hypostyle, Delos | |
| Fenster | makedonischem Nadelholz | Eleusis |
| Empolia (erh.) | Zypresse | Erechtheion |
| Empolia (erh.) | Zypresse | Parthenon |
| Empolia (erh.) | Olivenholz(?) | Apollontempel auf Delos |
Tab. 2.1: Holzarten und ihre Verwendung.
1Balken von 18 Ellen (ca. 9 m) Länge [Pfette?], IG XI 2, 203 B, Z. 101.
Tab. 2.1: Holzarten und ihre Verwendung.
1Balken von 18 Ellen (ca. 9 m) Länge [Pfette?], IG XI 2, 203 B, Z. 101.
Herkunft, Einschlag, Verarbeitung
Die wichtigsten Liefergebiete für Bauhölzer
Über den Einschlag ist hinsichtlich der Werkzeuge und der Transporttechniken innerhalb der Waldgebiete wenig bekannt. Sehr wahrscheinlich wurde mit Äxten gefällt und die Stämme mit Ochsen zunächst bis zu Verladeplätzen geschleift, die an Wegen oder Flüssen lagen.213 Die Kenntnisse, die der ‚Qualitätssicherung‘ dienten, sollen sogar in Fachschriften niedergelegt worden sein.214 Geschlagen werden sollten Bäume mittleren Alters, der Einschlag in den trockneren Jahreszeiten durchgeführt werden. Laubholz, dessen Rinde am Ort entfernt werden sollte, um das Holz
Holztechnik
Die Art der Holzverbindungen lässt sich nur selten direkt nachweisen,218 doch dürften Verzapfungen und Verdübelungen (auch für die Anbringung von Zierleisten belegt219), wie sie in Rom
Die Verwendung von Nägeln scheint hingegen keine übliche Form der Verbindung gewesen zu sein, denn andernfalls hätte Philon
Zur Verarbeitung zählen schließlich auch die Konservierungstechniken, die das Holz vor Fäulnis und Schädlingen schützen sollten. Bekannt ist, dass die Bemalung (Enkaustik), wenn auch in erster Linie als Ornamentierung gesehen, als Schutzschicht diente, ebenso wie – bei nicht einsehbaren Baugliedern – die aus dem Schiffbau bekannte Beschichtung mit Pech.224 Theophrast
Transportkosten, Preise und politische Bedeutung des Holzexportes
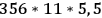 cm nicht weniger als 23 Tageslöhnen eines qualifizierten Arbeiters.227 Dieser Preis war der Lieferpreis vor Ort, enthielt also bereits die Transportkosten. Ulmenholz hatte gemäß derselben Urkunde immerhin noch ein Viertel des Wertes von Zedernholz228, und war damit, auf das Volumen bezogen, immer noch deutlich teurer als hochwertiger Stein.229 Vermutlich deshalb wurden Häuser auch ohne die Türen und Fenster verkauft.230 Handelte es sich hingegen um geringwertige Hölzer, übertrafen häufig die Transportkosten die Materialkosten.231
cm nicht weniger als 23 Tageslöhnen eines qualifizierten Arbeiters.227 Dieser Preis war der Lieferpreis vor Ort, enthielt also bereits die Transportkosten. Ulmenholz hatte gemäß derselben Urkunde immerhin noch ein Viertel des Wertes von Zedernholz228, und war damit, auf das Volumen bezogen, immer noch deutlich teurer als hochwertiger Stein.229 Vermutlich deshalb wurden Häuser auch ohne die Türen und Fenster verkauft.230 Handelte es sich hingegen um geringwertige Hölzer, übertrafen häufig die Transportkosten die Materialkosten.231
Die Preise für hochwertige Hölzer hatte eine politische Komponente, da auf den Export hochwertiger Hölzer Ausfuhrzölle erhoben wurden (bekannt als Monopol des Königs in Makedonien
2.4.2 Stein
Gesteinsarten
Über Gesteine und ihre Eigenschaften existierte in der griechischen Antike eine Fachliteratur. Schon die ionischen Naturphilosophen hatten sich mit Gesteinen beschäftigt. Von den antiken ‚Steinbüchern‘ erhalten ist eine Schrift von Theophrast
Die für den Monumentalbau wichtigsten Gesteinsarten sind verschiedene Sedimentgesteine, vor allem die harten, grauen Kalksteine und verschiedene Kalksandsteine sowie der Marmor. Der in den Quellen häufig genannte ‚Poros‘ ist geologisch nicht eindeutig bestimmbar, sondern bezeichnete verschiedene Kalksteine, Muschelkalke und Tuffe. Magmatische Gesteine wie Granite, Basalte und Andesite wurden vergleichsweise selten verwendet, und häufig nur in nicht oder kaum sichtbaren Bereichen wie Fundamenten.
Gesteine, die anfällig für Erosion waren, wurden auf den Außenflächen mit einem – meist sehr feinen und dünn aufgebrachten – Kalkputz überzogen, in den Marmormehl eingerührt sein konnte. Solche Putze waren zudem erforderlich, um bestimmte Bauteile mit Farbe zu überziehen.
Die Verwendung der Gesteinsarten richtete sich zwar prinzipiell nach deren natürlichen Eigenschaften, ist jedoch nicht im engen Sinne funktional differenziert. So findet man nur sehr selten Bauten, an denen die statisch kritischen Tragbalken über den Säulen aus anderem Material gefertigt sind als die darüber liegenden Teile des Gebälks (Fries und Gesims), die allein auf Druck belastet werden. Wenn innerhalb des Oberbaus verschiedene Gesteine verwendet wurden, dann meist wegen der Farbigkeit, etwa für Fußböden, oder weil nur bestimmte Gesteine – vor allem Marmor – geeignet waren für bildhauerischen Bauschmuck (Ornamente und Bildreliefs).
Steingewinnung
Steinbrüche wurden schon in mykenischer Zeit betrieben, das erforderliche technische Wissen war also lange vor der hier behandelten Epoche bekannt. Zur Gewinnung von Baumaterial wurden Steinbrüche in nachmykenischer Zeit aber erst seit dem Beginn des Monumentalbaus genutzt, also ab dem späten 7. Jahrhundert.
Normalerweise wurde das Gestein oberirdisch abgebaut. Es gab jedoch auch unterirdische Vorkommen, die abgebaut wurden, wie etwa in Syrakus
Im Steinbruch wurden zunächst die obersten, erodierten Schichten entfernt, deren Material für das Bauen ungeeignet war. Der eigentliche Abbau erfolgte durch Zerspanen und Absprengen.234 Dabei wurde die Schichtung des Gesteins im Steinbruch auf die spätere Einbaulage der Blöcke am Bau bezogen, so dass die horizontalen Schichten im Gestein auch am Bau horizontal erscheinen. Das bedeutete praktisch, dass Wandquader gleichsam liegend, Säulentrommeln hingegen stehend aus dem anstehenden Gestein herausgebrochen wurden.235 Der Gedanke, der dahinter stand, war offensichtlich der, dass vertikal verlaufende Gesteinsschichten in den Baugliedern unter Druck wie Sollbruchstellen gewirkt hätten. In Kauf nehmen musste man zur Vermeidung dieses Problems, dass bei vertikalen Baugliedern wie Säulentrommeln oder Türgewänden sehr tiefe Schrotgräben angelegt werden mussten. Daher kennt man auch Architrave, bei denen die Schichtung am Bau nicht in derselben Ebene liegt wie im Steinbruch, d. h. die Architrave wurden genauso wie Platten aus dem anstehenden Gestein herausgesprengt, und am Bau gleichsam um 90° gekippt.
Für das Brechen der Blöcke wurden zusätzlich zur Oberfläche zunächst ein bis drei Seiten des Steins freigelegt, indem Schrotgräben (bis ca. 60 cm Breite) mit der Hacke oder mit Hammer und Meißel angelegt wurden. Wo möglich, wurden die Schrotgräben dort angelegt, wo härtere und weichere Schichten im Gestein aufeinandertrafen. Zum Absprengen des Unterlagers und der eventuell noch nicht freigelegten Seitenflächen wurden Keile aus Holz oder Metall zum Spalten des Steins verwendet. Holzkeile wurden nach dem Einsetzen in passgenaue Ausarbeitungen gewässert, so dass sie durch das Aufquellen den Stein absprengten. Metallkeile wurden in Reihe eingetrieben, wobei der für das eigentliche Absprengen entscheidende Schlag auf die Keile von allen Arbeitern exakt gleichzeitig ausgeführt werden musste.236 Nicht immer wurde allein die Unterseite abgesprengt, es konnten gleichzeitig auch Seitenflächen abgesprengt werden, was handwerklich anspruchsvoller war, aber effektiver war.
Die abgesprengten Blöcke wurden in der Regel bereits im Steinbruch auf annähernd ihre endgültige Form abgearbeitet. Auf diese Weise war die endgültige Form von einem dünnen Werkzoll eingehüllt, d. h. in Bosse belassen. Das diente dem Schutz der späteren Sicht- und Lagerflächen beim Abtransport aus dem Steinbruch. Die Ausarbeitung der annähernd endgültigen Form bereits im Steinbruch hatte weitere Vorteile. Zum einen war das bruchfeuchte Material leichter, und damit schneller zu bearbeiten. Zum anderen konnte dadurch das Transportgewicht reduziert werden. Der Werkzoll konnte so gering ausfallen, dass an den Trommeln für eine Säule die vorgesehene Entasis
Der Steinsplitt, der beim Anlegen der Schrotgräben anfiel, wurde meist beim Steinbruch gelagert. Große Mengen von solchem Splitt sind heute ein Merkmal, anhand dessen aufgelassene Steinbrüche identifiziert werden können. Um Fundamentgräben von Neubauten aufzufüllen, war der Splitt aus den Steinbrüchen nicht erforderlich, da beim Abarbeiten des Werkzolls auf dem Bauplatz genügend Splitt anfiel. Bei geeignetem Material – Kalkstein oder Marmor – konnte der Splitt auch zum Kalkbrennen verwendet werden.
2.4.3 Lehm, Ton und weitere Materialien
Das unter den angesprochenen Materialien für das Bauwesen quantitativ mit Abstand wichtigste war Lehm. In Form von luftgetrockneten Ziegeln oder als Stampflehm war Lehm das Standard-Baumaterial für Wohn- und Nutzbauten.238 Auch Stadtmauern wurden in klassischer Zeit, und auch später noch, aus Lehmziegeln gebaut (Plataiai, Mantineia). Obwohl preiswert und leicht zu verarbeiten, in diesem Sinne also ‚billig‘, wurden auch nach dem Aufkommen der Werksteintechnik vereinzelt noch Sakralbauten oder anspruchsvolle öffentliche Gebäude mit Lehmziegelwänden errichtet. Zu ersteren gehört der Despoinatempel in Lykosura
Über die Technik des Lehmziegelbaus lassen sich jedoch nur sehr wenig präzise Aussagen machen, da praktisch keine Baureste erhalten sind, falls die Lehmmauern nicht bei einem Feuer (‚sekundär‘) gebrannt, und so erhalten geblieben sind. Lehm hat als Baumaterial verschiedene vorteilhafte Eigenschaften. Leicht zugängliche Vorkommen gab es außer in felsigen Gebieten fast überall. Lehm wirkt stark feuchtigkeitsregulierend, denn Lehm resorbiert die Luftfeuchtigkeit sehr schnell, und gibt bei Trockenheit die aufgenommene Feuchtigkeit auch sehr schnell wieder ab. Zudem wirkt Lehm, vor allem, wenn er mit pflanzlichen Stoffen gemagert wird, als effizienter Dämmstoff. Schließlich ist Lehm bei Zerstörungen in einfachster Weise wiederverwendbar. Eine eingestürzte Mauer etwa lässt sich problemlos wieder aufbauen, wenn der Lehm gewässert und wieder in Formen verstrichen worden ist. Nachteil des Lehms ist, dass er bei Schlagregen oder konstanter Bodenfeuchtigkeit zerfließt, so dass entsprechende Schutzmaßnahmen wie Sockelzonen aus Stein und große Dachüberstände erforderlich sind. Das Bestreichen der Wandaußenflächen mit Kalkmilch oder Kalkputz bietet ebenfalls wirksamen Schutz. Alle genannten Maßnahmen haben die Griechen praktiziert. Insbesondere die Steinsockel von Lehmziegelbauten haben sich häufig erhalten. Bei Wohn- oder Nutzbauten sind diese Sockel zumeist aus Bruch- oder Lesestein zusammengefügt. Bei sakralen oder öffentlichen Bauten wie den oben angeführten Gebäuden wurden die Sockelzonen der Lehmziegelwände aus großen, sorgfältig bearbeiteten und in dichtem Fugenschluss versetzten Steinplatten (Orthostaten) errichtet, also in Werksteintechnik.
Für die Mauern selbst wurde der Lehm zunächst mit Wasser angemacht und aufbereitet. Sog. fetter Lehm mit hohem Tongehalt wurde mit Sand gemagert, damit beim Trocken, bei dem die Ziegel wegen der Abgabe des Wassers schrumpfen, möglichst wenig Risse auftraten. Demselben Zweck diente auch die Beimengung von pflanzlichen Stoffen, vor allem Stroh, das zudem, wie angesprochen, die Dämmeigenschaften verbessert. Der aufbereitete Lehm wurde anschließend mit Hilfe von Holzrahmen geformt und an der Luft zur Vermeidung von Rissen langsam, also wohl eher im Schatten und nicht im Hochsommer, getrocknet. Verlegt wurden die Ziegel in ähnlichen Mustern wie später die Backsteine. Die Fugen wurden mit wässrigem Lehm verstrichen. Nicht zu klären ist, in welchem Umfang die Griechen die als Pisé bekannte Bauweise praktizierten, bei der der sog. Stampflehm schichtweise zwischen Bretterschalen eingebracht und durch Stampfen verdichtet wird. In der Regel verbleibt von einer Lehmziegel- oder Stampflehmmauer nach Auflassen des Gebäudes nur eine formlose Lehmschicht auf Höhe des Steinsockels. Die wenigen durch Brand erhaltenen Reste von Mauern aus Lehm waren aus Lehmziegeln errichtet, so dass man zumindest vermuten kann, dass Pisé seltener war als Lehmziegel. Zudem waren die für Pisé erforderlichen Schalbretter sicher teurer als die relativ kleinen Holzformen der Lehmziegel.
Gebrannter Ton, oder meist eher stark tonhaltiger Lehm, der in speziellen Öfen gebrannt wurde, ist in der griechischen Architektur vor allem für Dachziegel verwendet worden. Hinzukommen am Dach die Traufrinnen (Simen), kleine Palmetten über deren Fugen (Antefixe) und Schmuckapplikationen an Ecken und Firsten (Akrotere, teils floral, teils figürlich), sowie an westgriechischen Dächern Verkleidungsplatten für die vorkragenden Teile des Gebälks, die ursprünglich die Holzgebälke gegen Feuchtigkeit schützten.
Fast keine Rolle spielen in der griechischen Architektur hingegen gebrannte Ziegel bzw. Backstein. In seiner üblichen Form und als primäres Baumaterial kommt er in Griechenland
Die Dachziegel aus gebranntem Ton gelten als griechische Erfindung des frühen 7. Jahrhunderts.239 Im alten Orient und im pharaonischen Ägypten
Die Herstellungstechnik für die verschiedenen Elemente der Dachhaut war auch vor der Einführung des Dachziegels lange bekannt, denn sie war dieselbe wie für die Gefäßkeramik. Auch gab es bereits lange vorher hinreichende Erfahrungen mit dem Brand großer Bauteile, wie die älteren Großgefäße belegen, die zur Aufbewahrung von Getreide und Öl in den Boden eingelassen wurden (sog. Pithoi). Dachziegel wurden aus grob gemagertem Ton hergestellt. Ziegel für besonders aufwändige Bauten wurden vor dem Brand zusätzlich durch Tauchen mit einer dünnen Schicht fein geschlämmten Tons überzogen. Für die Formgebung wurden schon in spätarchaischer Zeit Modeln verwendet, die einheitlichere Ziegelserien ermöglichten als bei den älteren, handgestrichenen Ziegeln.
Die meisten griechischen Dächer haben jeweils zwei Hauptformen von Ziegeln: einen Flachziegel, der den größten Teil der Eindeckung bildet, und einen Deckziegel, der die Fugen zwischen den Flachziegeln überdeckt. Hinzukommen kommen noch besondere Formen für den First und den Dachrand. Man unterscheidet nach der Grundform der Ziegel zwei Haupttypen von Dächern. Beim korinthischen Dach sind die Flachziegel gerade Platten mit leicht aufgewölbten seitlichen Rändern. Die Deckziegel über den Fugen sind im Querschnitt dreieckig in der Art eines Giebels. Beim lakonischen Dach sind die Flachziegel leicht konkav, die Deckziegel stark konvex geformt. Bei Dächern mit gekrümmten Flachziegeln wurden die Ziegel im Lehmbett verlegt, das auf die Holzschalung über dem Tragwerk aufgebracht wurde.240 Bei korinthischen Dächern mit geraden Flachziegeln, die durch Falze untereinander und mit den Deckziegeln verbunden waren, hätte das Lehmbett und die Schalung entfallen können, so dass eine einfache Lattung ausgereicht hätte wie bei modernen Ziegeldächern.
Ziegelformate und -formen wurden häufig speziell für die jeweiligen Bauten hergestellt, und waren somit Teil des Bauentwurfs. Der Bedarf an großen Mengen von Dachziegel hat aber gleichwohl – anders als im Werksteinbau – auch zur Standardisierung der Maße und Formen geführt. Zur Kontrolle der Form und Abmessungen, der sog. ‚tile standards‘, gab es Prüfplatten aus Stein, ähnlich Messtischen für Hohl- und Längenmaße. Die Ziegel konnten dort durch Einlegen mit den Vorgaben abgeglichen werden.241
Eisen und Bronze wurde nicht nur zur Herstellung von Werkzeugen, sondern auch am Bau selbst verwendet, um Werksteine horizontal mit Klammern und vertikal mit Dübeln zu verbinden (zu den Formen s. Abschnitt 2.6 zu Bautechniken). Die schon im Zusammenhang mit den Paradeigmata angesprochenen Bronzedübel, die für die Vorhalle des Telesterion von Eleusis
Weitere Materialien, die im Bauwesen verwendet wurden, waren Farbstoffe. Farbig abgesetzt wurden bestimmte Komponenten der Gebälkornamentik. So wurden bei Bauten dorischer Ordnung die Triglyphen meist blau, die Architravtänien rot angestrichen. Man kann das mehr als nur in Resten heute noch an den makedonischen Kammergräbern in Verghina sehen. Bemalt wurden zudem plastisch ausgearbeitete Ornamentbänder (Kymatien), die gelegentlich auch nur auf Profile aufgemalt wurden. In der dabei angewandten Technik wurden die Farbpigmente durch Bienenwachs, eventuell versetzt mit Öl, gebunden. Aufgetragen wurden die Farben heiß, entweder nach Erhitzen über Kohlebecken, oder mit heißen Spachteln. Daher wird diese Technik als Enkaustik bezeichnet, was im Griechischen wörtlich ‚Eingebranntes‘ bezeichnet. Viele der Farbstoffe wurden importiert, z. B. aus Ägypten
Zu nennen wäre schließlich noch eine Vielzahl anderer Materialien, zu denen beispielsweise Hanf für Seile, Weidenruten für Körbe – die Griechen kannten für den Transport von Sand, Erde usw. keine Schubkarren – und einige andere gehören. Fensterglas war nicht bekannt, obwohl Glas in hellenistischer Zeit als Material für kleinere Gefäße nicht selten ist.
2.5 Logistik
Weiter verkompliziert und gesteigert wurden die Ansprüche an die Logistik häufig durch die Lage der Bauplätze und der Steinbrüche. Selbstverständlich wurde bei Heiligtümern, die auf einem Stadtberg (Akropolis) oder in einem Berghang gelegen waren, die anstehenden Gesteine – falls geeignet – zum Bauen genutzt, womit sehr viel Arbeit eingespart werden konnte, da das Steinmaterial für das Einebnen von Bergkuppen oder die Anlage von Terrassen direkt weiterverarbeitet werden konnte. War hingegen kein geeignetes Steinmaterial am Bauplatz vorhanden, oder sollte in Marmor gebaut werden, mussten nicht nur weitere Transportwege bewältigt werden, sondern auch starke Steigungen. Die Blöcke mussten also zunächst aus den oft in den Bergen gelegenen Steinbrüchen abgelassen, abtransportiert, und anschließend gegebenenfalls auf eine Akropolis hinaufgebracht werden. So wurde der Marmor für die perikleischen Bauten in Athen
2.5.1 Steintransport
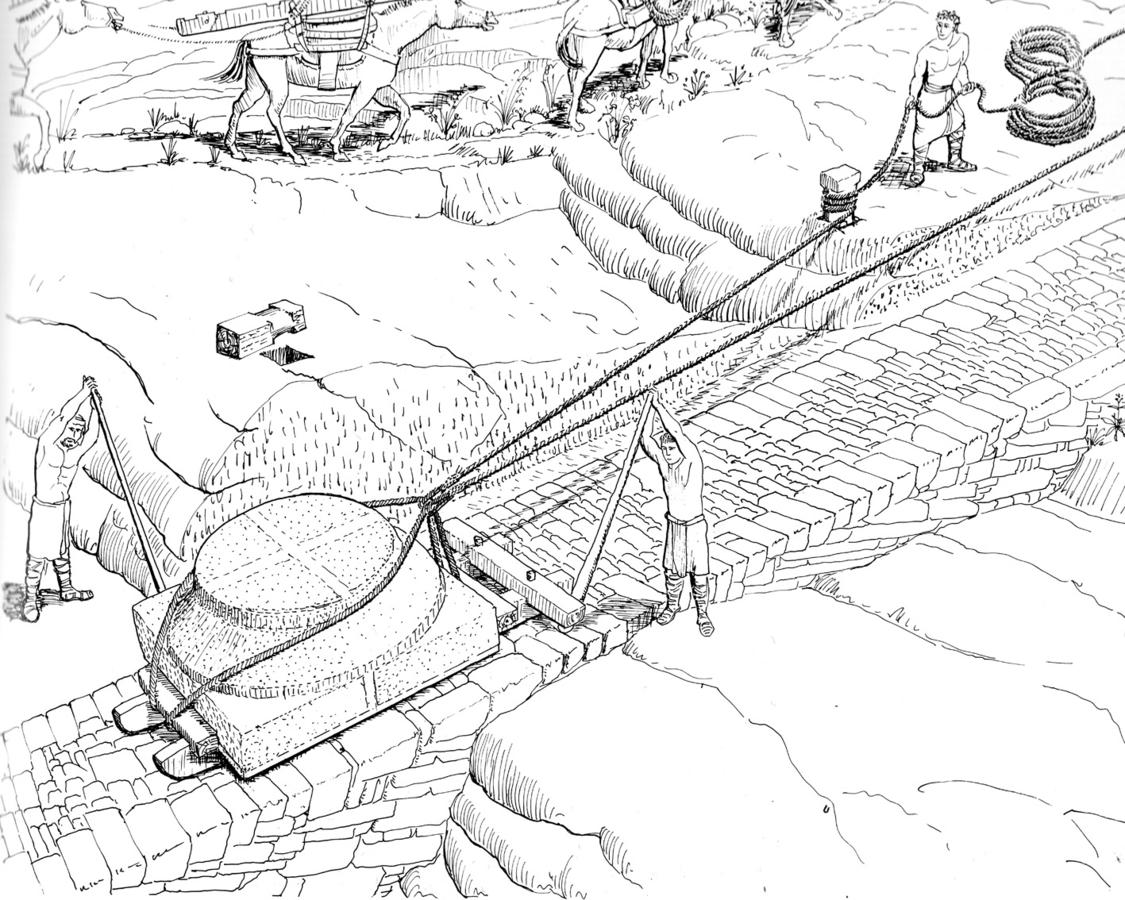
Abb. 2.9: Ablassen eines Kapitells aus dem Steinbruch mit einem Schlitten über eine Rampe (Korres and Vierneisel 1992, Nr. 13).
Für das Ablassen der Blöcke aus hochgelegenen Steinbrüchen waren Wagen häufig ungeeignet, weil sie wegen des Gewichts der Ladung auf relativ steilen Rampen nicht ausreichend hätten gebremst werden können. Man verwendete daher Schlitten, die durch die im Vergleich zu Wagenrädern weit höhere Friktion der Kufen wesentlich besser für Gefällestrecken geeignet waren. In manchen Steinbrüchen haben sich die Riefen erhalten, die bei der Verwendung von Schlitten durch den Abrieb der Kufen entstanden sind. Zusätzlich gebremst wurden die Schlitten durch Seile, die über Widerlager liefen (Abb. 2.9).
Bei Straßentransporten wurden gelegentlich von Pferden gezogene Wagen benutzt. Eine antike Quelle erwähnt einen von vier Pferden gezogenen Wagen für Kyrene
Über die Technik der schweren Wagen ist so gut wie nichts bekannt. Auch gibt es keine entsprechenden Reliefdarstellungen. Konkret lässt sich nur angeben, dass Diodor
Praktisch keine detaillierten Informationen finden sich in den Quellen über die Schiffstransporte. Entsprechend ist auch nicht bekannt, welche Schiffstypen eingesetzt wurden, bzw. ob es – wie in römischer Zeit252 – spezielle Steintransporter gegeben hat. Einige Inschriften erwähnten lediglich das Entladen von Steintransportern in den Häfen, die für Transporte in die Heiligtümer von Epidauros
2.5.2 Bewegen schwerer Bauglieder
Nicht alle Bauglieder können auf Wagen verladen worden sein, wie sich schon daraus ergibt, dass die oben erwähnten Maximalgewichte einzelner Bauglieder die Zuladung selbst moderner Lastkraftwagen übersteigen würden. Bekannt sind mehrere Transporttechniken für Bauteile, die nicht auf Wagen oder Schlitten verladen werden konnten. Eine sehr alte solche Technik, die aus dem Alten Orient durch bildliche Darstellungen bekannt ist,255 ist das Bewegen schwerster Lasten mit Rollhölzern, die quer zur Transportrichtung in dichter Folge hintereinander gelegt wurden. Um den zu bewegenden Block auf die Hölzer zu heben, dürften einfache Stemmeisen genügt haben, die an der Seite der Transportrichtung angesetzt wurden, um die Hölzer unterzulegen. Beim Ziehen der Blöcke mit Seilen bzw. Schieben von der Rückseite kommt das jeweils hinterste Holz frei, das dann von Helfern nach vorne gebracht wird, und durch die weitere Vorwärtsbewegung unter den Block gerät. Notwendig für diese Form des Bewegens schwerer Lasten ist vor allem ein sehr fester Untergrund, da ein Einsacken der Hölzer in den Boden ein weiteres Bewegen der Last verhindert. Denkbar ist, dass aus diesem Grund starke Bretter als Laufbahn für die Rollhölzer verlegt wurden, die ähnlich wie die Rollen jeweils von hinten nach vorne umgesetzt wurden. Mit dieser Methode kann selbst ein einzelner Mann mit einfachsten Mitteln – Rundhölzern und Stemmeisen – einen Stein von 0,5 to über kurze Strecken bewegen.256 Rollhölzer werden mehrfach in Inschriften erwähnt, z. B. für das Bewegen von Steinen im Hafen des Heiligtums von Epidauros
Andere Techniken, überschwere Bauglieder zu bewegen, waren erheblich aufwändiger, zugleich aber auch effizienter als das sehr zeitaufwändige Verschieben von Blöcken über Rollhölzer. Beschrieben sind solche Verfahrensweisen bei Vitruv
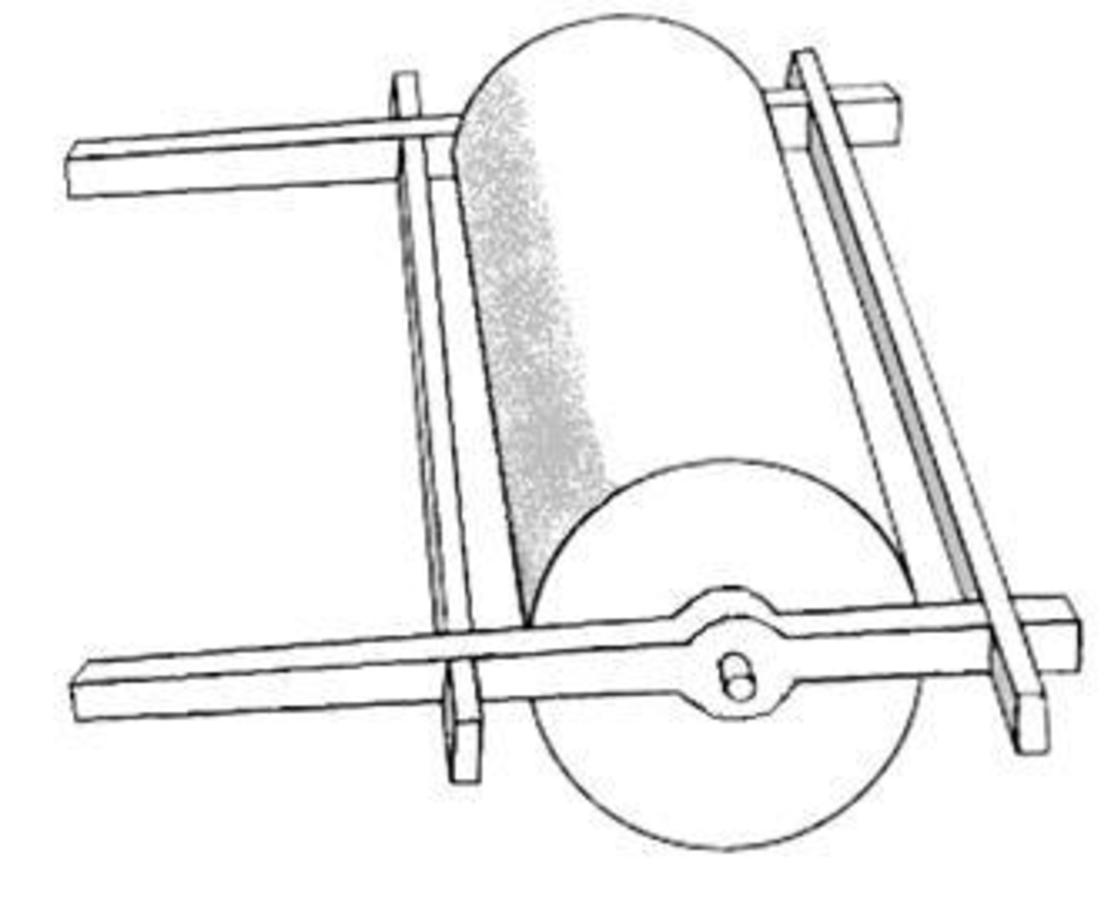
Abb. 2.10: Vorrichtung zum Transport von Säulenschäften.
Eine Methode war, Säulentrommeln oder -schäfte zu bewegen, indem sie von einem Holzrahmen eingefaßt wurden, an den die Zugtiere angeschirrt wurden. Die Trommel oder der Schaft selbst wurde dabei bewegt wie eine Walze (Prinzipskizze dazu Abb. 2.10). Das hatte gegenüber dem Wagentransport den Vorteil, dass die Fläche, mit der die Säulentrommel auf dem Boden auflag, wesentlich größer war als die von Rädern, wodurch das Problem umgangen wurde, dass die Räder bei weichem Untergrund und hoher Transportlast in den Boden einsackten.
Vitruv
Mit dieser Methode ließen sich allerdings nur zylindrische Bauglieder – Säulenschäfte und Trommeln – bewegen, die sich rollen lassen. Für schwere quaderförmige Bauglieder wie Architrave ist bei Vitruv
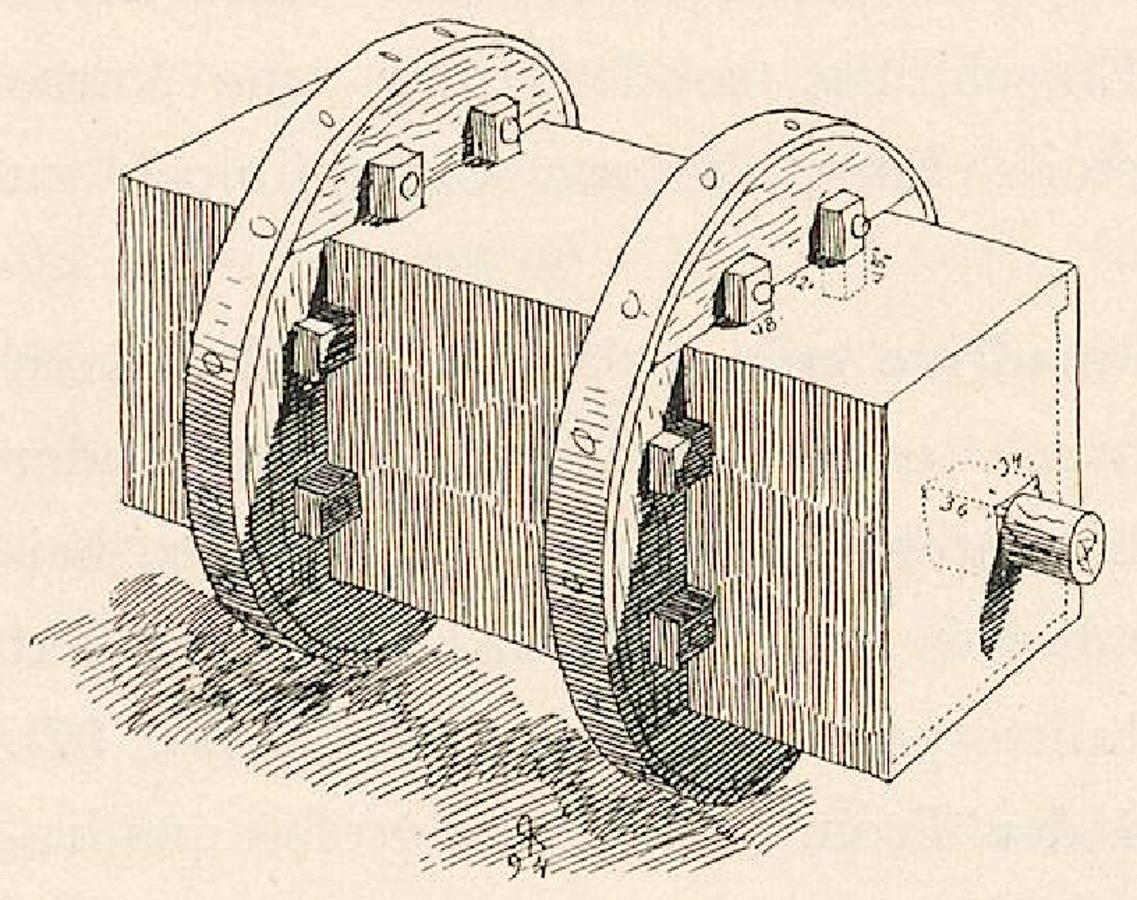
Abb. 2.11: Vorrichtung zum Rollen von Quadern (Koldewey and Puchstein 1899, Abb. 98).
Die angesprochenen Beschreibungen von Vitruv
2.5.3 Hebetechniken
Eine mögliche Antwort hat der oben schon erwähnte Architekt des ephesischen Artemisions, Chersiphron
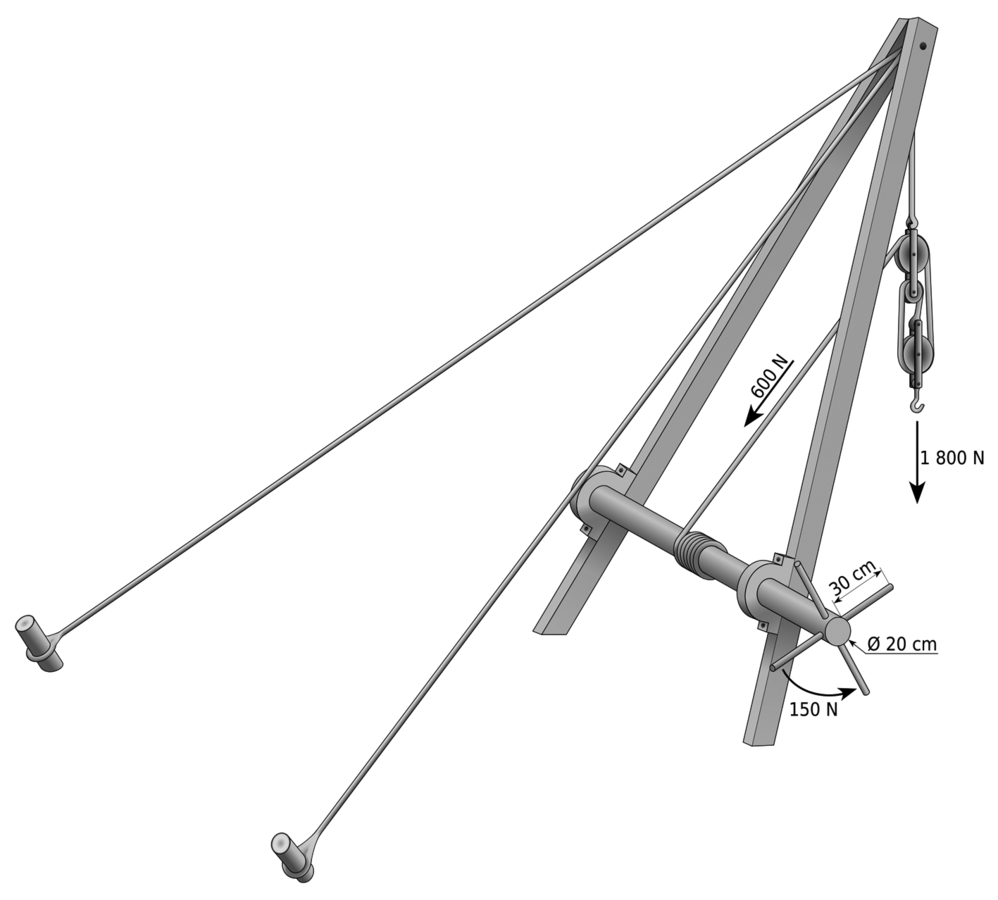
Abb. 2.12: Kran, Typ Trispastos (Wikipedia, Eric Gaba, modifiziert nach Dienel and Meighörner 1997, 12f.).
Kräne, die mit Flaschenzügen bestückt waren, sind aus den älteren Mittelmeerkulturen nicht bekannt. Insofern dürfte es sich um eine griechische Erfindung handeln. Dem würde entsprechen, dass Vitruv
Die Technik der griechischen Kräne ist nur schlecht rekonstruierbar, da die entsprechenden Schriftquellen aus der Kaiserzeit stammen, und keine bildliche Darstellung erhalten ist. Vitruv
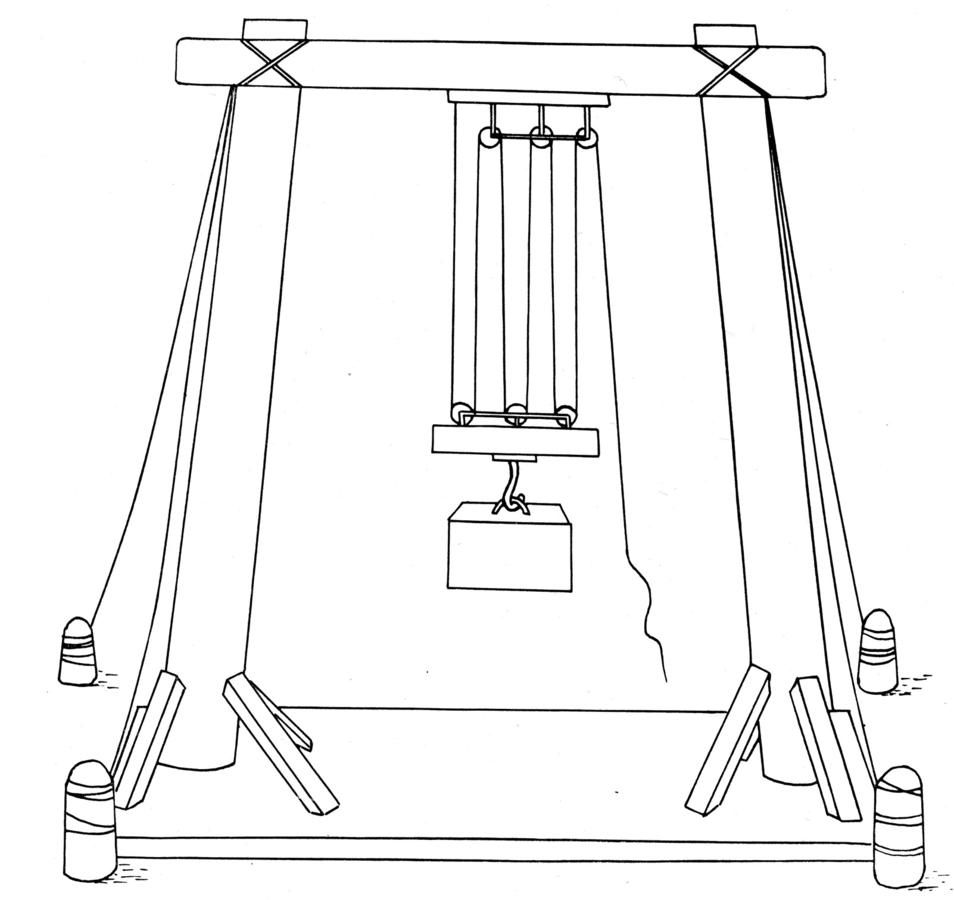
Abb. 2.13: Kran, Typ Dikolos (Nix and Schmidt 1900, Abb. 45).
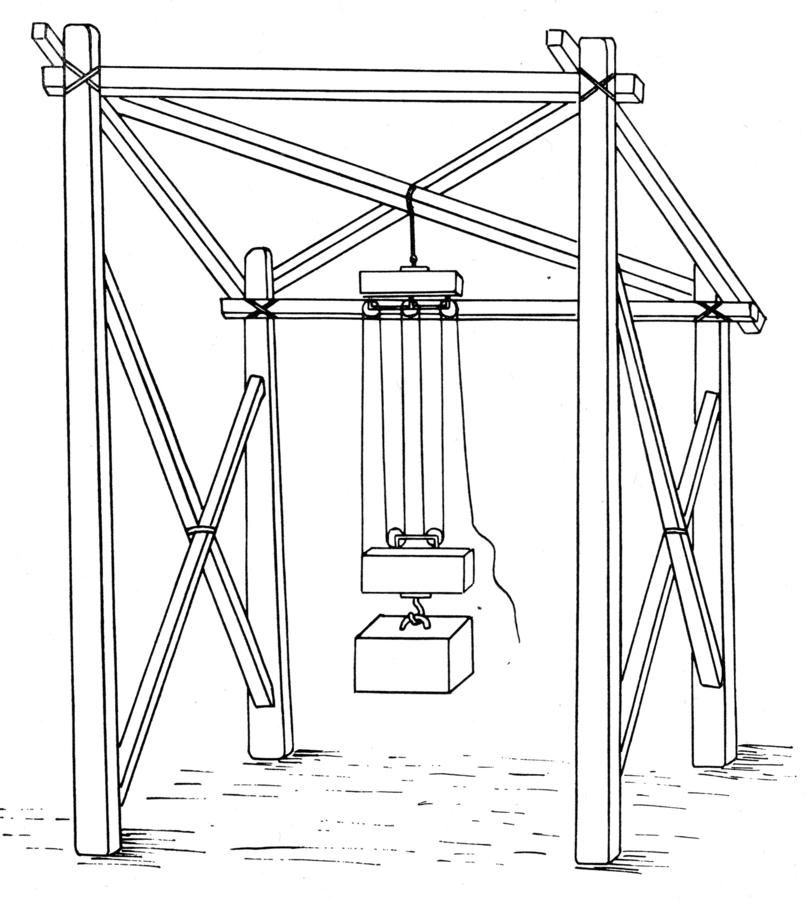
Abb. 2.14: Kran, Typ Tetrakolos (Nix and Schmidt 1900, Abb. 50).
Der Trispastos und das Pentapaston sind identische Konstruktionen, die sich nur durch die Zahl der Umlenkrollen des Flaschenzuges (drei bzw. fünf) unterscheiden. Der Ausleger besteht jeweils aus zwei an der Spitze verbundenen Holzbalken, die ein umgekehrtes V bilden (Abb. 2.12). Ihre geneigte Position wird durch im Boden verankerte Spannseile fixiert. Die Winde ist als Querstrebe zu den V-Trägern angeordnet, und wird durch Speichen per Hand gedreht. Mit einem Kran dieses Typs lassen sich Lasten durch Betätigen der Winde nur in vertikaler Richtung bewegen, was ideal ist etwa für das Beladen eines Wagens, nicht aber für die am Bau erforderlichen Bewegungen. Ein vor den Säulen liegender Architrav muss beim Aufsetzen auf die Kapitelle zusätzlich horizontal, also quer zur Basis des Krans, bewegt werden. Zwei Möglichkeiten sind in dieser Hinsicht denkbar. Zum einen könnte die Horizontalbewegung dadurch erfolgt sein, dass die Spannseile, die die V-Träger halten, entsprechend abgelassen wurden, was allerdings sehr genau kontrolliert erfolgen müsste. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass bei entsprechend großer Höhe die Last mit relativ wenig Kraft in gewissem Umfang seitlich bewegt werden kann (je besser, desto weiter die Spitze des Krans von der am Seil hängenden Last entfernt ist).
Vitruv
Zwei weitere Konstruktionen werden in einer Inschrift aus hellenistischer Zeit erwähnt. Die Inschrift gehört zu den Rechenschaftsberichten für den Bau des jüngeren Apollontempels in Didyma
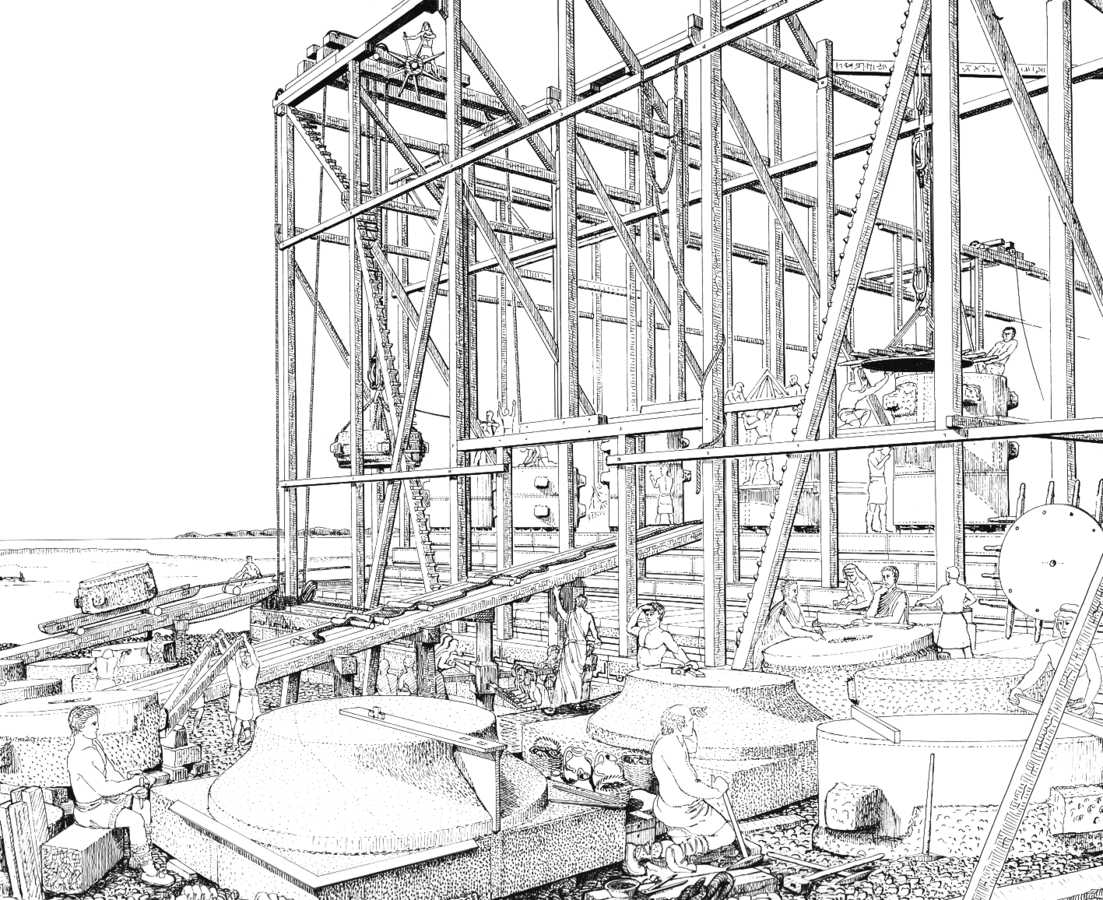
Abb. 2.15: Baugerüst Vorparthenon (Korres and Vierneisel 1992, Nr. 19).
Es spricht viel dafür, dass nicht immer Bauglieder mit Hilfe eines Krans versetzt worden sind. Für das Aufrichten von Säulen wäre in technischer Hinsicht eine Einrüstung der Peristase wesentlich zweckmäßiger gewesen, da mit Hilfe einer Laufkatze auf der Oberseite des Gerüstes die Trommeln und Kapitelle nicht nur gehoben, sondern auch seitlich in ihre endgültige Position versetzt werden konnten. Manolis Korres
Wesentlich besser dokumentierbar ist die Aufhängung der Bauglieder an den Hebeseilen (Abb. 2.16). Allen Formen der Aufhängung ist zunächst gemein, dass der Aufhängungspunkt immer im Schwerpunkt des Werkstücks liegen musste, oder aber symmetrisch um den Schwerpunkt als Zentrum. Im Grundsatz lassen sich vier Formen der Aufhängung unterscheiden. Zunächst die – arbeitsaufwändigen – Seilkanäle, die stets in Flächen eingetieft wurden, die nach der Fertigstellung nicht mehr sichtbar waren (auf Abb. 2.16 Nr. 1–5). Sodann wurden Werkstücke über Hebebossen270 in Seilschlaufen aufgehängt (Nr. 6 und 7 für Säulentrommeln und Wandquader). Diese Bossen wurden nach Versatz der Bauglieder abgearbeitet, so dass sie heute in der Regel nur an unfertigen Werkstücken noch sichtbar sind. Die Verwendung von Steinzangen ist an den charakteristisch ausgebildeten Einarbeitungen für die Spitzen der Zangen erkennbar (Nr. 10). Schließlich wurde, vor allem für den Versatz von Schlusssteinen, häufig der dreiteilige Wolf benutzt (Nr. 9). Seine Nutzung ist ebenfalls an den typischen Einlassungen mit nach innen aufgeweiteten Schmalseiten erkennbar, in denen die drei Elemente des Wolfs verkeilt wurden. Häufig war in der griechischen Architektur auch nur eine dieser Schmalseiten abgeschrägt, was für das Verkeilen in hartem Gestein ausreicht. Ein Wolf aus griechischer Zeit ist m. W. bisher noch nicht gefunden worden, doch besteht aufgrund der charakteristisch ausgeformten Einarbeitungen am Einsatz des Wolfs kein Zweifel.
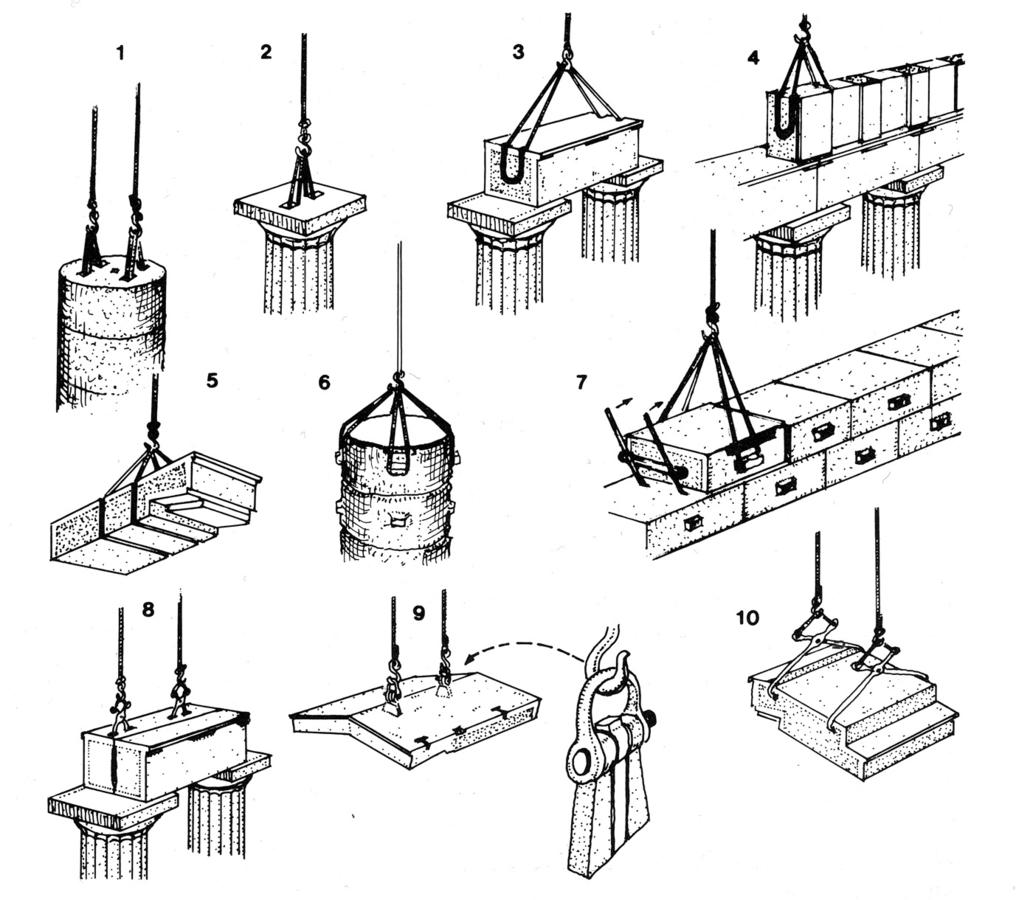
Abb. 2.16: Vorrichtungen zum Befestigen von Hebeseilen (Orlandos 1966, Abb. 119).
2.6 Bautechniken und Ingenieurbau
2.6.1 Werkzeuge und Messzeuge
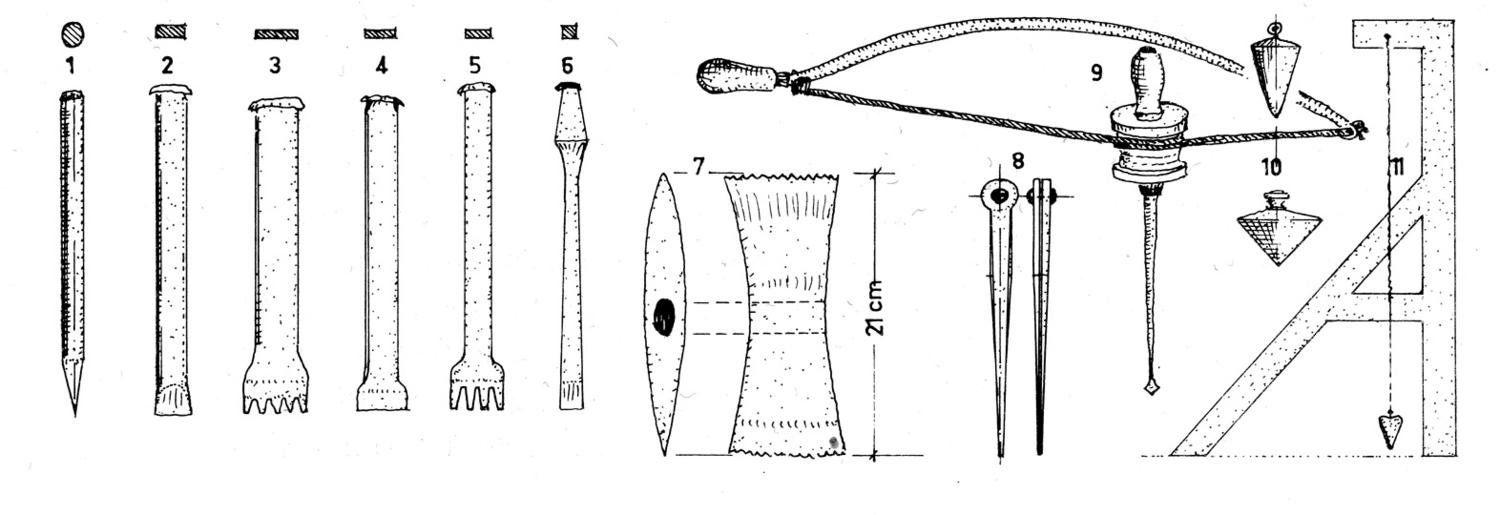
Abb. 2.17: Steinmetz-Werkzeuge (Müller-Wiener 1988, Abb. 20b).
Im Bereich der Steinbearbeitung verwendeten die Griechen ein keineswegs besonders umfangreiches Arsenal von Werkzeugen.271 Dazu gehörten verschiedene Hacken und Beile (auch mit gezahnter Schneide) für die erste, grobe Ausarbeitung der Formen, sowie Hämmer und ein Satz Meissel für die Herstellung und Endbearbeitung von Flächen und Ornamentformen. Meißel, deren Spitzen bzw. Schneiden gehärtet wurden (wie Waffenklingen)272, gab es je nach Einsatzzweck und Härte des zu bearbeitenden Steinmaterials in unterschiedlichen Formen: grobe und feine Spitzmeißel, Zahneisen mit Schneidbreiten von meist drei bis vier Zentimetern, sowie Flachmeißel mit ähnlichen Klingenbreiten, die in dieser Reihenfolge für die Herstellung von glatten Flächen eingesetzt wurden. Zum Teil waren die Zahneisen allerdings auch so fein, dass eine Überarbeitung mit dem Flachmeißel oder einem Scharriereisen nicht erforderlich war. Sollte eine Oberfläche poliert werden, nahm man dazu Poliersteine mit hohem Anteil an Quarzsand. Weiter benutzen die Steinmetzen zum Anreißen der auszuarbeitenden Form am Werkstück Reißnadeln und Zirkel, sowie Bohrer273, die von einem Bogen (‚Bohrgeige‘) angetrieben wurden (Abb. 2.17).
Formen und Typen dieser Werkzeuge hätte man noch im frühen zwanzigsten Jahrhundert in jedem Steinmetzbetrieb finden können. Sie sind auch nicht erst von den Griechen entwickelt worden, denn fast alle Typen lassen sich schon in mykenischer Zeit nachweisen.274 Das vielleicht einzige Werkzeug aus diesem Spektrum, das möglicherweise in archaischer Zeit neu aufkam, war das Zahneisen. Die ältere Forschung hat die Einführung in die Mitte des 6. Jahrhunderts datiert, doch ist inzwischen gezeigt worden, dass es zu Beginn des Jahrhunderts – also zu der Zeit, in der der monumentale Steinbau seinen Anfang nahm – bereits in Gebrauch war. Man könnte in diesem Zusammenhang vielleicht noch die Steinsäge anführen. Sie hatte nur bei sehr weichen Gesteinen gezahnte Sägeblätter. Beim Sägen härterer Materialien wurde ein ungezahntes Blatt mit Quarzsand und Wasser eingesetzt (ebenso beim Bohren). Von großer Bedeutung war die Steinsäge in der hier betrachteten Zeit nicht, sondern erst gegen Ende des Hellenismus, und vor allem in der römischen Kaiserzeit, denn nur die Säge ermöglichte, mit vertretbarem Aufwand dünne Steinplatten herzustellen, die in den genannten späten Epochen vor allem für Wandinkrustationen gebraucht wurden. Im Übrigen ist die Steinsäge wahrscheinlich275 auch schon in mykenischer Zeit eingesetzt worden.
Die Tatsache, dass alle oder fast alle Werkzeuge auch in früherer Zeit schon entwickelt worden waren, zeigt, dass die bis heute beeindruckende Präzision der Steinbearbeitung vieler griechischer Bauten nicht an Innovationen im Bereich der Arbeitsmittel gebunden war, sondern mit dem Anspruch und dem Können der griechischen Handwerker zu verbinden ist. Das gilt, nebenbei bemerkt, in gleicher Weise für die Bildhauer, wobei die Grenzen hier ohnehin fließend sind, bedenkt man, welche immensen Anforderungen etwa die Herstellung eines korinthischen Kapitells an einen Steinmetz stellte.
Ähnliches wie für die Steinwerkzeuge gilt sehr wahrscheinlich für die Holzwerkzeuge.276 Die Unsicherheit besteht hier darin, dass von diesen Werkzeugen noch sehr viel weniger gefunden wurden, weil viele von ihnen aus Holz gefertigt waren. Die Werkzeuge, die auf bildlichen Darstellungen erkennbar sind, entsprechen den aus diversen Epochen bekannten Formen: Hammer, Beil, Säge, Bohrer, Werkzeuge in der Art des Stecheisens, auch Feilen. Möglicherweise eine griechische Erfindung, allerdings im Bauwesen weniger von Bedeutung, ist der Hobel.277
Vor hoher Bedeutung hinsichtlich der Arbeitsqualität und Präzision sind die Meßzeuge und andere Instrumente zur Kontrolle von Flächen, Winkeln usw.278 Ein bei einem Schiffswrack vor der israelischen Küste aufgetauchter Winkel aus Holz mit seitlicher Standfläche hat praktisch dieselbe Form, in der solche Winkel noch heute hergestellt werden. Dieser Typus von Winkel war im pharaonischen Ägypten
Zur Kontrolle der Horizontalität wurde eine Bleilot- oder Setzwaage im Form eines A verwendet, an deren Spitze mit einer Schnur ein Lot aufgehängt war, das mit einem Eichstrich auf der Querhaste übereinstimmen musste.282 Die Setzwaage konnte zugleich als Winkelmaß dienen (wie das in Abb. 2.17, Nr. 11 dargestellte Exemplar). Ihre Form ist von vielen Grabreliefs römischer Bauhandwerker bekannt.
Lote (οταφύλη), schon bei Homer erwähnt283, hatten die auch heute noch häufig verwendete Form eines an der Basis aufgehängten Kegels. Um Vorsprünge umgehen zu können, gab es hölzerne Abstandhalter, mit denen das Lot in einem definierten Maß vor einer Wand abgelassen werden konnte. Auch dieses Instrument ist bereits im pharaonischen Ägypten
2.6.2 Maschinen und Gerüste
Drehscheiben zur Bearbeitung von Baugliedern sind nachgewiesen worden anhand von Bearbeitungsspuren auf Säulenbasen in Kyrene
Ein Bagger, der beim Vertiefen eines Hafenbeckens zum Einsatz kam, wird von Philon
Baugerüste (ἴκϱια, s. oben Abb. 2.15) werden in einer Reihe von Inschriften erwähnt.288 Da keine bildlichen Darstellungen bekannt sind, lässt sich die Bauweise nicht näher bestimmen. Als sicher darf aber immerhin gelten, dass es sich nicht um sog. fliegende bzw. hängende Gerüste gehandelt haben kann, die in Aussparungen der Wände eingesetzt wurden, also nicht auf dem Boden aufgestellt waren, denn die Bauten zeigen nie entsprechende Aussparungen.
Zu den bekannten Maschinen zählen schließlich die oben (Abschnitt 2.5.3) schon angesprochen Flaschenzüge. Sie waren offenbar sehr teuer, denn aus Abrechnungsinschriften geht mehrfach hervor, dass sie ausgeliehen wurden.289 Sie gehörten demnach nicht zum Werkzeuginventar der Handwerker, die die in den Abrechnungsinschriften dokumentierten Arbeiten auf Basis von Werkverträgen ausführten. Einen Teil eines griechischen Flaschenzuges ist in Kenchreai
2.6.3 Fundamentierungen
Wo immer möglich, wurde für Fundamente die Erde bis zum anstehenden Felsen ausgeschachtet. Das konnte, wie Abrechnungsinschriften belegen, vertraglich zwischen Bauherrn und Auftragnehmern festgelegt sein.292 Um ein ebenes Bett für die unterste Lage der Fundamentplatten zu schaffen, wurde der Felsen in der Regel geglättet. Bei abfallendem Felsprofil wurden Abtreppungen beobachtet, die den Arbeitsaufwand beim Abarbeiten des Felsengrundes reduzierten (Apollontempel von Korinth
Wo der anstehende Felsen nicht erreicht werden konnte, wurde der Boden in unterschiedlich tiefem Maße ausgeschachtet. Eine Regel, die etwa eine Fundamenttiefe proportional zum aufgehenden Mauerwerk festgelegt hätte, lässt sich nicht erkennen. Nicht selten, aber keineswegs immer, wurde unter solchen Bedingungen unter dem Quaderfundament noch eine Bruchsteinschüttung eingebracht. Die einzige Regel, die stets eingehalten wurde, war, dass Fundamentzüge stets breiter sein mussten als das aufgehende Mauerwerk, was im Sinne der Standsicherheit zweckmäßig war, da auf diese Weise der Druck des aufgehenden Mauerwerks auf eine größere Fläche abgeleitet werden konnte. Unterschiede gab es in der Tiefe der Fundamentierungen. Bei manchen Bauten liegen alle Fundamentsohlen auf dem gleichen Niveau, bei anderen ist die Tiefe abhängig vom Oberbau, d. h. die Fundamente der äußeren Säulenstellungen reichten etwa eine Steinlage tiefer als die des Kernbaus.
Quader- oder Plattenfundamente wurden in der Regel in der gleichen Technik errichtet wie Werksteinmauern. Man verwendete für die Fundamente häufig – vor allem natürlich bei Bauten aus Marmor – geringerwertiges Steinmaterial als beim Oberbau. Nicht selten finden sich in Fundamenten auch Spolien, d. h. Bauglieder von Vorgängerbauten oder aufgelassenen Gebäuden aus der Nähe, in Einzelfällen auch bei der Herstellung irreparabel beschädigter Bauglieder.
Die Steine wurden an vier bzw. fünf Seiten geglättet, um einen sauberen Fugenschluss zu gewährleisten. Nur die nach außen weisenden Schmalseiten, die keinen Fugenschluss zu anstoßenden Platten hatten, blieben unbearbeitet. Die Stoßfugen hatten meist auch Anathyrosen, die Lagerfugen lagen in ganzer Fläche auf. Verbindungen durch Dübel und Klammern wurden bei vielen Fundamenten eingespart, oder nur an den statisch besonders belasteten Ecken eingesetzt. In Einzelfällen zeigt die selektive Verwendung von Klammern auch an, dass den Baumeistern bewusst war, welche Bereiche des Baugrunds weniger tragfähig waren als andere, wie etwa am Metroon in Olympia
Rostfundamente wie am großen Altar von Pergamon
Einzel- oder Punktfundamente finden sich nur selten für Säulen von äußeren Säulenstellungen, wie beispielsweise am Olympieion in Athen
Die offensichtliche Kenntnis der Bedeutung des Untergrundes für die Standsicherheit ihrer Bauten hat die griechischen Architekten nicht davon abgehalten, auf erkennbar problematischem Untergrund auch große Gebäude zu errichten. Das Motiv dafür, solche Bedingungen als Herausforderung anzusehen, der mit entsprechender Technik zu begegnen war, lag zumeist in der sakralen Bedeutung der Bauplatzes: die ambitioniertesten Bauprojekte zumindest der archaischen und klassischen Zeit waren die Tempelbauten in Heiligtümern, deren Lage aus religiösen Gründen nicht verändert werden konnte, selbst wenn sie denkbar schlechten Baugrund boten. Das gilt insbesondere für das Artemisheiligtum in Ephesos
2.6.4 Mauern aus Stein: Typen, Versatz- und Verbindungstechniken
Mauern aus Stein299 wurden in sehr unterschiedlicher Technik errichtet. Gemeinsam sind den verschiedenen Typen nur einige wenige Merkmale, und zwar der Verzicht auf kalkhaltige Bindemittel (Mörtel), sowie die – statisch vorteilhafte – Verjüngung, wobei die Differenz zwischen der Breite auf Fundamentniveau und der Breite der Mauerkrone bei Quadermauern deutlich geringer ist als bei den übrigen Typen.
Mauerwerkstypen eignen sich kaum für Datierungen, denn alle grundlegenden Typen lassen sich in nahezu allen hier betrachteten Epochen finden. Antike Beschreibungen der Bautechnik gibt es nur von römischen Autoren.300
2.6.5 Bruchsteinmauern
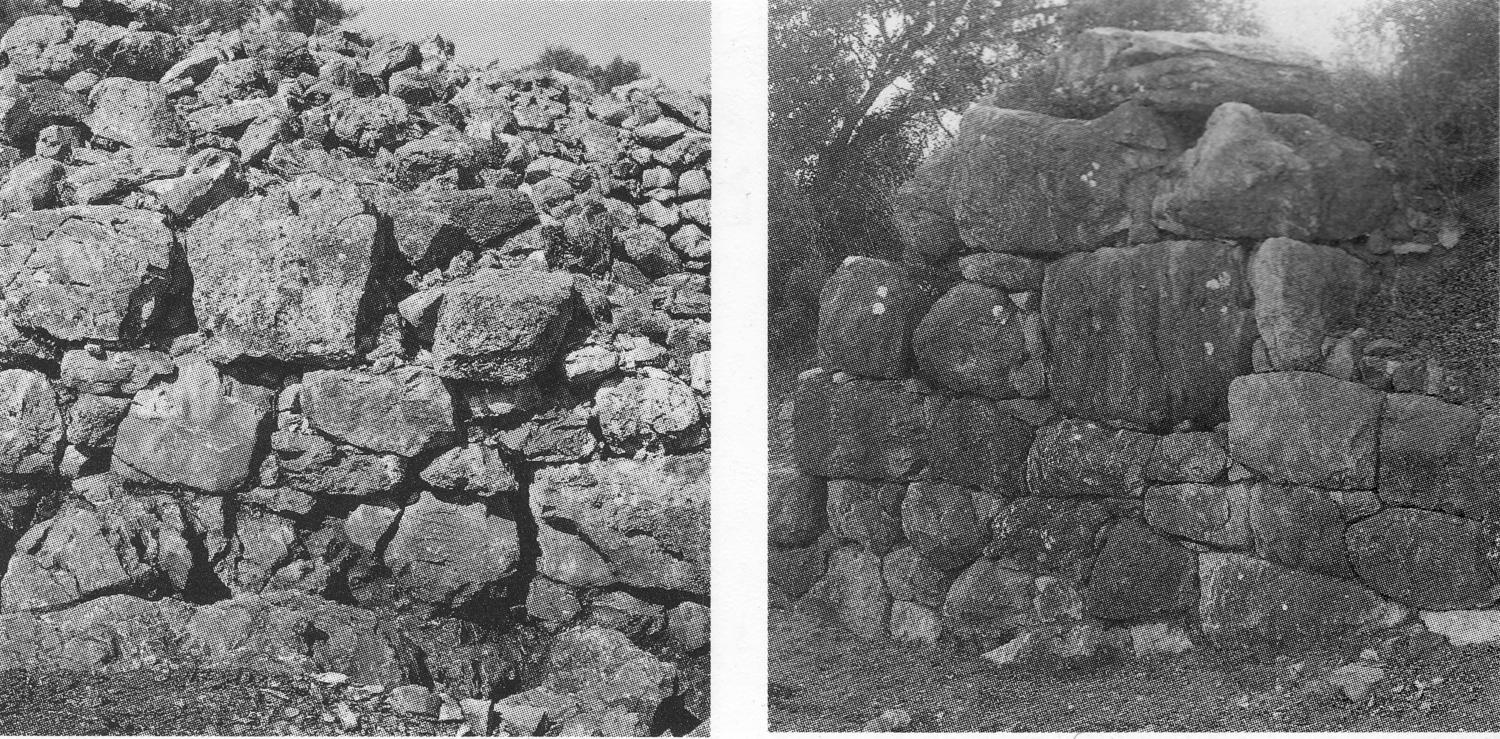
Abb. 2.18: Bruchstein-Mauerwerk (Müller-Wiener 1988, Abb. 30).
Die Bruchsteinmauer (Abb. 2.18) war die älteste und am einfachsten herzustellende Form der Mauer, da dieser Typ praktisch keine qualifizierte Arbeit erforderte. In der Regel bestehen diese Mauern aus dem jeweils lokal anstehendem Gestein, dass entweder unbearbeitet blieb oder sehr grob zugehauen wurde. Aufgebaut waren diese Mauern aus zwei aufgeschichteten Schalen aus größeren Steinen, deren Zwischenraum mit Split und kleineren Steinbrocken, oft im Lehmbett, verfüllt wurde. Bei Terrassen- oder Stützmauern konnte die hangseitige Schale entfallen. Freistehende Mauern dieser Art waren oft etwa 60 bis 80 cm breit, so dass der Zwischenraum der Schalen nur sehr schmal war, anders als bei stärkeren Mauern größerer Höhe wie Stadtmauern. Die Qualität solcher Mauern hing einerseits davon ab, wie sorgfältig die Zwischenräume zwischen den großen Steinen der Schalen ausgefüllt wurden, und andererseits von der Verlegung der Bindersteine, die, in annähernd regelmäßigen Abständen verlegt, die Schalen miteinander verbanden. Aus Gründen der Stabilität wurden die Ecken der Mauern meist sorgfältiger gearbeitet, indem ausschließlich größere Blöcke mit relativ dichtem Fugenschluss dort einen stabilen Verband bildeten.
2.6.6 Polygonalmauern

Abb. 2.19: Polygonale Stützmauer der Terrasse des Apollontempels in Delphi
Als Polygonalmauern (Abb. 2.19) bezeichnet man ein ganzes Spektrum von ebenfalls zweischaligen, im Detail aber sehr unterschiedlich gearbeiteten Mauern, deren Gemeinsamkeit darin besteht, dass zwar zwischen den Blöcken der Außenschalen Fugenschluss besteht, die Fugen selbst aber kein regelmäßiges Gitter aus horizontalen und vertikalen Linien bilden wie beim Quaderbau. Sind überdurchschnittlich große Steine für die Außenschalen verwendet worden, spricht man von Zyklopenmauern. Eine exakte Trennung zwischen Bruchstein- und Polygonalmauerwerk ist nicht möglich, die Übergänge sind fließend, zumal selbst innerhalb von Mauern der Fugenschluss sehr unterschiedlich ausfallen kann. Vermutlich gilt dieser Übergang auch für die Entstehung: Polygonalmauerwerk ist letztlich ein Bruchsteinmauerwerk mit dichtem Fugenschluss.
Das Polygonalmauerwerk hatte zwei grundlegende Vorteile. Verglichen mit dem Bruchsteinmauerwerk war es, bedingt durch den Fugenschluss, deutlich stabiler. Gegenüber dem Quaderbau hatte es den Vorteil, dass deutlich weniger Abschlag, und damit Steinmetzarbeit anfiel, wenn aus dem herbeigeschafften Material jeweils Steine herausgesucht wurden, deren Form annähernd dem Fugenverlauf der bereits versetzten Blöcke entsprach.
Die Außenflächen der Blöcke wurden in unterschiedlicher Weise bearbeitet. Teilweise wurden sie nahezu roh belassen, teils wurde ein Saumstreifen an den Fugen ausgearbeitet, das Zentrum jedoch roh belassen, oder aber die Front der Mauer wurde mit dem Spitzmeißel in eine Ebene gebracht, aber ohne die Fläche mit dem Zahneisen oder einem Flachmeißel vollständig zu glätten. Verwendet wurde Polygonalmauerwerk vor allem an Stadt-, Terrassen- oder Stützmauern (Abb. 2. 19), bei Gebäuden hingegen meist nur im Bereich der Sockelzone der aufgehenden Wände bzw. als Sockel für Lehmziegelmauern. Gerade bei aufwändig gearbeitetem Polygonalmauerwerk lässt sich deutlich erkennen, dass die Form nicht allein von rein technischen Gesichtspunkten bestimmt wurde, sondern dass das Erscheinungsbild bei der Wahl der Technik eine Rolle gespielt haben muss. Insofern kann man in diesem Kontext durchaus von Mauerwerksstilen sprechen.
Der Übergang zum Werksteinbau mit rechteckigen Quadern ist wiederum fließend. Jüngere Polygonalmauern haben oft Fugen, die in langen Linien durchlaufen, z. B. beim sog. lesbischen Mauerwerk, bei dem die Fugen tendenziell konzentrische Kreise bilden.301 Auch gab es Quadermauerwerk, bei dem nur die Lagerfugen horizontale Linien bildeten, die Stoßfugen hingegen aus der Vertikalen geneigt waren.
2.6.7 Quadermauern
Das Quadermauerwerk aus allseitig bearbeiteten Werksteinen existierte in einer großen Zahl von Varianten. Gemeinsam ist ihnen, dass die Werksteine so verlegt wurden, dass die Horizontalfugen jeder Schicht eine durchgehende, waagerechte Linie bildeten, und die Vertikalfugen regelmäßig wechselten.
Je nach Stärke bestanden die Mauern in jeder Schicht aus einer oder mehreren Reihen von Quadern. Bei nur einer Reihe (Abb. 2.20, Nr. 1) waren die Schichthöhen in der Regel identisch, was als isodomes Mauerwerk bezeichnet wird. Bei mehr als einer Reihe pro Schicht wechselte die Verlegungsrichtung der Quader: Die sogenannten Läufer lagen parallel, die Bindersteine quer zur Achse der Wand. Der Wechsel zwischen beiden konnte innerhalb einer Schicht erfolgen (Abb. 2.20, Nr. 3), oder es wechselten Läufer und Binderschichten (Abb. 2.20, Nr. 2). Eine weitere Variante ergab sich bei der Verwendung von langrechteckigen, plattenförmigen Steinen, die als Läufer liegend und als Binder stehend verlegt wurden (Abb. 2.20, Nr. 4). Auf diese Weise ergab sich zwangsläufig ein Wechsel von höheren und flacheren Lagen, der als pseudoisodom bezeichnet wird. Wie auf der Abbildung dargestellt, schlossen häufiger die Läufer mit ihren Innenseiten nicht aneinander an. Entsprechende Hohlräume wurden, anders als bei den zuvor beschriebenen Mauerwerkstypen, meist nicht verfüllt. Bei allen diesen Systemen wurde die Sockelschicht der Mauer dadurch hervorgehoben, dass dort eine Reihe von Quadern verbaut wurde, deren Höhe dem Zwei- bis Dreifachen der normalen Wandquader entsprach. Diese sogenannte Orthostatenschicht dürfte aus den steinernen Sockelzonen der Lehmziegelmauern in den Quaderbau übernommen worden sein. Auch bei den Lehmziegelmauern anspruchsvoller Gebäude wurde, wie schon erwähnt, eine solche Orthostatenschicht aus Stein verlegt (Heraion von Olympia).
Wie auf der Schemazeichnung angedeutet, wurden so gut wie nie alle sechs Seiten der Quader glattflächig bearbeitet. Üblich war vielmehr, die Stoßfugen an den Schmalseiten der Quader, und bei Läufern die Innenseiten, bis auf einen Randstreifen einzutiefen (sog. Anathyrosen, s. Abb. 2.21). Nur dieser glatte Randstreifen bildete die Kontaktfläche zum benachbarten Stein. Das hatte den Vorteil, dass für dicht schließende Fugen die Bearbeitung wesentlich weniger aufwändig war, weil nicht die komplette Stoßfuge präzise und winkelgerecht geglättet werden musste. Anathyrosen an den horizontalen Lagerfugen waren selten.
Die Endbearbeitung der Quaderflächen erfolgte vor dem Versetzen nur teilweise. Angeliefert wurden die Steine auf der Baustelle, wie oben im Zusammenhang mit den Arbeiten im Steinbruch beschrieben, in der Regel in Bosse, bzw. mit einem Werkzoll auf den Außenseiten. Vor dem Versetzen wurde der Werkzoll nur an den unteren Lagerflächen abgearbeitet und an den Stoßfugen die Anathyrosen abgearbeitet. Erst nachdem alle Steine einer Reihe verlegt waren, wurden die Oberseiten über die ganze Reihe hinweg einheitlich geglättet. Die Außenseiten wurden erst nach der Fertigstellung der kompletten Wand in einem Zug glatt gearbeitet.
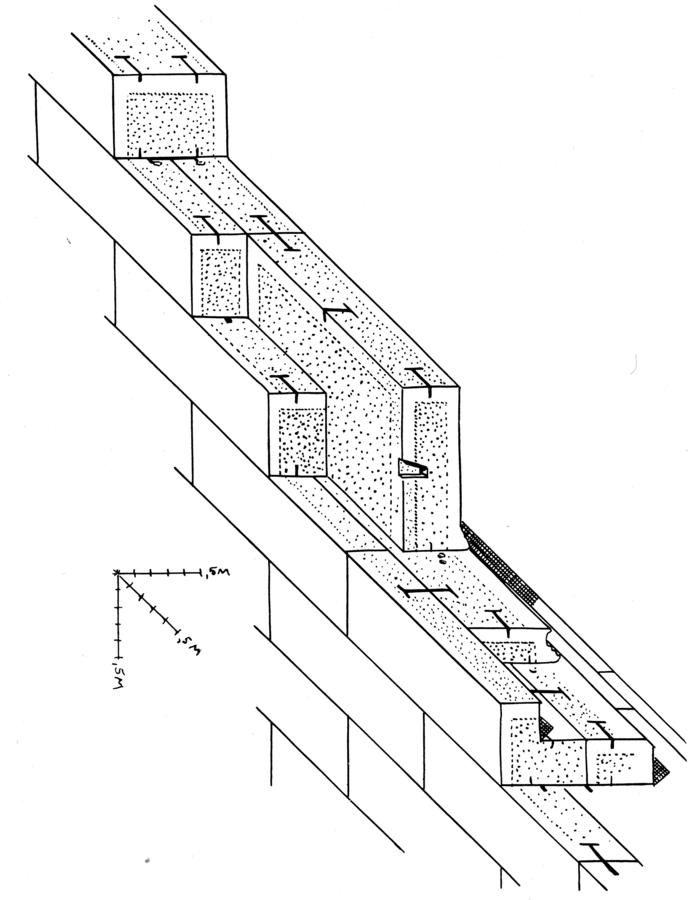
Abb. 2.21: Mauerquader mit Anathyrosen und Bettungen für Doppel-T-Klammern (Caskey et.al. 1927, Abb. 31).
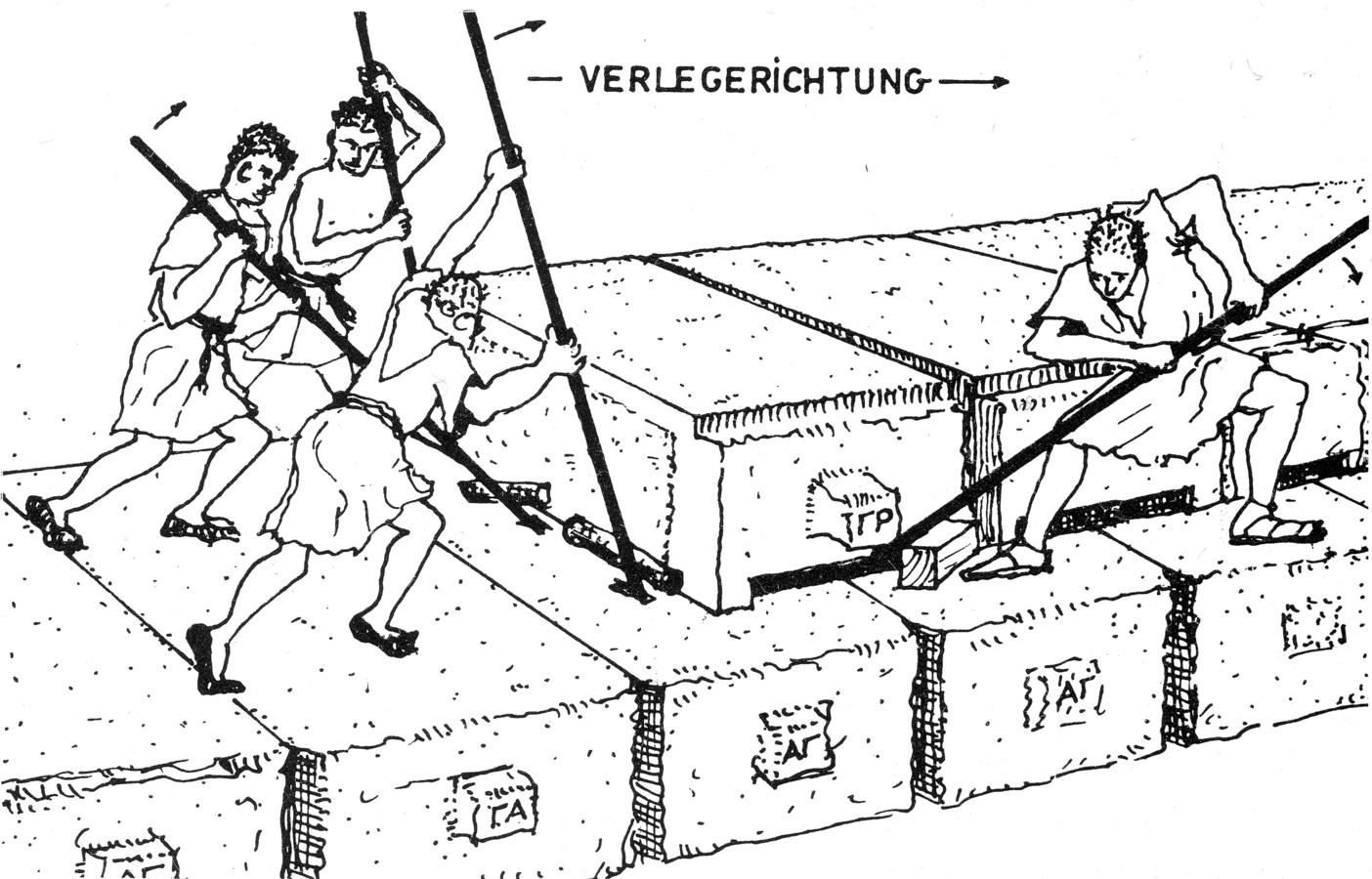
Abb. 2.22: Versatz von Krepisblöcken mit Stemmeisen (Müller-Wiener 1988, Abb. 38).
In ihre endgültige Position versetzt wurden die Steine nach dem Aufsetzen auf die Mauer mithilfe von Stemmeisen, für die als Widerlager kurze Nuten in die Oberseiten der darunter liegenden Quader eingeschlagen wurden (Abb. 2.22). Da diese Nuten immer vor der endgültigen Position der Schmalseite eines Quaders liegen müssen, lässt sich durch sie oft die Verlegungsrichtung der Quader rekonstruieren.
Das Verschieben der Quader in ihre endgültige Position mit Stemmeisen hatte zur Folge, dass man die ersten bzw. letzten Steine einer Reihe nie als letzte versetzen konnte, da in diesem Fall das Stemmeisen nirgendwo mehr hätte angesetzt werden können. Deshalb wurde der jeweils erste und letzte Stein einer Reihe am Anfang der Verlegung der Reihe in Position gebracht. Daraus ergab sich wiederum das Problem, dass der letzte Stein der Reihe, der Schlussstein, von oben in die Reihe abgesenkt werden musste, also nicht mit dem Stemmeisen bewegt werden konnte. Das Einfügen des Schlusssteins wurde erheblich erleichtert, wenn dieser Stein am Seil eines Krans befestigt werden konnte. Die bereits oben im Abschnitt zur Baustellenlogistik gezeigten Aufhängungsformen (Seilschlaufen, Wolf) erleichterten das Absenken des Schlusssteins ganz erheblich, weswegen häufig nur der Schlussstein Wolfslöcher oder Seilkanäle hatte. Bekannt waren aber auch Methoden, Schlusssteine ohne Kran einzufügen: Dazu wurde die Lücke, in die der Schlussstein einzufügen war, zunächst mit mehreren Lagen Kanthölzern ausgefüllt, und der Schlussstein darauf geschoben. Anschließend wurde der Schlussstein mit Stemmeisen leicht angehoben, wobei die Eisen in kleine Nuten in den Stoßfugen des Schlusssteins eingriffen. Nach dem Anheben wurde die oberste Lage der Kanthölzer entfernt, und der Stein abgesenkt. Anschließend wurde der Stein wieder mit den Eisen leicht angehoben, die in etwas höher liegende Stemmlöcher eingriffen, und die nächste Lage der Kanthölzer entfernt, und so fort. Man erkennt dieses Verfahren an den Stemmlöchern in den Stoßfugen des Schlusssteins, die in dichten Abständen übereinander eingetieft sind, z. B. am Fries des Zeustempels von Nemea.
Der Verband der Quader konnte durch Verklammerung zwischen den Blöcken derselben Reihe und durch Verdübelung der Blöcke mit denen der nächstunteren Schicht gesichert werden, was primär als Schutz gegen Verrutschen der Quader im Fall von Erdbeben gedacht gewesen sein dürfte. Klammern und Dübel wurden in sehr unterschiedlichem Umfang verbaut. Es gibt Bauten mit sehr wenigen solchen Sicherungen (meist an den eher gefährdeten Ecken) und solche, wo durchgängig jeder Stein gesichert wurde.
Für das Einsetzen wurden zunächst jeweils Bettungen ausgearbeitet, in die die Dübel und Klammern eingelegt wurden. Anschließend wurden sie als Korrosionsschutz von oben mit Blei vergossen, das nach dem Abkühlen durch Schläge mit dem Meißel auf die Oberfläche des Bleis zusätzlich in die Bettung gepresst wurde. Vor allem in hellenistischer Zeit wurden für das Einbringen des Bleis zusätzlich Gusskanäle in die Steine eingearbeitet.
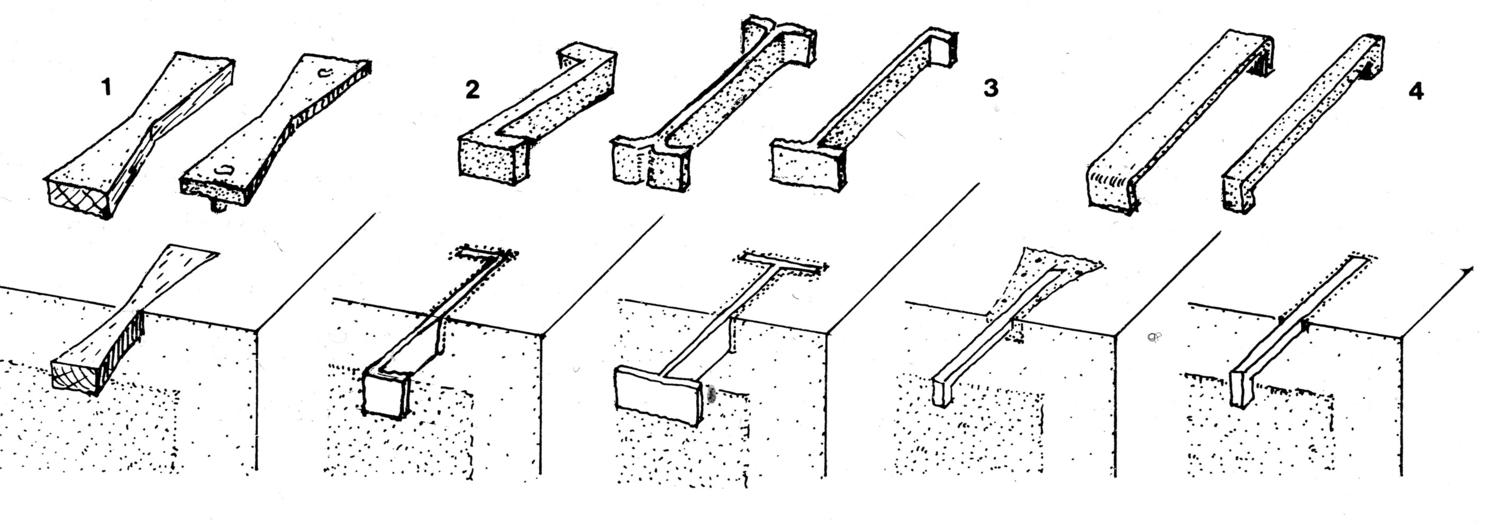
Abb. 2.23: Verschiedene Klammerformen: 1. Schwalbenschwanzklammer – 2. Z-Klammer – ohne Nr:. Doppel-T-Klammer – 3. Hakenklammer – 4. U-Klammer (Müller-Wiener 1988, Abb. 40).
Klammern und Dübel wurden aus Hartholz, Bronze und Eisen hergestellt. Vor allem die Klammern hatten sehr unterschiedliche Formen (Abb. 2.23). Von den gebräuchlichsten Klammerformen ist die in der Herstellung aufwändige Doppel-T-Form die ältere, die ab etwa dem 4. Jahrhundert zunehmend durch die einfach aus Flacheisen zu biegende U-Klammer ersetzt wurde, ohne dass erstere vollkommen verdrängt worden wäre.
2.6.8 Säulen und Gebälke
Die Säulenschäfte waren bei einigen archaischen Tempeln trotz ihrer enormen Größe Monolithe.302 Bei Schaftlängen von bis zu acht Metern war das zweifellos mit enormen technischen Schwierigkeiten verbunden, angefangen bei der Suche nach geeigneten Blöcken ohne Stich im Steinbruch über den Transport zur Baustelle bis hin zur Aufrichtung der Schäfte. Man hat zu Beginn des 6. Jahrhunderts monolithe Schäfte sicher noch in Analogie zu den früharchaischen Säulen verwendet, die aus Baumstämmen hergestellt wurden. In späterer Zeit, als aus Säulentrommeln zusammengesetzte Schäfte bereits verbreitet waren, mag den monolithen Schäften von einigen Architekten eine größere Stabilität zugeschrieben worden sein. Vielleicht hatten solche Schäfte auch einen höheren Prestigewert wegen der genannten technischen Schwierigkeiten bei Bruch, Transport und Aufrichtung.
Säulenschäfte wurden ab dem beginnenden 5. Jahrhundert ausschließlich aus Trommeln zusammengesetzt. Ihre Zahl wechselt wegen der stets unterschiedlichen Höhe der Trommeln so gut wie immer auch innerhalb derselben Säulenstellung. Die Lagerfugen der Trommeln lagen also nicht bei allen Säulen auf demselben Niveau. Vermutlich hing die Höhe im Wesentlichen von der Stärke der hochwertigen Gesteinsschichten in den Steinbrüchen ab.
Die Vereinfachung beim Brechen und beim Transport durch die Verwendung von Trommeln stellte allerdings auf anderer Ebene neue Anforderungen: Nur wenn die Lagerflächen der Trommeln perfekt einander angepasst waren, konnte der Schaft in sich stabil sein. Umgekehrt hätten sich Ungleichmäßigkeiten der Lagerflächen (Kippspiel) addiert, und auf diese Weise die Schäfte anfällig für Schwankungen gemacht, was wiederum die Standsicherheit der gesamten Säulenstellung beeinträchtigt hätte. Um die Lagerflächen einander exakt anzupassen, verwendeten die Baumeister Rötel als Touchierfarbe. Wurden die Trommeln leicht gegeneinander verdreht, verwischte die Farbe dort, wo sie aufeinander auflagen, bzw. dort nicht, wo die Flächen keinen Kontakt hatten.303 Aus praktischen Gründen ist anzunehmen, dass das probeweise Aufsetzen der Trommeln jeweils paarweise auf dem Bauplatz erfolgte, so dass die Trommeln beim Versatz am Bau nicht wieder abgenommen werden mussten.
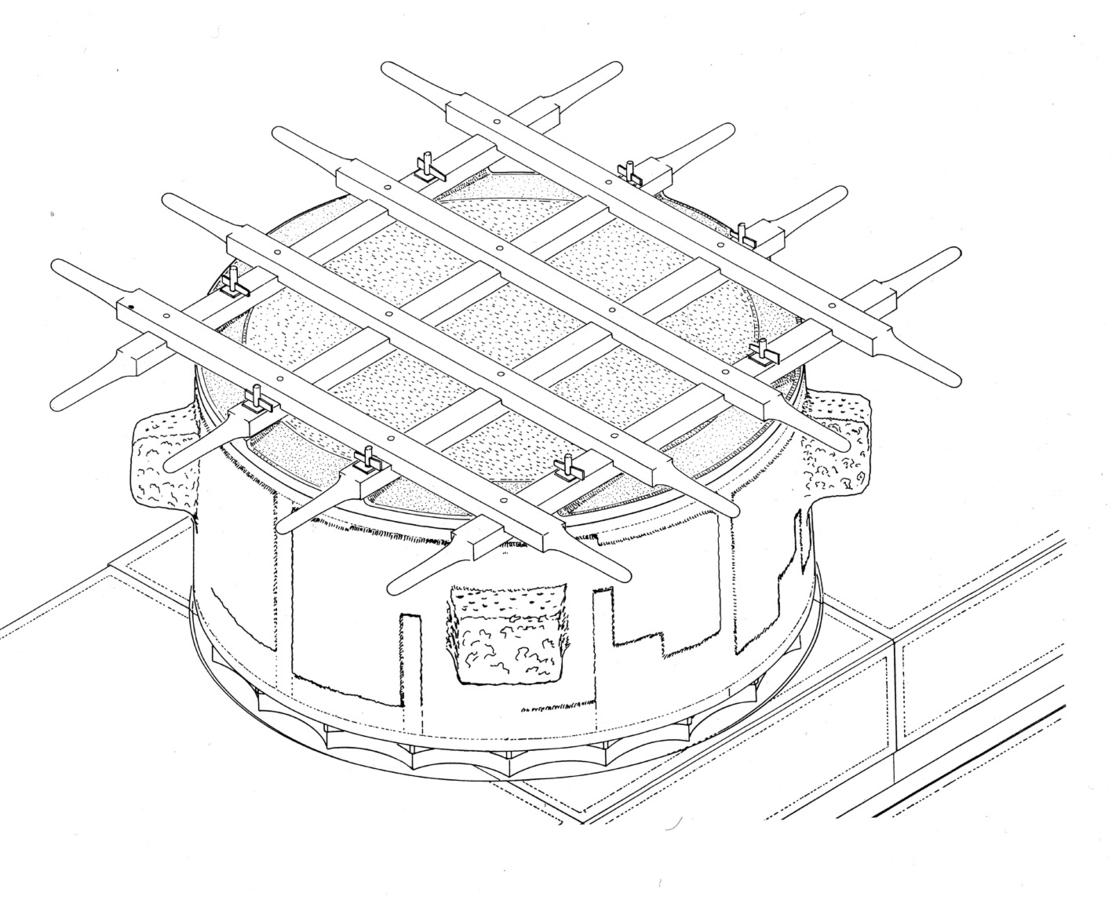
Abb. 2.24: Richtplatte (Korres and Vierneisel 1992, Abb. 15).
Eine alternative Arbeitsweise hat Manolis Korres
Ein technisches Detail, das offensichtlich Auffassungsunterschiede in Technikfragen erkennbar werden lässt, ist die Verdübelung der Trommeln. Dabei zeigt sich eine ähnliche Tendenz wie bei der Verdübelung der Wandquader. Bis etwa zum Anfang des 4. Jahrhunderts wurde die Säule aus Basis (falls vorgesehen), Schaft und Kapitell als Einheit verstanden, indem alle Teile untereinander verdübelt wurden, und zwar mit einem zentralen Runddübel, so dass die Trommeln sich bei Erdstößen gegeneinander verdrehen konnten. Zugleich blieb die Säule aber innerhalb der Säulenstellung insofern eine Art autonomer Einheit, als sie weder mit ihrer Standplatte (dem Stylobat), noch mit dem Gebälk durch Dübel verbunden wurde. Diese Auffassung änderte sich im Verlaufe des 4. Jahrhunderts. Die Trommeln wurden nunmehr häufiger auch mit außermittigen Dübeln verbunden, so dass ein Verdrehen gegeneinander nicht mehr möglich war. Zudem wurde die Säule durch Dübel auch mit dem Stylobat, auf dem sie stand, und dem Gebälk über ihr verbunden. Offensichtlich war für die betreffenden Architekten das Ziel, eine maximale, starre Verbindung zwischen allen Gliedern der Säulenstellung zu erreichen. Ähnliches kann man im Bereich des Wandaufbaus beobachten. Im 6. und 5. Jahrhundert wurden häufig nur die Wandquader einer Reihe untereinander mit Klammern verbunden, so dass sich die Reihen bei Erdstößen gegeneinander verschieben konnten. In späterer Zeit sind die Reihen auch vertikal, durch Dübel, untereinander fixiert. Welche Argumente oder Beobachtungen zu dieser neuen Sichtweise geführt haben, ist nicht bekannt. Welche Alternative von der Standsicherheit her gesehen die bessere war, lässt sich empirisch nicht zeigen. Von beiden Varianten stehen noch heute Exemplare aufrecht.305 Zu beobachten ist zudem eine Tendenz dieser Zeit, auch die Lagerflächen der Trommeln mit Anathyrosen zu versehen, was lange Zeit unüblich war.
Die Endbearbeitung der Sichtflächen der Säulenschäfte, d. h. die Ausarbeitung der Kanneluren, erfolgte, wie bei den Mauern auch, erst nachdem alle Bauglieder der Säulenstellung versetzt worden waren. Als Referenz wurden lediglich unten an der Fußtrommel und oben am Kapitellhals auf wenigen Zentimetern die Anfangs- und Endpunkte der Kanneluren vor dem Versatz ausgearbeitet.
Auch die Gebälke zeigen wachsende Kenntnisse der Baukonstruktion. Schon früh hat man etwa darauf geachtet, dass die Schichtungen im Gestein bei Architraven vertikal zur Einbaulage verbaut wurden, während bei allen anderen Baugliedern die Gesteinsschichten ebenso horizontal liegen wie im Steinbruch selbst. Die meisten Forscher nehmen an, dass dadurch eine höhere Belastbarkeit des Gesteins bei Durchbiegungen durch die Auflast erreicht wird. Es gibt allerdings auch die oben schon im Zusammenhang mit den Arbeiten im Steinbruch vertretene Auffassung, dass die, bezogen auf die Schichtung, vertikale Einbaulage bei Architraven durch die entsprechende Arbeitsersparnis im Steinbruch zu erklären ist.306
Frühe Bauten zeigen noch eine deutliche Unsicherheit hinsichtlich der Beurteilung der Tragfähigkeit der Architrave. Die Steinbalken der frühen Bauten sind, wie der Vergleich mit späteren Bauten veranschaulicht, erheblich überdimensioniert. Die Gebälke wirken daher schwer, um nicht zu sagen plump. Bei der Bemessung der späteren Architrave mit deutlich reduzierten Dimensionen zeigt sich zudem eine der wenigen Dimensionierungsregeln im Bereich der Konstruktion von Säulenstellungen. Die Breite der Architrave beträgt in nacharchaischer Zeit fast konstant zwei Fünftel der Länge des Jochs, das der Architrav überspannt.307 Im Hellenismus wird dann zunehmend eine Tendenz beobachtbar, die Gebälke insgesamt immer stärker zu reduzieren, so dass sie optisch ‚leichter‘ wirken. Bei kleineren Bauten sind Architekten daher, um der Bruchgefahr zu entgehen, dazu übergegangen, die Architrave und den Fries darüber aus einem einzigen Stein auszuarbeiten, so dass nicht nur der Architrav, sondern auch der Fries zum Tragbalken wird – anders, als es die Gebälkornamentik suggeriert, die klassischerweise immer eine Illustration der tragenden und lastenden Bauglieder bietet.
Ein Problem beim Versatz der Architrave war, dass sie exakt horizontal auf die Kapitelloberseiten abgelassen werden mussten. Ein auch nur leichtes Verkanten hätte unmittelbar zu Abplatzungen an den zuerst aufsetzenden Kanten von Architraven bzw. an den Oberkanten der Kapitelle geführt. Um diesem Problem zu begegnen, gingen die Baumeister dazu über, auf den Oberseiten der Kapitelle beim Glätten ein Fläche im Zentrum mit leicht erhöhtem Niveau zu belassen. Da diese sog. Scamilli nicht bis an die Außenkanten der Architrave heranreichten, belastete eine minimale Neigung der Architrave beim Aufsetzen die Kanten der Kapitelle nicht.
Die technische Entwicklung der Säulenstellungen zeigt somit, weitaus stärker als die der Architekturformen, einen Zugewinn an Kenntnissen auf Seiten der Architekten, ohne dass das konstruktive Paradigma der griechischen Architektur, das Stütze-Gebälk-System, aufgegeben worden wäre. Fundamental andere Ansätze, wie die Keilsteintechnik, haben die Architekten – obwohl sie sie kannten – niemals in die Sphäre der Sakralarchitektur eingeführt.
2.6.9 Ingenieur-Bau
Straßenbau
Die ältere Forschung ging mit Bezug auf entsprechende Nachrichten in den Quellen davon aus, dass die Mehrheit der antiken griechischen Straßen
Von den meisten dieser Überlandstraßen
Eine spezielle Konstruktion war der in der Antike Diolkos genannte Verbindungsweg beim Isthmos von Korinth
Brückenbau
Noch fast vollständig erhalten ist die kleine, ins 5. Jahrhundert datierte Steinbrücke über den Erasinos, die den Zugang zum Artemis-Heiligtum von Brauron m). Technisch gesehen handelt es sich um eine Balkenbrücke.
m). Technisch gesehen handelt es sich um eine Balkenbrücke.
Ebenfalls den Zugang zu einem Heiligtum eröffnet das von Ptolemaios II.
Ein Hinweis auf eine Brücke weit größerer Dimensionen findet sich bei älteren Plinius 200 Fuß
200 Fuß
 ca. 60 m) plausibel erscheinen lässt. In dieser Meerenge treten mehrmals täglich wechselnde Gezeitenströmungen auf, was eine entsprechend stabile Pfleilerkonstruktion auch ohne unter Wasser abbindenden Mörtel320 erfordert haben muss, da eine freitragende Holzkonstruktion dieser Spannweite unwahrscheinlich ist. Sicher ist, dass die Brücke spätestens aus dem 4. Jahrhundert stammt, da sie nach Strabon
ca. 60 m) plausibel erscheinen lässt. In dieser Meerenge treten mehrmals täglich wechselnde Gezeitenströmungen auf, was eine entsprechend stabile Pfleilerkonstruktion auch ohne unter Wasser abbindenden Mörtel320 erfordert haben muss, da eine freitragende Holzkonstruktion dieser Spannweite unwahrscheinlich ist. Sicher ist, dass die Brücke spätestens aus dem 4. Jahrhundert stammt, da sie nach Strabon
Beachtenswert sind in diesem Kontext die Leistungen griechischer Ingenieure beim Bau temporärer Brücken, auf die es in den Quellen einige Hinweise gibt. Als der Perserkönig Dareios um 512 seinen Feldzug gegen die Skythen im nördlichen Schwarzmeergebiet
Hafenbau
Das Know-how der Architekten und Ingenieure über den Bau von Seehäfen ist spätestens in hellenistischer Zeit schriftlich vorgelegt worden. Diese Texte sind jedoch restlos verloren.324 Einige Hinweise zu Häfen finden sich in den Quellen, etwa bei dem Geographen Strabon
Die Anforderungen an die Anlage von Seehäfen waren zumindest im Grundsatz etwa dieselben wie in der Neuzeit. Die Häfen sollten die anlegenden und ankernden Schiffe vor Beschädigungen durch größere Wellen schützen, ihre Zufahrt(en) sollten so angelegt sein, dass auch bei den je vorherrschenden starken Winden ein Schiff in den Hafen einlaufen konnte, das Verlanden des Hafenbeckens durch sedimentierende Flussmündungen oder grundnahe Meeresströmungen sollte möglichst ausgeschlossen sein, und sie sollten im Kriegsfall gut zu verteidigen sein.
Die Hafenanlagen zeigen häufig eine kluge Nutzung der jeweiligen natürlichen Bedingungen. Im Fall der Stadt Knidos
Kenntnisse der Strömungsverhältnisse im ufernahen Bereich und des Meeresbodens zeigt bereits ein Wellenbrecher aus dem 7. oder frühen 6. Jahrhundert in Eretria
Molen, Kaimauern und Wellenbrecher wurden in Naturstein errichtet. Unter Wasser abbindenden Gussmörtel kannten erst die Römer; die Verwendung von Holzstämmen zur Uferbefestigung oder für Buhnen ist bisher nicht nachweisbar. Für Molen und Wellenbrecher wurden große Bruchsteine aufgeschüttet, so dass sich ein geböschtes Profil ergab, dass die Anlage gegen Unterspülung durch starke Wellen schützte. Kaimauern und die Innenseiten von Molen, an denen Schiffe anlegen sollten, wurden in Quaderwerk erbaut, wobei in Blei verlegte Klammern wie beim Bau an Land verwendet wurden. Wo möglich, wurde auch anstehender Felsen entsprechend abgearbeitet. Auf Molen wurden teilweise Pflasterungen in Wagenbreite angelegt und Verteidigungsmauern und Türme errichtet (so bei den Häfen von Syrakus
2.7 Bauleute und Bauprozess
2.7.1 Architekten
Sicher nachweisbar ist der Begriff Architekt erst im fünften Jahrhundert.332 Er ist zweifellos älter und verweist auf seine Herkunft aus der Periode, in der Holz (und Lehm) die primären Baumaterialien waren, denn wörtlich bezeichnet Architekt den Meister der Tektones, d. h. der Zimmerleute. Für die hier betrachteten Jahrhunderte kommt als Problem hinzu, dass das Aufgabenspektrum der Architekten
Aufgabenspektrum des Architekten
Zu den Aufgaben, die später nicht mehr im ‚Berufsbild‘ des Architekten eingeschlossen waren, gehört etwa der Schiffbau. Schon im 4. Jahrhundert etwa gab es in Athen
Ein zweiter Aufgabenbereich, den man heute dem Ingenieurwesen zurechnen würde, war der Maschinenbau. Noch Vitruv
Sozialer Status
Versucht man eine differenzierte Antwort, dann ist zunächst feststellbar, dass in archaischer Zeit eine pauschale Verachtung der Handarbeit nicht bestanden haben kann, auch nicht in adeligen Kreisen. Das wird bereits bei Homer deutlich. Odysseus, der König von Ithaka
Es ist dem ungeachtet aber kaum zu bezweifeln, dass es in klassischer Zeit in aristokratischen Kreisen und unter ‚Intellektuellen‘ eine ausgesprochene Geringschätzung, wenn nicht Verachtung körperlicher Erwerbsarbeit gab. Sie galt als Tätigkeit, die auf die Dauer den Körper wie den Geist deformiert. Hinweise auf handwerkliche Tätigkeit von Adeligen gibt es aus dieser Zeit nicht mehr, auch nicht auf adelige ‚Dilettanten‘. Erstmals nachweisbar ist diese Geringschätzung der Handarbeit bei Herodot
Es gibt in den Quellen in der Tat einige deutliche Hinweise, dass spätestens ab dem 4. Jahrhundert Entwurf und Bauleitung den größten Teil der Arbeit der Architekten ausgemacht hat, und zudem darauf, dass diese Ablösung der Tätigkeit des Architekten von der praktischen auch wahrgenommen wurde. So gibt es eine Passage in Platons
Auch Aristoteles
Alle hier angeführten Belege geben immer nur die Bewertung des Architektenberufs durch Wissenschaftler und Schriftsteller wider, und sind nicht repräsentativ für die allgemein in der Gesellschaft verbreitete Sichtweise. Dennoch spricht viel für die Annahme, dass die Konzentration auf die Bereiche Entwurf und Bauleitung dazu geführt hatte, dass die Tätigkeit der Architekten nicht mehr als Banausia angesehen wurde, also nicht mehr zu den handwerklichen Arbeiten mit geringem Berufsprestige gezählt wurde.
2.7.2 Bauunternehmen und Bauhütten
Hansgeorg Bankel beispielsweise geht ohne weitere Diskussion davon aus, dass am Anfang des Projekts (dem von ihm vorgelegten jüngeren Tempel der Aphaia auf Ägina
Zu anderen Ergebnissen kommt Dieter Mertens auf Basis seiner Analysen von Entwürfen klassischer westgriechischer Tempelbauten. Mertens sieht in den strukturellen Ähnlichkeiten zwischen den Tempeln der Juno Lacinia, der Concordia und der Dioskuren in Agrigent
Fragt man nun, was sich dem epigraphischen Material über die Arbeitsweise und Organisation der ‚Bauhütten‘ entnehmen lässt, bietet sich zunächst der im ersten Viertel des 4. Jahrhunderts errichtete Asklepiostempel im Heiligtum von Epidauros
| Vertragsgegenstand | Vertragsnehmer | Werklohn |
|---|---|---|
| Ringhalle: | ||
| Fundamente | Mnasikles | 2400 dr (einschl. Material
 Transport) Transport) |
Krepis
 Stylobat Stylobat |
Antimachos | 869 dr |
Säulen
 Gebälk Gebälk |
Sotadas | 3068 dr |
| Giebelsima, Akroterbasen1 | NN 320 dr | |
| Fundamentierung Ringhalle: | Lysikrates | 843 dr (einschl. Material
 Transport) Transport) |
| Platten versetzen | Erechtimos2 | 757 dr |
| Bossen abarbeiten / Schleifen Krepis | Chairis | 64 dr |
| Ringhallenpflaster | Gorgias | 821 dr (einschl. Sekos-Wände außen) |
| Kannelieren Säulen | Marsyas | 1336 dr (einschl. Cella Säulen) |
| Gebälk | ?? | (230 oder 300
 dr ?)3 dr ?)3 |
| Rampe | Mnasillos (?) | 4320 dr einschl. Material4 |
| Kernbau: | ||
| Fundamente | Antimachos | 1485 dr (einschl. Material
 Transport) Transport) |
| Wände | NN aus Argos | 3200
 dr dr |
| Fundamentierung Pflasterung wie oben RH Lysikrates5 | ||
| Platten versetzen wie oben RH Erechtimos | ||
| Bossen abarbeiten / Schleifen: | ||
| Wände innen (Cella) | Kleandridas | 550 dr |
| Wände innen (Pronaos) | Thimasitheos | 265 dr |
| Wände außen | Gorgias | (s. oben Auftrag Ringhalle) |
| Kannelierung Säulen | Marsyas | (s. oben Auftrag Ringhalle) |
| Pflasterung Kernbau | Kallis | 150 dr |
| Stuckierungen | Philargos | 615 dr |
Tab. 2.2: Asklepiostempel in Epidauros, Arbeiten in Stein auf dem Bauplatz (ohne Bauplastik).
1Nur die Sima war aus pentelischem Marmor gearbeitet, weswegen sie offenbar nicht in den Auftrag an Sotadas eingeschlossen war. In dem Vertrag ist zwar ausdrücklich nur von der Giebelsima, nicht aber von der Traufsima mit den Löwenköpfen die Rede, dennoch schloß der Vertrag wahrscheinlich die Traufsima mit ein. Dies nicht nur, weil kein separater Vertrag für die Traufsima genannt wird, sondern auch, weil der Vertrag die Antefixe einschließt, die nur an der Traufe vorkommen. 2Ich nehme an, dass Erechtimos die Pflasterung von Peristase und Kernbau übernommen hat, weil in der betreffenden Zeile 51 Naos steht, was in der Inschrift den gesamten Tempel meint (vgl. Z. 46. zum Dach), während der Kernbau (genauer: die Cella) als Sekos bezeichnet wird. 3Es ist nicht zu erkennen, wer die Oberflächen des Gebälks bearbeitet hat. Da die schon erwähnten beiden nahezu unleserlichen Verträge fast unmittelbar vor dem Auftrag für die enkaustische Bemalung des Gebälks stehen, die die Endbearbeitung der Flächen des Gebälks voraussetzt, unterstelle ich, dass einer dieser beiden Verträge die Entbearbeitung des Gebälks bestimmte. Dem würden auch die noch erkennbaren Leistungspreise dieser Verträge entsprechen (230 bzw. 300 (?) dr). 4Dass Mnasillos die Rampe gebaut hat, geht nicht aus seinem Vertrag hervor, sondern dass er das Brechen und Anliefern des Steinmaterials für die Rampe (und für die Pflasterung) übernommen hatte. Der Preis ist jedoch mit 4320 dr so außerordentlich hoch, dass hier angenommen wird, dass in den Vertrag das Versetzen und Endbearbeiten der Steine der Rampe eingeschlossen war. 5Ich nehme hier an, dass der Auftrag an Lysikrates die Fundamentierung für die Pflasterung von Ringhalle und Kernbau betraf, analog zu dem Vertrag mit Erechtimos über die Pflasterung selbst (vgl. die Anm. dazu oben).
Tab. 2.2: Asklepiostempel in Epidauros, Arbeiten in Stein auf dem Bauplatz (ohne Bauplastik).
1Nur die Sima war aus pentelischem Marmor gearbeitet, weswegen sie offenbar nicht in den Auftrag an Sotadas eingeschlossen war. In dem Vertrag ist zwar ausdrücklich nur von der Giebelsima, nicht aber von der Traufsima mit den Löwenköpfen die Rede, dennoch schloß der Vertrag wahrscheinlich die Traufsima mit ein. Dies nicht nur, weil kein separater Vertrag für die Traufsima genannt wird, sondern auch, weil der Vertrag die Antefixe einschließt, die nur an der Traufe vorkommen. 2Ich nehme an, dass Erechtimos die Pflasterung von Peristase und Kernbau übernommen hat, weil in der betreffenden Zeile 51 Naos steht, was in der Inschrift den gesamten Tempel meint (vgl. Z. 46. zum Dach), während der Kernbau (genauer: die Cella) als Sekos bezeichnet wird. 3Es ist nicht zu erkennen, wer die Oberflächen des Gebälks bearbeitet hat. Da die schon erwähnten beiden nahezu unleserlichen Verträge fast unmittelbar vor dem Auftrag für die enkaustische Bemalung des Gebälks stehen, die die Endbearbeitung der Flächen des Gebälks voraussetzt, unterstelle ich, dass einer dieser beiden Verträge die Entbearbeitung des Gebälks bestimmte. Dem würden auch die noch erkennbaren Leistungspreise dieser Verträge entsprechen (230 bzw. 300 (?) dr). 4Dass Mnasillos die Rampe gebaut hat, geht nicht aus seinem Vertrag hervor, sondern dass er das Brechen und Anliefern des Steinmaterials für die Rampe (und für die Pflasterung) übernommen hatte. Der Preis ist jedoch mit 4320 dr so außerordentlich hoch, dass hier angenommen wird, dass in den Vertrag das Versetzen und Endbearbeiten der Steine der Rampe eingeschlossen war. 5Ich nehme hier an, dass der Auftrag an Lysikrates die Fundamentierung für die Pflasterung von Ringhalle und Kernbau betraf, analog zu dem Vertrag mit Erechtimos über die Pflasterung selbst (vgl. die Anm. dazu oben).
Die Arbeiten in Stein sind demnach von der Baukommission in sechzehn Aufträge aufgeteilt worden und an mindestens dreizehn verschiedene Unternehmer – zum Teil wohl auch selbständige Handwerker – vergeben worden, von denen lediglich einem einzigen zwei Aufträge übertragen wurden (Antimachos
Die Unternehmer bildeten keine Arbeitsgemeinschaft, sondern blieben rechtlich selbständig, wie sich auch daran zeigt, dass jeder von ihnen für seinen Vertrag eigene Bürgen zu stellen hatte. Es gab folglich keine Gesamtverantwortung für den Bau gegenüber dem Bauherrn, wie im Übrigen auch die Regressforderungen bestätigen, die stets an einzelne Unternehmer gerichtet waren.354 Die Unternehmer können auch nicht als temporäre oder projektbezogene Einheit angesehen werden, denn keiner von ihnen war von Anfang bis Ende an dem Projekt tätig. Viele von ihnen dürften sich sogar kaum je begegnet sein, da fast355 alle weniger als ein Jahr im Heiligtum arbeiteten, wie aus der Jahresgliederung der Abrechnungen hervorgeht. Eine einheitliche, lokale Handwerkstradition schließlich ist auch nicht anzunehmen, da die Unternehmer aus mindestens drei verschiedenen Poleis kamen (neben Epidauros
Es macht folglich schon unter diesen Aspekten keinen Sinn, den Asklepiostempel als Werk einer ‚Bauhütte‘ anzusprechen, womit sich weitergehende Fragen nach Herkunft, Traditionen, Werken dieser Bauhütte gar nicht erst stellen. Hinzukommt aber noch ein weiterer Aspekt. Selbst wenn man die organisatorische, finanzielle und rechtliche Selbständigkeit der verschiedenen Bauunternehmer vernachlässigen würde und sie als temporäre Einheit verstehen wollte, könnte man man Tempel dennoch nicht als Werk dieser ‚Bauhütte‘ verstehen, denn dafür fehlt ihr der entscheidende Mann: der Architekt. Die Handwerker und der Architekt bilden keine Einheit, deren Arbeit vom Architekten geleitet und verantwortet wird. Das zeigt sich auf formaler wie organisatorischer Ebene gleichermaßen.
Es ist also nicht ein Architekt, der „Steinmetzen und Bildhauer (…) um sich scharte“357, vielmehr schreibt die Kommission Werkaufträge aus und vergibt sie an die Unternehmer, die der Kommission gegenüber haften. Es ist durch die Abrechnung von Reisespesen bekannt, dass Mitglieder der Kommission zur Auftragsvergabe teilweise in andere Städte reisten. Steinmetzen und Bildhauer werden auf Werkvertragsbasis von der Kommission ausgewählt, die auch den Architekten im Zeitlohn anstellt oder zum besoldeten Mitglied wählt.
Durch die Inschrift ist bekannt, dass der bauleitende Architekt, Theodotos
Ohne feste Verbindung zwischen den ausführenden Handwerkern und dem entwerfenden Architekten ist die Suche nach für die Bauhütte charakteristischen Entwurfs- und Handwerkstraditionen gegenstandslos. Entsprechende Fragen könnten mithin nur getrennt gestellt werden in dem Sinne, dass einerseits die Architekturtradition zu bestimmen wäre, der der Entwurf des Asklepiostempels zuzuordnen wäre, und andererseits nach handwerklichen Besonderheiten gefragt werden könnte, die auf die Beteiligung eines der Unternehmer an einem anderen Bau hinweisen würden.
Die Tatsache, dass der Asklepiostempel von der Kommission zweifelsfrei nicht an eine Bauhütte vergeben wurde, sondern in einzeln vergebene Bauabschnitte zerlegt wurde, könnte man damit zu erklären versuchen, dass in der Nordost-Peloponnes
Der Bau360 wäre an sich für eine Bauhütte prädestiniert gewesen, denn seine riesigen Dimensionen hätten eine Bauhütte über Generationen auslasten können. Damit hätte auch bereits bei Baubeginn gerechnet werden können, denn mit einer Stylobatlänge von 109,34 m und 120 ionischen Säulen, die rund 20 m hoch waren, gehörte der Bau zu den größten griechischen Tempelbauprojekten, von denen die wenigsten jemals vollendet worden sind. Tatsächlich ist auch – mit großen Unterbrechungen – mehr als vierhundert Jahre auf der Baustelle gearbeitet worden, ohne dass der Tempel jemals fertig geworden ist.361
Über die Bauarbeiten berichten einige in umfangreichen Teilen erhaltene Abrechnungsinschriften der Baukommission, die aus dem 3. und 2. Jh. stammen.362. Sie zeigen zunächst, dass auf der Baustelle Tempelsklaven tätig waren. Sie werden meist als ‚Kinder des Gottes‘ bzw. ‚heilige Kinder‘363, oder später auch einfach als τοῦ θεοῦ σωμάτων (‚Leib(eigene) des Gottes‘)364 bezeichnet. Ein Teil von ihnen waren qualifizierte Bauhandwerker, die in Marmor arbeiteten (Leukoourgoi). Andere waren Steinbrucharbeiter, Maultiertreiber beim Steintransport oder Hilfskräfte. Sie waren offenbar in mindestens zwei Hauptgruppen eingeteilt, für die verschiedene Leiter namentlich genannt werden. Die größte dieser Gruppen, die man in den Inschriften ausmachen kann, hatte 15 Arbeiter. Insgesamt könnten etwa 30–40 Tempelsklaven am Bau gearbeitet haben. Die Arbeitsleistung der Tempelsklaven wurde jährlich von der Baukommission dokumentiert und veröffentlicht. Sie wurden den Dokumenten zufolge hauptsächlich, aber keineswegs ausschließlich, beim Bau des Apollontempels eingesetzt.
Eine der zu größeren Teilen erhaltenen Urkunden, die die Arbeiten für das Jahr 219/8 dokumentiert,365 zeigt allerdings eine doppelte Struktur der Organisation. Der eine Teil der verzeichneten Arbeiten wurde von Tempelsklaven erbracht, der andere Teil von mindestens zwölf Unternehmern, von denen wenigstens einer eine vergleichsweise große Kolonne von vierzehn Handwerkern beschäftigte. Die Aufteilung der Arbeiten spiegelt die vollkommen verschiedene Rechtsstellung der Arbeiter in keiner Weise wider, im Gegenteil: Sie arbeiteten teilweise Seite an Seite, wie daraus hervorgeht, dass innerhalb derselben Reihe großer Wandquader die einzelnen Blöcke abwechselnd von den Sklaven und den Arbeitern der Unternehmer versetzt wurden.366
Möglicherweise galt diese doppelte Struktur auch für die Architekten. Unter den überlieferten Namen findet sich neben dem Milesier Daphnis
Am Didymaion gab es folglich eine Bauhütte in dem Sinne, dass es mit den Tempelsklaven eine fest dem Bau zugeordnete Gruppe von zumindest teilweise qualifizierten Handwerkern gab, die wahrscheinlich von einem Architekten, der ebenfalls Tempelsklave war, geleitet wurde. Die Situation am Didymaion ist allerdings insofern singulär unter den Bauprojekten, über die sich Informationen erhalten haben, als nur hier die Tempelsklaven an den Bauarbeiten einen nennenswerten Anteil hatten, wohingegen in anderen Heiligtümern (z. B. Delphi
2.8 Arten des Wissens und Wissensentwicklung
2.8.1 Wissensformen und Tradierung
Über die griechische Architektur gab es in der Antike eine offenbar umfangreiche Fachliteratur.368 Vitruv
Neben der Fachliteratur gab es ‚populäre‘ Texte, die ganz oder überwiegend Architektur behandelten, aber nicht von Architekten geschrieben wurden. Auch hiervon ist nur wenig überliefert. Schließlich gibt es kursorische Angaben zu Bauten bei verschiedenen Schriftstellern. Im hier behandelten Kontext von Bedeutung sind vor allem einige Passagen aus der naturalis historiae von Plinius
2.8.2 Architekturschriften
Was über diese Schriften bekannt ist, beruht zum überwiegenden Teil auf Angaben bei Vitruv
2.8.3 Die verlorenen Schriften
Anders als in späteren Epochen sind die griechischen Bücher über Architektur, soweit bekannt, ausschließlich von praktisch tätigen, häufig prominenten Architekten geschrieben worden: Vitruv
Die Publikationstätigkeit der Architekten setzt damit nur etwa zwei Generationen nach den Anfängen der monumentalen Steinarchitektur in Griechenland
Inhalt
Vitruv
Die bereits erwähnte Schrift von Chersiphron
„Er fügte vier vierzöllige Holzbalken, davon zwei Querhölzer so lang wie die Säulenschäfte, zusammen und verkämmte sie miteinander. In die Enden der Säulenschäfte führte er mit Bleiverguß starke Eisenzapfen wie Spindeln ein. In das Holzgerüst fügt er eiserne Ringe ein, die die Eisenzapfen umschließen sollten. Ebenso verband er die Enden mit hölzernen Backenstücken. Die Eisenzapfen aber, in die Ringe eingelassen, bewegten sich ganz frei.“382
Sodann beschreibt Vitruv
Plinius
Die hier angeführten Textpassagen beider römischen Autoren enthalten zu einem erheblichen Teil Informationen über den Bauprozess, die am fertiggestellten Bau niemals nachträglich hätten gewonnen werden können. Insbesondere die technischen Detailinformationen zu Chersiphrons
Dass mindestens ein Teil der älteren Architekturschriften selbst in späterer Zeit noch im Original vorhanden war, beweist das einzige wörtliche Zitat, dass aus einer dieser Schriften heute noch erhalten ist. Pollux
ἐν γοῦν τῇ τοῦ νεὼ ποιήσε, ἣν ἢ Φίλων ἢ Θεόδωϱο(?)συνέθηκ, γέγϱαπτα κυνδάλους δὲ ἐχέτω ζυγὸν ἕκαστο.
Zum Beispiel steht in der Schrift über den Tempelbau, die Philonoder Theodoros verfaßt hat: ‚Nägel soll ein jedes Querholz haben‘. (Übers. Svenson-Evers)
Der Kontext des Zitats ist nicht mehr rekonstruierbar – gemeint sein könnte, dass die Dachlatten, auf die die Ziegel aufgelagert wurden, auf den sie tragenden Sparren vernagelt werden sollten. Als Autor infrage kommen drei Architekten, von denen Vitruv
Die obigen Exzerpte und das Zitat implizieren zunächst, dass in den monographischen commentarii offenbar nicht nur Entwurfsfragen, sondern auch bautechnische Fragen behandelt wurden. Anlass dazu war bei Chersiphron
Das Pollux
Nutzen – Zweck – Motive
Was war nun der Zweck dieser Schriften, wozu sollten sie dienen? Die Frage ist fast gleichbedeutend mit der Frage danach, welche Leser die schreibenden Architekten vor Augen hatten. Würde man sie näher bestimmen können, ergäbe sich zugleich auch eine Antwort auf die Frage nach den Motiven, die die Architekten zum Publizieren animierten. Das Material, das man im Zusammenhang dieser Fragen verwenden kann, ist sehr wenig, aber immerhin finden sich einige verstreute Hinweise.
Geht man zunächst einfach vom Inhalt der Schriften aus, also von der Darstellung von bautechnischem Wissen und gestalterischen Auffassungen und Verfahren, dann wären die Adressaten der Texte diejenigen, die solches Wissen benötigten, also die praktisch tätigen Architekten und diejenigen, die den Beruf erlernen wollten. So nahe dieser Gedanke auch liegt, belegen lässt er sich nur durch eine einzige Quelle:
In einem in den Memorabilia des Xenophon
Gegen die Deutung, dass mit den Schriften, die ein angehender Architekt zu studieren hatte, Architekturschriften gemeint sind, ließe sich zwar einwenden, dass an der Stelle nicht explizit von den Schriften der Architekten die Rede ist, sondern allgemeiner von Schriften ‚anerkannt kompetenter Autoren‘, und dass Sokrates’
Der Leserkreis, den die Architekten mit ihren Texten erreichten, war aber sicher nicht auf die angehenden Architekten – und, so darf man wohl ergänzen, die bereits praktisch tätigen Architekten – beschränkt, wie sich zunächst wiederum an der zitierten Passage zeigen lässt. Euthydemos
Es gibt einen Anhaltspunkt, wo die Motive der Architekten zu suchen sein könnten, um deretwillen sie Schriften veröffentlichten, die nicht ausschließlich an Fachkollegen gerichtet waren. Es lässt sich zeigen, dass Architekten ein Interesse daran hatten, ein selbst entworfenes Bauwerk auch auf Dauer mit dem eigenen Namen zu verbinden. Dieses Interesse manifestierte sich vereinzelt in der Weise, dass Architekten ihre Bauten durch Inschriften ‚signierten‘ , wie beispielsweise schon für den frühesten Steintempel Siziliens
2.8.4 Philon von Byzanz
Philon
Philon war im Sinne der sich – allerdings erst später verfestigenden – griechischen Terminologie μηχανοποιόϛ (‚Maschinenbauer‘, Ingenieur). Zu seiner Zeit waren die Bezeichnungen Architekt/Ingenieur hingegen noch nicht klar getrennt, denn er selbst bezeichnet zwar im 7. und 8. Buch den Leiter des Befestigungsbaus stets als μηχανοποιόϛ und nie als Architekten, doch bezeichnet er umgekehrt bei Geschützbau den Konstrukteur mehrfach als Architekten392 und nie als μηχανοποιόϛ, also als Ingenieur. Ob Philon
Der Gegenstand des 7. Buches παϱαοκευαοτικά sind die ‚Einrichtungen‘, die für die Verteidigung einer belagerten Stadt von ihm für erforderlich gehalten wurden. Sie umfassen das gesamte Spektrum der zu treffenden Maßnahmen, von der Bewaffnung der Bürger auf Staatskosten über die Behandlung der Verletzten unter den (mit kommentarloser Selbstverständlichkeit vorausgesetzten) Söldnertruppen bis hin zu den Techniken der Kommunikation der Eingeschlossenen mit einem heranrückenden Entsatzheer. Was unter solchen Vorbereitungen bauliche Maßnahmen betrifft, wird teilweise detailreich dargestellt, wie etwa die Vorbereitung der in der Nähe der Stadtmauern liegenden Privathäuser auf einen Straßenkampf mit eindringenden Feinden, oder auch die Anlage von Getreidespeichern, die so beschaffen sein müssen, dass die zu konservierenden Vorräte auch bei lang andauernder Belagerung nicht verfaulen. Innerhalb dieses sehr breiten Themenspektrums ins Zentrum gestellt sind die militärtechnischen Fragen der Verteidigung. Hintergrund ist erkennbar der enorme Fortschritt der Belagerungs- und Geschütztechnik im frühen Hellenismus, für den die Belagerung von Rhodos
Als Beispiel für die Architekturdarstellung in diesem Text ist im folgenden die Beschreibung eines Getreidespeichers zitiert.393 Der Speicherbau ist der einzige Gebäudetypus jenseits der Stadtmauern, der von Philon
„Sobald die Grundmauern des zu erbauenden Gebäudes errichtet sind, soll in halber Dicke und gleicher Höhe ein Halbkreis hergestellt werden. Und von diesem ab soll man mit Zwischenräumen von je 3 Ellen (1,32 m) auf beiden Wänden Gewölbebogen aus Quadern aufbauen. Ihre Dicke soll 2 Ellen (0,88,7) betragen: wenn zwei Steine auf die Grundmauern gesetzt sind, so sollen die Bögen eine Elle dick (0,4425) ausgeführt werden. Nach der Breite sollen sie 2ellig (0,88,35) gemacht werden. Dieses Gewölbe soll aus behauenen oder möglichst großen Bruchsteinen zusammengefügt sein, um die Belastung (des Schüttbodens) tragen zu können. Sind dann die Bogen geschlossen, sind die Umfassungsmauern auf den Grundmauern gerade aufzubauen, der Zwischenraum zwischen den Bogen mit Ziegeln auszufüllen, so dass das Bauwerk in gleicher Höhe der Bogen viereckig wird. Sodann lege man auf die Zwischenräume der Gewölbebogen stärkste Balken und darüber Rohr und verschmiere es bestens (als Schüttboden). Und wenn man in dieser Decke einen Schüttboden erbauen will, so errichte man darüber ein Ziegeldach aus Balken und aufgelegten Sparren und verschmiere es bestens. Will man aber nicht so bauen, so mache man den Bau zusammenhängend als Gewölbe, und man wird nicht Längsbalken nötig haben.“
Auch wenn nicht jede Formulierung am Anfang der Textpassage eindeutig interpretierbar ist, so lässt sich über die Konstruktion doch folgendes sicher sagen: Es handelt sich um einen Schüttboden, d. h. um ein Gebäude, bei dem Getreide in einem Raum aufgespeichert wird, dessen Boden deutlich über der ebenen Erde liegt. Der Grund dafür ist, dass das Getreide auf diese Weise nicht in Kontakt mit der Bodenfeuchte kommt, was zu Fäulnis führen würde. Die Aufgabe für den Architekten ist daher, eine massive Unterkonstruktion für den Boden des Lagerraums zu schaffen, denn ein einfacher Bretterboden auf Balken würde das Gewicht nicht tragen können, da Getreide ein zu hohes spezifisches Gewicht hat (ca. 750 kg pro qm). Philon
Philon gibt sehr wenig Details an. Die für die Stabilität der Konstruktion entscheidenden Daten gibt er in absoluten Maßen an, und zwar in Ellen, nicht in Fuß wie bei modernen Entwurfsanalysen. Die angegebenen Maße sind aber sofort als einfache Proportionen erkennbar: Fundamentebreite zu Außenwandbreite zu Gewölbestärke wie
 ; Breite der Bogen zu Abstand der Bogen wie
; Breite der Bogen zu Abstand der Bogen wie
 . Für die Konstruktion der Bogen führt er zwei alternative Bauweisen (Quader und Bruchstein) an.
. Für die Konstruktion der Bogen führt er zwei alternative Bauweisen (Quader und Bruchstein) an.
Die Textpassage gibt folglich Anweisungen für einen bereits fachlich qualifizierten Baumeister. Sie hat also nicht den Charakter eines elementaren Lehrbuchestextes. Interessant ist, dass Philon
Von Interesse ist im Zusammenhang mit den verlorenen Architekturschriften noch eine weitere Passage aus dem Abschnitt über Getreidespeicher:
„Damit der Bau in schönem Formverhältnis, symmetrisch in der Höhe zur Länge werde, nimm, wenn auch die Fundamente beliebig groß zugrunde gelegt sind, die Höhe der Bogen von den Fundamenten ab so groß, wie ich Dir angab. Wenn Du aber zum Türsturz weder einen Monolith noch einen Holzbalken wählst, damit er nicht angezündet werden könne, so mache den Eingang so groß wie Du willst, und fülle (ihn) mit Ziegeln aus. Dann lege von oben gehauene, abgeschrägte Steine teils links, teils rechts darauf, sodann mache mit einem oben breiten, unten schmalen Steine, den Du wie einen Keil einfügst, den Abschluss in der Mitte. Ist dies fertig, so nimm die in dem Durchgang eingesetzten Ziegel wieder heraus, denn es wird fest bleiben. Auch beim Festungsbau bewährt sich dies, wenn man die Tore anstatt mit Gewölben auf diese Art bauen will.“
Philon beschreibt im letzten Teil dieser Passage ein Kragsteingewölbe mit Schlussstein als Alternative zum Türsturz aus einem Stein- oder Holzbalken. Erstaunlich daran ist, dass er hier viel genauer ist als bei der oben angesprochenen Gewölbekonstruktion, obwohl das Kragsteingewölbe konstruktiv einfacher, und baugeschichtlich auch älter ist als der Keilsteinbogen. Hier geht er zudem auch auf das erforderliche Lehrgerüst ein, für das er keine Holzkonstruktion vorschlägt, die auch viel komplizierter wäre, sondern einfach ein Verfüllen der zu überdeckenden Öffnung mit Lehmziegeln. (Gebrannte Ziegel bzw. Backsteine waren zu Philons
2.8.5 Populäre Literatur
In der Antike gab es offenbar auch eine ‚populäre‘ Literatur über Architektur, deren Autoren nicht selbst Architekten waren, beim Schreiben ihrer Texte aber möglicherweise auf Schriften von Architekten zurückgriffen.
Zu dieser Gattung dürfte etwa die – verlorene – Schrift eines Demokrit
Populäre Literatur über Architektur waren auch die sogenannten ‚Weltwunder‘-Kataloge, da zu den Weltwundern neben Werken der bildenden Künste hauptsächlich Bauwerke gezählt wurden wie die Stadtmauer von Babylon
Diese Schriften sollten der ‚paideia‘ ihrer Leser dienen. Dieser Begriff meint einerseits Bildung: Dem Leser sollte eine Anschauung von den bedeutendsten kulturellen Leistungen vermittelt werden, die persönlich aufzusuchen ihm nicht möglich war. In dem umfangreichsten der erhaltenen Texte, der in den Handschriften mit ‚Philon
Die oben angesprochene Möglichkeit, dass Autoren populärer Schriften Kenntnisse der Architekturschriften hatten, ist im Fall der zitierten Schrift über die Weltwunder etwas leichter zu beantworten als im Fall des Demokrit. Der Autor der ‚Weltwunder‘-Schrift schrieb zwar über zwei Bauten, von denen bekannt ist, dass über sie Schriften der Architekten existiert haben: das Mausoleum von Halikarnass
„Der Künstler nämlich lockerte das darunter liegende Erdreich und führte so die Ausschachtungen in unermeßliche Tiefen hinab; dort setzte er dann das Fundament aus behauenem Stein, wobei er ganze Steinbrüche in den Bergen für das unter der Erde Verborgene seiner Werke aufbrauchte.“397
2.8.6 Architektur und Wissenschaft
Überraschend ist vor diesem Hintergrund, dass man bei den griechischen Mathematikern selbst, soweit erhalten, keine Bezugnahme auf die Architektur findet. Euklid
Wenn man die wissenschaftlichen Fähigkeiten der Architekten durch die Proportion
durch die Proportion
 die Größe
die Größe
 bestimmt wird, aus
bestimmt wird, aus
 wiederum durch die Proportion
wiederum durch die Proportion
 die Größe
die Größe
 usw. Solche Proportionsketten führen im allgemeinen sehr schnell zu Brüchen mit sehr großen Nennern, und damit zu sehr komplexen Zahlenwerten, die nur schwer innerhalb von antiken Maßsystemen darstellbar sind.
usw. Solche Proportionsketten führen im allgemeinen sehr schnell zu Brüchen mit sehr großen Nennern, und damit zu sehr komplexen Zahlenwerten, die nur schwer innerhalb von antiken Maßsystemen darstellbar sind.
Man kann die angesprochene Komplexität an antikem Quellenmaterial selbst demonstrieren. Vitruv
| Gliederung der Architravhöhe (AH) bei Gesamthöhe 2 Fuß | ||
| Höhe des Abschussprofils: | AH

 |
= 0,2857 Fuß |
| Gesamthöhe der drei Faszien: | AH

 |
= 1,7142 Fuß |
| Höhe der oberen Fazie: | AH



 |
= 0,7142 Fuß |
| Höhe der mittleren Fazie: | AH



 |
= 0,5712 Fuß |
| Höhe der unteren Fazie: | AH



 |
= 0,4258 Fuß |
Es ist evident, dass solche Werte nicht glatt darstellbar waren in einem Fußmaß, das in sechzehn Daktyloi unterteilt ist. Zum selben Ergebnis kommt man im Übrigen schon, wenn man bekannte Proportionen für das Verhältnis von Breite zu Höhe der Triglyphen wie
 in einem antiken Fußmaß angeben will, da die sechzehn Daktyloi des Fußes sich nicht ohne Rest durch fünf teilen lassen. J. J. Coulton hat aus dieser Problematik, die sich stets ergibt, wenn Werte sukzessive durch Proportionen von einander abgeleitet werden, ebenso wie D. Mertens und H. Knell, zwei Schlussfolgerungen gezogen: Erstens wird angenommen, dass die griechischen Architekten im Umgang mit Bruchrechnung vertraut waren, und dass zweitens die sich bei exakter Rechnung ergebenden, stark gebrochenen Werte gerundet worden wären auf Maße, die auf der Baustelle realisierbar waren.403
in einem antiken Fußmaß angeben will, da die sechzehn Daktyloi des Fußes sich nicht ohne Rest durch fünf teilen lassen. J. J. Coulton hat aus dieser Problematik, die sich stets ergibt, wenn Werte sukzessive durch Proportionen von einander abgeleitet werden, ebenso wie D. Mertens und H. Knell, zwei Schlussfolgerungen gezogen: Erstens wird angenommen, dass die griechischen Architekten im Umgang mit Bruchrechnung vertraut waren, und dass zweitens die sich bei exakter Rechnung ergebenden, stark gebrochenen Werte gerundet worden wären auf Maße, die auf der Baustelle realisierbar waren.403
Ich möchte hier zunächst eine alternative Deutung dafür vorschlagen, wie die Architekten die aus den Proportionsketten resultierenden Maße gehandhabt haben, die wesentlich einfacher und direkter ist als das Rechnen mit komplexen Brüchen, und die zudem die angenommene Rundung rechnerisch bestimmter Werte überflüssig macht. Nach meiner Auffassung wurden die proportionale Ableitung vieler Strecken jenseits der Hauptmaße der Grundrisse überhaupt nicht berechnet, und auch nicht in Fuß und Daktylen angegeben, sondern durch Ritzzeichnungen mit Lineal und Zirkel graphisch bzw. geometrisch bestimmt. Die so gefundenen Größen wurden anschließend von den ausführenden Handwerkern mit dem Stechzirkel direkt von dem entsprechenden Riss abgegriffen und bei der Ausarbeitung der Werkstücke verwendet. Für die nachfolgend beschriebene Vorgehensweise ist es völlig gleichgültig, ob die zu ermittelnden Strecken bei rechnerischer Bestimmung und Darstellung in Fuß und Daktyloi einfache oder komplexe Werte ergeben würden. Außerdem war sie mit Sicherheit in der Antike bekannt, denn sie folgt genau der Methode, die Euklid
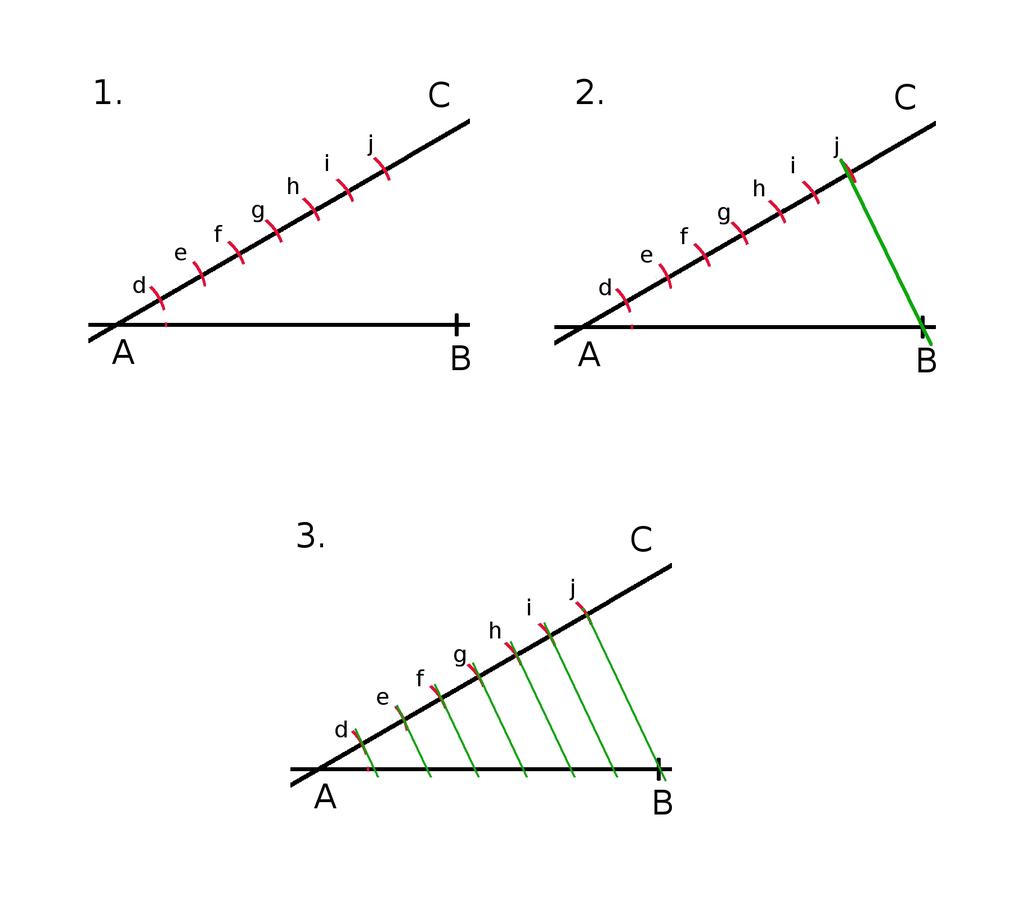
Abb. 2.25: Teilung einer Strecke in gleich lange Abschnitte, entsprechend Euklid, Elemente, Buch VI, Proposition 9 (W. Osthues).
Die zu teilende Strecke – also etwa die Architravhöhe bei Vitruv aufgetragen (Abb. 2.25), und anschließend mit gleicher oder größerer Länge die Strecke
aufgetragen (Abb. 2.25), und anschließend mit gleicher oder größerer Länge die Strecke
 , die
, die
 in beliebigem Winkel bei
in beliebigem Winkel bei
 schneidet. Danach wird auf
schneidet. Danach wird auf
 mit dem Zirkel sieben Mal die gleiche, beliebig lange Teilstrecke abgetragen, wodurch sich die Punkte
mit dem Zirkel sieben Mal die gleiche, beliebig lange Teilstrecke abgetragen, wodurch sich die Punkte
 bis
bis
 ergeben (Bild 1 auf der Abb. 2.25). Dann wird mit dem Lineal eine Gerade gezeichnet, die
ergeben (Bild 1 auf der Abb. 2.25). Dann wird mit dem Lineal eine Gerade gezeichnet, die
 mit
mit
 verbindet (Bild 2). Diese neue Strecke wird anschließend parallel verschoben, so dass die zusätzlichen Parallelen jeweils
verbindet (Bild 2). Diese neue Strecke wird anschließend parallel verschoben, so dass die zusätzlichen Parallelen jeweils
 bis
bis
 schneiden (Bild 3). Diese Parallelen teilen die Ausgangsgerade
schneiden (Bild 3). Diese Parallelen teilen die Ausgangsgerade
 in sieben gleich lange Abschnitte, die mit dem Stechzirkel aus der Zeichnung abgegriffen und auf das Werkstück übertragen werden können.
in sieben gleich lange Abschnitte, die mit dem Stechzirkel aus der Zeichnung abgegriffen und auf das Werkstück übertragen werden können.
Auf diese Weise lässt sich die sukzessive Teilung von Vitruv
Die vorgeschlagene Methode entspricht dem Muster, das auch Vitruv
Differenzierter dürften die Kenntnisse im Bereich der Geometrie zu beurteilen sein. Das Spektrum dürfte von der korrekten geometrischen Konstruktion bis hin zu rein pragmatischen Verfahrensweisen gereicht zu haben. Schon in sehr früher Zeit wurden korrekte geometrische Verfahrensweisen angewandt: Hingewiesen sei hier nur auf die Sechsteilung des Kreises auf einer Platte des älteren Aphaiatempels, die oben schon im Abschnitt über Bauzeichnungen erwähnt wurde. Ebenfalls dort erwähnt wurde die Grundrisskonstruktion der Tholos405 in der Marmaria in Delphi
Man kann darüber hinaus mit guten Gründen annehmen, dass auf den Baustellen auch noch sehr viel simplere, kaum mehr geometrisch zu nennende Verfahren benutzt worden sind. Darauf lässt jedenfalls die seit frühester Zeit nachweisbare Ausstattung dorischer Säulenschäfte mit zwanzig Kanneluren schließen. Geometrisch möglich wäre es, für die zwanzig Kanneluren zunächst ein Pentagramm zu konstruieren, dessen fünf 72°-Winkel durch zweifache Winkelhalbierung in die geforderten 18°-Winkel aufgeteilt werden könnten – also ähnlich, wie oben für die Tholos in Delphi
Die hier bisher dargestellten Anhaltspunkte lassen insgesamt nicht darauf schließen, dass die Architekten im Bereich Arithmetik oder auch der Geometrie Kenntnisse hatten, die über ein fortgeschrittenes ‚Schulwissen‘ hinausgehen würden. Diese Einschätzung steht in offenem Widerspruch zu den eingangs zitierten Aussagen von Strabon
Ein Beispiel dafür ist der hier schon mehrfach angesprochene Philon ) in Abhängigkeit vom Geschossgewicht (M) lautet:
) in Abhängigkeit vom Geschossgewicht (M) lautet:
Philon
Das obige Zitat von Strabon
Siglen und abgekürzt zitierte Werke
| Byzas | Veröffentlichungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Istanbul. Ege Yayınları, 2005–. |
| CAH | The Cambridge Ancient History, 2. Aufl., 14 Bde., Cambridge: Cambridge University Press (1970 – 2005). |
| DNP | Hubert Cancik, Helmuth Schneider, Hrsg. (2003). Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike. Das klassische Altertum und seine Rezeptionsgeschichte, Stuttgart: J. B. Metzler. |
| HGiÜ | Brodersen, K., Günther, W., Schmitt, H. H. (1992–1999). Historische griechische Inschriften in Übersetzung. 3 Bde., Texte zur Forschung 59/68/71. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. |
| ID | Inscriptions de Délos. Paris: de Boccard [u.a.] (1923ff.). |
| IG | Inscriptiones Graecae, Berlin 1879ff. [Sammlung von antiken Inschriften des griechischen Festlands und der Inseln] |
| LSJ | „Liddell-Scott-Jones“. A Greek-English lexicon: With a revised supplement. Compiled by Henry George Liddell and Robert Scott. Revised and augmented throughout by Henry Stuart Jones with the assistance of Roderick McKenzie and with the cooperation of many scholars. 9. Aufl. Oxford: Clarendon Press (1996). |
| OGIS | Dittenberger, Wilhelm (1903–1905). Orientis Graeci Inscriptiones Selectae. 2 Bde. Leipzig. [Nachdruck Olms, Hildesheim 1986]. |
| RE | Pauly, A., Wissowa, G., Kroll, W., Witte, K., Mittelhaus, K. und Ziegler, K., Hrsg., (1894–1980). Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft: neue Bearbeitung. Stuttgart: J. B. Metzler. |
| SEG | Supplementum Epigraphicum Graecum, Leiden (1923ff). |
| SelectPapyri | Hunt, A. S. et. al. (1932 und 1934). Select Papyri, 2 Bde., Cambridge, Mass.; London: Loeb. |
Zeitschriften
| AA | Archäologischer Anzeiger, Deutsches Archäologisches Institut – Zentrale Berlin. |
| AJA | American Journal of Archaeology, Archaeological Institute of America. |
| AM | Athenische Mitteilungen, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung. |
| BSA | The Annual of the British School at Athens, British School at Athens. |
| BCH | Bulletin de correspondance hellénique, École Française d’Athènes. |
| JdI | Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Deutsches Archäologisches Institut – Zentrale Berlin. |
Antike Autoren
Antike Autoren und ihre Werke sind nach den international üblichen Abkürzungen zitiert, die nachfolgend aufgelöst sind. Die griechischen Originaltexte und englische Übersetzungen der angeführten Werke liegen – wenn hier nicht anders angegeben – in der Loeb Classical Library vor.
| Aen. Tact. | Aineias Taktikos |
| Poliorketika. Über die Verteidigung belagerter Stellungen. | |
| Aischin. | Aischines |
| – Ctes. | in Ctesiphontum/Gegen Ktesiphon. |
| Aristot. | Aristoteles |
| – Ath. Pol. | Athenaion Politeia/Der Staat der Athener |
| – Eth.Nikom. | ethica Nikomachea/Nikomachische Ethik |
| – oec. | oeconomica/Hauswirtschaft |
| – pol. | politica/Politik |
| – mech. | mechanica/Mechanik |
| Magna Moralia (Zuschreibung umstritten). | |
| Anakr. | Anakreon |
| fragmenta, in: Greek Lyric II, Loeb Classical Library, Harvard University Press (1989). | |
| Athen. | Athenaios |
| – deipn. | Deipnosophistae/ Das Gastmahl der Gelehrten. |
| Diod. | Diodorus Siculus |
| bibliotheca historica/Universalgeschichte. | |
| Diog. Laert. | Diogenes Laertios |
| de clarorum philosophorum vitis/Lebensbeschreibungen der Philosophen. | |
| Eukl. | Euklid |
| – elem. | elementa/Elemente |
| – opt. | Optica/Optik. |
| Heron | Heron von Alexandria |
| – bel. | Belopoica/Kriegsmaschinen. |
| Hdt. | Herodot |
| Historien. |
| Hom. | Homer |
| – Od. | Odyssee |
| – Il. | Ilias. |
| Is. | Isaeus |
| in Dicaeogenis hered./Über das Erbe des Dikaiogenes. | |
| Lys | Lysias |
| oratores/Gerichtsreden. | |
| Makk. | 1 Makkabäer, 2 Makkabäer |
| in: Dommershausen, Werner (1995). Die Neue Echter Bibel, 2. Aufl., Lfg. 12, Würzburg: Echter Verlag. | |
| Paus. | Pausanias |
| Graeciae descriptio/Beschreibung Griechenlands. | |
| Philo Mech. | Philon von Byzanz |
| belopoica Belopoika/Kriegsmaschinen (Buch IV der Mechanik) | |
| VII/VIII (Exzerpte aus:) Buch VII Paraskeuastika und VIII Poliorketika | |
| Griechischer Text mit deutscher Übersetzung in Diels and Schramm 1920. | |
| Plat. | Platon |
| – Gorg. | Gorgias |
| – Men. | Menon |
| – Phil. | Philebos |
| – pol. | Politeia/Der Staat. |
| Plin. | Plinius d. Ä. |
| – n. h. | naturalis historia/Naturgeschichte. |
| Plut. | Plutarch |
| – Them. | Themistokles |
| – Cato mai. | Cato maior |
| – Per. | Perikles |
| – mor. | Moralia. |
| Poll. | Iulius Pollux |
| onomasticon/‚Lexikon‘. | |
| Polyain. | Polyaions |
| – strat. | strategemata/Kriegslisten |
| Polyb. | Polybios |
| historiae/Geschichte. |
| Strab. | Strabon |
| – geogr. | geographia/Erdbeschreibung. |
| Theophr. | Theophrastos von Eresos |
| – lap. | de lapidibus/Über die Gesteine |
| – h. plant. | historia plantarum/Naturgeschichte der Gewächse. |
| Thuk. | Thukydides |
| historiae/Der Peloponnesische Krieg | |
| Vitr. | Vitruv |
| De architectura, lat. Text mit deutscher Übersetzung bei Fensterbusch 1964. | |
| Xen. | Xenophon |
| – mem. | Memorabilia/Denkwürdigkeiten. |
Bibliographie
Adam, J.-P. (1973). Le temple de Héra II à Paestum. Revue Archéologique
- (1982). L’architecture militaire greque. Paris: Picard.
Adler, F., E. Curtius (1892). Olympia. Die Ergebnisse der von dem Deutschen Reich veranstalteten Ausgrabung. Bd. II. Die Baudenkmäler. Berlin: Asher.
Alcock, S. E. (1993). Graecia Capta: The Landscapes of Roman Greece. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Ameling, W. (2006). Antike Metropolen. Stuttgart: Theiss.
Andronikos, M. (1984). The Royal Tombs and the Ancient City. Athen: Ekdotike Athenon.
Baitinger, H., Th. Völling (2007). Werkzeug und Gerät aus Olympia. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
Bankel, H. (1993). Der spätarchaische Tempel der Aphaia auf Aegina. Berlin; New York: Walter de Gruyter.
Barletta, B. A. (2001). The Origins of the Greek Architectural Orders. Cambridge: Cambridge University Press.
Bauer, H. (1973). Korinthische Kapitelle des 4. und 3. Jhs. v. Chr.. Mainz: Philipp von Zabern.
Benndorf, O. (1902). Antike Baumodelle. Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Instituts 56: 175ff.
Berger, E. (1984). Parthenon-Kongress Basel. Referate und Berichte. Mainz: Philipp von Zabern.
Bingöl, O. (1980). Das ionische Normalkapitell in hellenistischer und römischer Zeit in Kleinasien. Tübingen: Wasmuth.
Blackman, D. J. (2008). Sea Transport, Part 2: Harbors. In: The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World Oxford: Oxford University Press 638-672
Blümner, H. (2004). Technologie und Terminologie der Gewerbe und Künste bei Griechen und Römern. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag.
Bommelaer, J.-F. (1997). Marmaria: Le sanctuaire d’Athéna à Delphes. Paris: E. de Boccard.
Bommelaer, J.-F., D. Laroche (nodate). Guide de Delphes: Le Site. Paris: E. de Boccard.
Borza, E. M. (1987). Timber and Politics in the Ancient World: Macedon and the Greeks. Proceedings of the American Philosophical Society 131: 32-52
Bringmann, K., H. von Steuben (1995). Schenkungen hellenistischer Herrscher an griechische Städte und Heilgtümer, Teil I. Zeugnisse und Kommentare. Berlin: Akademie Verlag.
Brodersen, K. (1992). Reiseführer zu den Sieben Weltwundern. Philon von Byzanz und andere antike Texte. Frankfurt a. M., Leipzig: Insel Verlag.
Brodersen, K., W. Günther (1992). Historische griechische Inschriften in Ubersetzung: Die archaische und klassische Zeit. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- (1999). Historische griechische Inschriften in Übersetzung: Der griechische Osten und Rom (250–1 v. Chr.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Brodersen, K., G. Wolfgang, G. W. (1996). Historische griechische Inschriften in Übersetzung: Spätklassik und früher Hellenismus (400–250 v. Chr.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Brödner, E. (1993). Wohnen in der Antike. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Bundgaard, J. A. (1957) Mnesicles: A Greek Architect at Work. phdthesis. Kopenhagen
Burckhardt, J. (2003). Vorträge, 1870–1892. München; Basel: C.H. Beck; Schwabe.
Burford, A. (1969). The Greek Temple Builders at Epidauros. A Social and Economic Study of Building in the Asklepian Sanctuary, during the Fourth and Early Third Centuries BC. Toronto: University of Toronto Press.
- (1971). The Purpose of Inscribed Building Accounts. In: Collectif Acta of the Fifth International Congress of Greek and Latin Epigraphy Oxford: Blackwell
- (1972). Craftsmen in Greek and Roman Society. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Burkert, W. (1963). A Note on Aeschylus, Choephori. Classical Quarterly 13: 177
Burmeister, E. (nodate). Antike griechische und römische Theater. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Busching, A. (2013). Das Dach des archaischen Panionion. Dachstuhl und DachhautB. Bonn: Habelt.
Caskey, L. D., H. N. Fowler, H.N. F., Paton H. N. (1927). The Erechtheum. Measured, Drawn and Restored by Gorham Phillips Stevens. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Cook, R. M., R. V. Nicholls (1998). Old Smyrna Excarvations. London: British School at Athens.
Cooper, F. A. (2008). Greek Engineering and Construction. In: The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World Ed. by P. Oleson. Oxford: Oxford University Press 225-255
Cooper, F. A., B. C. Madigan (1992). The Temple of Apollo Bassitas: In Four Volumes. Princeton, New Jersey: American School of Classical Studies at Athens.
Cotterell, B., J. Kamminga (1990). Mechanics of Pre-industrial Technology: An Introduction to the Mechanics of Ancient and Traditional Material Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
Coulton, J. J. (1974a). Lifting in Early Greek Architecture. Journal of Hellenic Studies 94: 1-19
- (1974b). Towards Understanding Doric Design: The Stylobate and Intercolumniations. BSA 69: 61-86
- (1976). The Architectural Development of the Greek Stoa. Oxford: Clarendon Press.
- (1977). Ancient Greek Architects at Work: Problems of Structure and Design. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- (1983). Greek Architects and the Transmission of Design. In: Architecture et société: De l’archaïsme grec à la fin de la République Romaine. Actes du colloque international 453-68
- (1985). Incomplete Preliminary Planning in Greek Architecture. Some New Evidence.. In: Le dessin d’architecture dans les sociétés antiques: Actes du Colloque de Strasbourg, 26–28 janvier 1984 Ed. by P. Hellström, Th. Thieme. Traveaux du Centre de recherche sur le Proche-Orient et la Grèce Antique 8. 103-121
DAI Architekturreferat (1984). Bauplanung und Bautheorie der Antike: Bericht über ein Kolloquium, veranstaltet vom Architekturreferat des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) vom 16.11. bis 18.11.1983. Berlin: Wasmuth.
Davies, J. K. (1985). Das klassische Griechenland und die Demokratie. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Davis, P. A. (1937). The Delian Building Contracts. BCH 61: 109-135
Dekoulakou-Sideris, I. (1990). A Metrological Relief from Salamis. AJA 94: 445-51
Diels, H. (1904). Laterculi alexandrini aus einem Papyrus ptolemäischer Zeit, von Hrn. H. Diels. Berlin: G. Reimer.
Diels, H., E. Schramm (1920). Exzerpte aus Philons Mechanik B. VIII und VIII (Vulgo fünftes Buch). Griechisch und deutsch.. Berlin: Verlag der Akademie der Wissenschaften.
Dienel, H.-L., W. Meighörner (1997). Der Tretradkran. München: Deutsches Museum.
Dinsmoor, W. B. (1950). The Architecture of Ancient Greece..
- (1973). The Kardaki Temple Re-examined. Athenische Mitteilungen 88: 165-174
Dinsmoor, W. B., W. B. Jr. Dinsmoor (2004). The Propylaea to the Athenian Acropolis. Princeton: American School of Classical Studies at Athens.
Dirschedl, U. (2013) Die griechischen Säulenbasen. phdthesis. Universität Regensburg
Dornisch, K. (1992). Die griechischen Bogentore: Zur Entstehung und Verbreitung des griechischen Keilsteingewölbes. Frankfurt a. M., New York: Peter Lang.
Drachmann, A. G. (1956). A Note on Ancient Cranes. In: A History of Technology Ed. by C. Singer. Oxford: Clarendon Press 658-662
Duchêne, H., P. Fraisse (2001). Le paysage portuaire de la Délos antique: Recherches sur les installations maritimes commerciales et urbaines du littoral délien. Paris: E. de Boccard.
Durm, J. W., H. Ende, H. E., Schmitt H. (1905). Handbuch der Architektur. Stuttgart: A. Bergsträsser.
Eiteljorg, H. (1973) The Greek Architect of the Fourth-Century BCE. Master Craftsman or Master Builder. phdthesis. University of Pennsylvania
Étienne, R., P. Varène (2004). Sanctuaire de Claros, l’architecture: Les propylées et les monuments de la voie sacrée. Fouilles de Louis et Jeanne Robert et Roland Martin 1950–1961. Paris: ERC.
Fedak, J. (1990). Monumental Tombs of the Hellenistic Age: A Study of Selected Tombs from the Pre-Classical to the Early Imperial Era. Toronto: University of Toronto Press.
Fensterbusch, C. (1964). Vitruv zehn Bücher über Architektur = Vitruvii De architectura libri decem. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Finley, M. I. (1993). Das antike Sizilien: Von der Vorgeschichte bis zur arabischen Eroberung. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Forbes, R. J. (1993). Studies in Ancient Technology. Leiden: Brill.
Fraisse, P., C. Llinas (1995). Documents d’architecture héllenique et hellénistique. Athens: École Française d’Athène.
Frazer, A. (1990). The Propylon of Ptolemy II..
Gehrmann, G. (1982). Einführung in die Geschichte der Architekturtheorie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Gericke, H. (1996). Mathematik in Antike und Orient; Mathematik im Abendland..
Gneisz, D. (1990). Das antike Rathaus: Das griechische Bouleutherion und die frührömische Curia. Wien: Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften.
Gogos, S. (1992). Das Theater von Aigeira: ein Beitrag zum antiken Theaterbau. Wien: ÖAI.
- (2009). Das antike Theater von Oiniadai. Wien: Phoibos.
Golvin, J.-C. (2006). Metropolen der Antike. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Gounaropoulou, L. (1983) Die Baurechnungen des Asklepiostempels in Epidauros. phdthesis. Universität Wien
Greco, E., D. Theodorescu (1983). Poseidonia-Paestum: L’agoa. Paris: E. de Boccard.
Greco, E. und M. Torelli (1983). Storia dell’urbanistica, Il Mondo Greco. Rom: Laterza.
Gros, P. (1973). Hermodorus et Vitruve. Mefra 85: 173ff.
Gruben, G. (1986). Die Tempel der Griechen. München: Hirmer.
- (1997). Naxos und Delos: Studien zur archaischen Architektur der Kykladen. JdI 112: 261-416
- (2001). Griechische Tempel und Heiligtümer. München: Hirmer.
Guarducci, M. (1949). L’iscrizione dell’Apollonion di Siracusa. Archaeologia Classica 1: 4-10
Günther, L.-M. (2008). Griechische Antike. Tübingen: Francke.
Hahn, R. (2001). Anaximander and the Architects. The Contribution of Egyptian and Greek Architectural Technologies to the Origins of Greek Philosophy. Albany: State University of New York Press.
Hansen, M. H. (2006). Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State. Oxford; New York: Oxford University Press.
Haselberger, L. (1980). Werkzeichnungen am jüngeren Didymeion. Istanbuler Mitteilungen 30: 191-215
- (1983). Bericht über die Arbeit am Jüngeren Apollontempel von Didyma. Istanbuler Mitteilungen 33: 90-124
- (1991). Aspekte der Bauzeichnungen von Didyma. Revue Archéologique
- (1997). Architectural Likenesses: Models and Plans of Architecture in Classical Antiquity. JRA 10: 77-94
- (1999). Appearance & Essence: Refinements of Classical Architecture – Curvature: Proceedings of the Second Williams Symposium on Classical Architecture held at the University of Pennsylvania, Philadelphia, April 2–4, 1993. Philadelphia: University Museum, University of Pennsylvania.
- (2005). Bending the Truth: Curvature and Other Refinements of the Parthenon. In: The Parthenon: From Antiquity to the Present Ed. by J. Neils. New York: Cambridge University Press 101-57
Haselberger, L., H. Seybold (1991). Seilkurve oder Ellipse. Zur Herstellung antiker Kurvaturen nach dem Zeugnis der didymeischen Kurvenkonstruktion. Archäologischer Anzeiger
Heiden, A. (1985) Korinthische Dachziegel: Zur Entwicklung der korinthischen Dächer. phdthesis. FU Berlin 1985
- (1995). Die Tondächer von Olympia. Berlin, New York: Walter de Gruyter.
Heisel, J. P. (1993). Antike Bauzeichnungen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Hellmann, M.-C. (1992). Recherches sur le vocabulaire de l’architecture greque, d’après les inscriptions de Délos. Paris: E. de Boccard.
- (2002). L’architecture greque, Vol. 1, Les principes de la construction. Paris: E. de Boccard.
- (2003). Choix d’inscriptions architecturales grecques. Lyon; Paris: Maison de l’Orient méditerranée-Jean Pouilloux; Diffusion de Boccard.
- (2006). L’architecture greque, Vol. 2, Architecture religieuse et funéraire. Paris: E. de Boccard.
- (2010). L’architecture greque, Vol. 3, Habitat, urbanisme et fortifications. Paris: E. de Boccard.
Hellner, N. (2009). Die Säulenbasen des zweiten Dipteros von Samos: Grundlage für die Rekonstruktion des Tempels in seinen Bauphasen. Bonn: Deutsches Archäologisches Institut; in Kommission bei R. Habelt.
Hellström, P., Th. Thieme (1985). Le dessin d’architecture dans les sociétés antiques: Actes du Colloque de Strasbourg, 26–28 janvier 1984. Leiden: Brill.
Hennemeyer, A. (2013). Das Athenaheiligtum von Priene. Die Nebenbauten – Altar, Halle und Propylon – und die bauliche Entwicklung des Heiligtums. Wiesbaden: Reichert.
Hertwig, O. (1968). Über geometrische Gestaltungsgrundlagen von Kultbauten des VI. Jahrhunderts v. Chr. zu Paestum.. München: C.H. Beck.
von Hesberg, H. (1980). Konsolengeisa des Hellenismus und der frühen Kaiserzeit. Mainz: Philipp von Zabern.
Hiller von Gaertringen, F. (1906). Inschriften von Priene. Berlin: G. Reimer.
Höcker, C. (1993) Planung und Konzeption der klassischen Ringhallentempel von Agrigent: Überlegungen zur Rekonstruktion von Bauentwürfen des 5. Jhs. v. Chr. phdthesis.
- (2004). Metzler Lexikon antiker Architektur. Sachen und Begriffe. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Hodge, A. Trevor. (1960). The Woodwork of Greek Roofs.. Cambridge: Cambridge University Press.
Hoepfner, W. (1997). Kult und Kultbauten auf der Akropolis. Internationales Symposion vom 7. bis 9. Juli 1995 in Berlin. Berlin: Wasmuth.
- (2000). Zur Tholos in Delphi. AA
- (2002). Antike Bibliotheken. Berlin: Wasmuth.
Hoepfner, W., E.-L. Schwandner (1990). Hermogenes und die hochhellenistische Architektur. Internationales Kolloquium Berlin vom 28.–29. Juli 1988. Mainz: Philipp von Zabern.
- (1994). Haus und Stadt im klassischen Griechenland, Wohnen in der klassischen Polis. München: Deutscher Kunstverlag.
- (1996). Säule und Gebälk: Zu Struktur und Wandlungsprozess griechisch-römischer Architektur. Bauforschungskolloquium in Berlin vofm 16. bis 18. Juni 1994. Mainz: Philipp von Zabern.
Hoffmann, A. (1991). Bautechnik der Antike: Internationales Kolloquium in Berlin vom 15.–17. Februar 1990. Mainz: Philipp von Zabern.
Hoffmann, M. (1999). Griechische Bäder. München: Tuduv.
Howe, T. N. (1985) The Invention of the Doric Order. phdthesis. Ann Arbor
Hübner, G. (1995). Zur Forschungsgeschichte griechischer Dachziegel aus gebranntem Ton. Archaiologike Ephemeris 134: 115-161
Hueber, F. (1998). Werkrisse, Vorzeichnungen und Meßmarken am Bühnengebäude des Theaters von Aphrodisias. Antike Welt 29: 439-445
Hunt, A. S., C. C. Edgar (1932–1934). Select Papyri..
Jeppesen, K. (2000). The Maussolleion at Halikarnassos: The Quadrangle: The Foundations fo the Maussolleion and its Sepulcral Compartments. Kopenhagen: Nordisk Forlag.
- (2002). The Maussolleion at Halikarnassos: The Superstructure. Kopenhagen: Nordisk Forlag.
Jones, M. W. (2000). Principles of Roman architecture. New Haven, Conn.: Yale University Press.
- (2001). Doric Measure and Architectural Design 2: A Modular Reading of the Classic Temple. AJA 105(4): 675-713
- (2002). Doric Measure and Architectural Design 3: Tripods, Triglyphs, and the Origin of the Doric Frieze. AJA 106(3): 353-90
Kahrstedt, U. (1969). Untersuchungen zur Magistratur in Athen. Aalen: Scientia.
Kalpaxis, T. E. (1986). Hermiteles: Akzidentelle Unfertigkeit und „Bossenstil“ in der griechischen Baukunst. Mainz: Philipp von Zabern.
Karlsson, L. (1992). Fortification Towers and Mansonry Techniques in the Hegemony of Syracuse, 405-211 BC. Stockholm: Svenska Institutet i Rom.
Kienast, H. J. (1995). Die Wasserleitung des Eupalinos auf Samos. Bonn: Habelt.
- (2002). Zum dorischen Triglyphenfries. Athenische Mitteilungen 117: 53-68
von Kienlin, A. (2011). Holztragwerke der Antike. Internationale Konferenz 30. März–1. April 2007 in München. Istanbul: Zero Prod. Ltd..
Kirchhoff, W. (1988). Die Entwicklung des ionischen Volutenkapitells im 6. und 5. Jahrhundert. Bonn: Habelt.
Kissas, K. (2008). Archaische Architektur der Athener Akropolis: Dachziegel, Metopen, Geisa, Akroterbasen. Wiesbaden: Reichert.
Klein, N. L. (1991) The Origin of the Doric Order on the Mainland of Greece: Form and Function of the Geison in the Archaic Period. phdthesis. Bryn Mawr College
Knackfuß, H. (1941). Didyma. Teil 1: Die Baubeschreibung. Berlin: Gebr. Mann.
Knell, H. (1988). Architektur der Griechen. Grundzüge. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- (2008). Des Kaisers neue Bauten: Hadrians Architektur in Rom, Athen und Tivoli. Mainz: Philipp von Zabern.
Knell, H., B. Wesenberg (1984). Vitruv-Kolloquium des Deutschen Archäologen-Verbandes e.V.. Darmstadt: Hochschule Darmstadt.
Koenigs, W. (1979). Zum Entwurf dorischer Hallen. Istanbuler Mitteilungen 29: 209-237
- (1984). Die Echohalle. Berlin: Wasmuth.
Koldewey, R., O. Puchstein (1899). Die Griechischen Tempel in Unteritalien und Sicilien. Berlin: A. Asher & Co..
Korres, M. (1994). Der Plan des Parthenon. AM 109: 53-120
- (1995). Vom Penteli zum Parthenon. Katalog der Ausstellung: Die antiken Steinbrüche und die Geschichte eines halbfertigen dorischen Kapitells des ersten marmornen Parthenon. Stiftung für Griechische Kultur, Berlin, 10. April–12. Mai 1995. Berlin: Verl.-Haus Melissa.
Korres, M., K. Vierneisel (1992). Vom Penteli zum Parthenon: Werdegang eines Kapitells zwischen Steinbruch und Tempel. München: Glyptothek München.
Krischen, F. (1941). Antike Rathäuser. Berlin: Gebr. Mann.
Kruft, H.-W. (2004). Geschichte der Architekturtheorie. München: C.H. Beck.
Kyrieleis, H. (2008). Der dorische Triglyphenfries und die mykenische Architektur. In: Original und Kopie. Formen und Konzepte der Nachahmungen in der antiken Kunst. Akten des Kolloquiums in Berlin 17.–19. Februar 2005 Ed. by K. Junker, A. Stähli. Wiesbaden: Reichert 199-212
Lambrinodakis, V. (1996). Beobachtungen zur Genese der ionischen Gebälkformen. In: Säule und Gebälk. Zu Struktur und Wandlungsprozess griechisch-römischer Architektur. Bauforschungskolloquium in Berlin vom 16. bis 18. Juni 1994 Ed. by E.-L. Schwandner. Diskussionen zur Archäologischen Bauforschung 6. Mainz: Philipp von Zabern 55-60
Landels, J. G. (1980). Die Technik in der antiken Welt. München: C.H. Beck.
Lattermann, H. (1908) Griechische Bauinschriften. phdthesis. Universität Straßburg
Lauter, H. (1974). Zur gesellschaftlichen Stellung des bildenden Künstlers in der griechischen Klassik. Erlangen: Universitäts-Bund Erlangen-Nürnberg.
- (1986). Die Architektur des Hellenismus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Lawrence, A. W. (1996). Greek Architecture. New Haven: Yale University Press.
Lewis, M. J. T. (2001). Surveying Instruments of Greece and Rome. Cambridge: Cambridge University Press.
Lulof, P. S., E. M. Moormann (1997). Deliciae Fictiles II. Proceedings of the 2nd International Conference on Archaic Architectural Terracottas from Italy, held at the Netherlands Institute in Rome 12–13 June 1996. Amsterdam: Thesis Publishers.
Maier, F. G. (1959–1961). Griechische Mauerbauinschriften. Heidelberg: Quelle & Meyer.
Malacrino, C. G., E. Sorbo (2007). Architetti, architettura e città. Mailand: Mondadori.
Mallwitz, A. (1972). Olympia und seine Bauten. München: Prestel-Verlag.
Martin, R. (1965). Manuel d’architecture grecque. Bd. I. Materiaux et techniques. Paris: A. et J. Picard.
Martini, W. (1984). Das Gymnasion von Samos. Bonn: Habelt.
McGowan, E. P. (1997). The Origins of the Athenian Ionic Capital. Hesperia 66(2): 209-33
McK. Camp, J. M. II., C. A. Mauzy (2009). The Athenian Agora: New Perspectives on an Ancient Site. Mainz: Philipp von Zabern.
Meiggs, R. (1982). Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World. Oxford: Clarendon Press.
Mertens, D. (1984). Der Tempel von Segesta und die dorische Tempelbaukunst des griechischen Westens in klassischer Zeit. Mainz: Philipp von Zabern.
- (1993). Der alte Heratempel in Paestum und die archaische Baukunst in Unteritalien. Mainz: Philipp von Zabern.
- (2006). Städte und Bauten der Westgriechen: Vom der Kolonisationszeit bis zur Krise um 400 vor Christus. München: Hirmer.
Migeotte, L. (1984). L’emprunt public dans les cités grecques: recueil des documents et analyse critique. Québec; Paris: Éditions du Sphinx; Belles Lettres.
- (1992). Les souscriptions publiques dans les cités grecques. Genève; Québec: Droz; Éditions du Sphinx.
Miles, M. M. (1989). A Reconstruction of the Temple of Nemesis at Rhamnous. Hesperia 58(2): 133-249
Morgan, J. (2010). The Classical Greek House. Bristol: Phoenix Press.
Müller, K. (2003). Hellenistische Architektur auf Paros. Berlin: Walter de Gruyter.
Müller, W. (1989a). Architekten in der Welt der Antike. Zürich, München: Koehler & Amelang.
- (1989b). Rückblick auf das Bauwesen im Alten Ägypten. In: Architekten in der Welt der Antike Leipzig: Koehler & Amelang
Müller-Wiener, W. (1988). Griechisches Bauwesen in der Antike. München: C.H. Beck.
Mulliez, D. (1983). Notes sur le transport du bois. BCH 106: 107-118
Murray, O. (1991). Das frühe Griechenland. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
von Naredi-Rainer, P. (1999). Architektur und Harmonie. Zahl, Mass und Proportion in der abendländischen Baukunst. Köln: DuMont.
Nix, L., W. Schmidt (1900). Herons von Alexandria Mechanik und Katoptrik. Leipzig: Teubner.
Norman, N. J. (1984). The Temple of Athena Alea at Tegea. AJA 88(2): 169-94
Oldfather, C. H. (1993). Diodurus of Sicily. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Oleson, J. P. (2008). The Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World. Oxford, New York: Oxford University Press.
Orlandos, A. K. (1966). Les Matériaux de construction et la technique architecturale des anciens Grecs. Paris: E. de Boccard.
Osthues, E. W. (2005). Studien zum dorischen Eckkonflikt. Jahrbuch des deutschen Archäologischen Instituts 120: 1-154
Pakkanen, J. (2013). Classical Greek Architectural Design. A Quantitative Approach. Helsinki: Foundation of the Finnish Institute at Athens.
Petronotis, A. (1972). Zum Problem der Bauzeichnungen bei den Griechen..
Philipp, H. (1968). „Tektonon Daidala“, der bildende Künstler und sein Werk im vorplatonischen Schrifttum. Berlin: B. Hessling.
Raepsaet, G. (2008). Riding, Harnesses and Vehicles. In: Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World Oxford: Oxford University Press
Randall, R. H. (1953). The Erechtheum Workmen. AJA 57(3): 199-210
Rathke, A. (2001). Griechische Kragsteintore: Typologie, Konstruktion und Verbreitung vom 6.-2. Jahrhundert vor Christus. Rahden, Westf.: Marie Leidorf.
Rehm, A. (1958). Didyma, Teil 2: Die Inschriften. Mainz; Berlin: Philipp von Zabern; Gebr. Mann.
Reinholdt, C. (2009). Das Brunnenhaus der Arsinoë in Messene: Nutzarchitektur, Repräsentationsbaukunst und Hydrotechnologie im Rahmen hellenistisch-römischer Wasserversorgung. Wien: Phoibos.
Riemann, H. (1934) Zum griechischen Peripteraltempel. Seine Planidee und ihre Entwicklung bis zum Ende des 5. Jahrhunderts. phdthesis. Universität Frankfurt
- (1961). Studien zum dorischen Antentempel. Bonner Jahrbücher
Robertson, D. S. (1964). A Handbook of Greek and Roman Architecture. Cambridge: Cambridge University Press.
Rocco, G. (1994). Guida alla lettura degli ordini architettonici. Bd. 1: Il dorico. Neapel: Liguori.
Roux, G. (1987). Topographie et architecture: La terrasse d’Attale I.. Paris: E. de Boccard.
Rowland, I. D., T. N. Howe, T.N. H. (1999). Vitruvius: Ten Books on Architecture. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
Rumscheid, F. (1994). Untersuchungen zur kleinasiatischen Bauornamentik des Hellemismus. Mainz: Philipp von Zabern.
Sapirstein, P. (2009). How the Corinthians Manufactured Their First Rooftiles. Hesperia 78(2): 195-229
Scahill, D. (2009). The Origins of the Conrinthian Capital. In: Structure, Image, Ornament: Architectural Sculpture in the Greek World. Proceedings of an International Conference Held at the American School of Classical Studies, 27–28 November 2004 Ed. by P. Schulz, R. Hoff. Oxford, Oakville, Conn.: Oxbow 40-53
Schattner, T. G. (1990). Griechische Hausmodelle. Berlin: Gebr. Mann.
Schlikker, F. W. (1940). Hellenistische Vorstellungen von der Schönheit des Bauwerks nach Vitruv. Berlin: Archäologisches Institut des Deutschen Reiches.
- (1941). Der Schaubildentwurf im griechischen Tempelbau. Archäologischer Anzeiger 56: 748-765
Schuller, M. (1990). Der Apollontempel im Delion auf Paros. Berlin: Walter de Gruyter.
Schuller, W. (2010). Griechische Geschichte. München: Oldenbourg.
Schuller, W., W. Hoepfner, W. H. (1989). Demokratie und Architektur: Der hippodamische Städtebau und die Entstehung der Demokratie. Konstanzer Symposion vom 17. bis 19. Juli 1987. München: Deutscher Kunstverlag.
Schwandner, E.-L. (1985a). Der ältere Porostempel der Aphaia auf Ägina. Berlin: Walter de Gruyter.
- (1985b). Zu Entwurf, Zeichnung und Massystem des älteren Aphaiatempels von Aegina. In: Le dessin d’architecture dans les sociétés antiques. Actes du Colloque de Strasbourg 26–28 janvier 1984 Traveaux du Centre de recherche sur le Proche-Orient et la Grèce antique 8. 75-85
- (1991). Der Schnitt im Stein. Beobachtungen zum Gebrauch der Steinsäge in der Antike. In: Bautechnik der Antike Ed. by A. Hoffmann. Diskussionen zur archäologischen Bauforschung 5. Mainz: Philipp von Zabern 216-223
Schwertheim, E. (2003). Stadt und Stadtentwicklung in Kleinasien. Bonn: Habelt.
Scranton, R. L. (1941). Greek Wallls. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- (1960). Greek Architectural Inscriptions as Documents. Harvard Library Bulletin 14: 159-82
Scriba, C. J., P. Schreiber (2010). 5000 Jahre Geometrie. Geschichte, Kulturen, Menschen. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.
Seiler, F. (1986). Die griechische Tholos: Untersuchungen zur Entwicklung, Typologie und Funktion kunstmässiger Rundbauten. Mainz: Philipp von Zabern.
Senseney, J. R. (2011). The Art of Building in the Classical World: Vision, Craftsmanship, and Linear Perspective in Greek and Roman Architecture. Cambridge: Cambridge University Press.
Shaw, J. W. (1967). A Double-Sheaved Pulley Block from Cenchreae. Hesperia 36(36): 389-401
Shoe, L. T. (1936). Profiles of Greek Mouldings. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- (1952). Profiles of Western Greek Mouldings..
Simson, R. H., D. K. Hagel (2006). Mycenaean Fortifications, Highways, Dams and Canals. Sävedalen: Paul Åström.
Sioumpara, E. P. (2011). Der Asklepios-Tempel von Messene auf der Peloponnes. Untersuchungen zur hellenistischen Tempelarchitektur. München: Hirmer Verlag.
Spawforth, T. (2006). The Complete Greek Temples. New York: Thames & Hudson.
Stanier, R. S. (1953). The Cost of the Parthenon. Journal of Hellenic Studies 73: 68-76
Steinhauer, G. (1996). La découverte de l’Arsenal de Philon. In: Tropis IV. 4th International Symposium on Ship Construction in Antiquity Ed. by H. Tzalas. Athen 471-479
Stieglitz, R. R. (2006). Classical Greek Measures and the Builder's Instruments from the Ma‘agan Mikhael Shipwreck. AJA 110: 195ff.
Svenson-Evers, H. (1996). Die griechischen Architekten archaischer und klassischer Zeit. Frankfurt a. M.; New York: Peter Lang.
von Sydow, W. (1984). Die hellenistischen Gebälke in Sizilien. Römische Mitteilungen 91: 239-358
Tanke, K. (1989). Deckenkassetten in der griechischen Baukunst. Antike Welt 20(4): 24-35
Theuer, M. (1918). Der griechisch-dorische Peripteraltempel. Berlin: Wasmuth.
Tölle-Kastenbein, R. (1994). Das Olympieion in Athen. Köln: Böhlau.
Tomlinson, R. A. (1989). Greek Architecture. Bristol: Bristol Classical Press.
Tournikiotis, P. (1994). The Parthenon and Its Impact in Modern Times. Athen: Melissa Publishing House.
Tuchelt, K. (1991). Branchidai-Didyma. Antike Welt
Ulrich, R. B. (2008). Woodworking. In: Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World Oxford: Oxford University Press 438-464
Veyne, P., K. Laermann, K. L. (1988). Brot und Spiele. Gesellschaftliche Macht und politische Herrschaft in der Antike. Frankfurt a. M.: Campus.
Voigtländer, W. (1975). Der jüngste Apollontempel von Didyma: Geschichte seines Baudekors. Tübingen: Wasmuth.
Waddell, G. (2002). The Principal Design Methods for Greek Doric Temples and Their Modification for the Parthenon. Architectural History 45: 1-31
Walbank, F. W. (1994). Die hellenistische Welt. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
Walker, K. G. (2004). Archaic Eretria: A Political and Social History from the Earliest Times to 490 BC. London; New York: Routledge.
Walter-Karydi, E. (1998). The Greek House: The Rise of Noble Houses in Late Classical Times. Athen: Archaeological Society at Athens.
Wedepohl, E. (1967). Eumetria, das Glück der Proportionen. Massgrund und Grundmass in der Baugeschichte. Beiträge zur musischen Geometrie. Essen: Verlag R. Bacht.
Welwei, K.-W. (2011a). Athen. Von den Anfängen bis zum Beginn des Hellenismus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- (2011b). Griechische Geschichte: Von den Anfängen bis zum Beginn des Hellenismus. Paderborn: Schöningh.
Werner, W. (1997). The Largest Ship Trackway in Ancient Times: The Diolkos of the Isthmus of Corinth, Greece, and Early Attempts to Build a Canal. International Journal of Nautical Archaeology 26(2): 98-119
Wescoat, B. D. (2012). The Temple of Athena at Assos. Oxford; New York: Oxford University Press.
Wesenberg, B. (1972). Kymation und Astragal. In: Marburger Winckelmann-Programm 1971/72 Marburg: Universität Marburg 1-13
- (1983). Parthenongebälk und Südmetopenproblem. Jahrbuch des deutschen Archäologischen Instituts
- (1984a). Vitruvs griechischer Tempel. In: Vitruv-Kolloquium Darmstadt 1982 Darmstadt: Technische Hochschule 65-96
- (1984b). Zu den Schriften der griechischen Architekten. In: Bauplanung und Bautheorie der Antike. Bericht über ein Kolloquium veranstaltet vom Architekturreferat des Deutschen Archäologischen Institutes (DAI) mit Unterstützung der Stiftung Volkswagenwerk in Berlin vom 16.11. bis 18.11.1983 Diskussionen zur archäologischen Bauforschung 4. Berlin: Wasmuth 39-48
- (1995). Die Metrologie der griechischen Architektur. Probleme interdisziplinärer Forschung. In: III. Internationaler interdisziplinärer Kongress für Historische Metrologie vom 17. bis. 21 November 1993 in Trier Ed. by D. Ahrens, R. Rottländer. Ordo et Mensura III. 199ff.
Wiegand, Th., H. Schrader (1904). Priene: Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen in den Jahren 1895–1898. Berlin: G. Reimer.
Wilson, A. I. (2008). Machines in Greek and Roman Technology. In: Oxford Handbook of Engineering and Technology in the Classical World Ed. by J. P. Oleson. Oxford: Oxford University Press 337-366
Winter, F. E. (1971). Greek Fortifications. London: Routledge & Kegan.
- (1978). Tradition and Innovation in Doric Design II: Archaic and Classical Doric East of the Adriatic. AJA 82: 151-161
- (1980). Tradition and Innovation in Doric Design III: The Work of Iktinos. AJA 84(4): 399-416
Wittenburg, A. (1978) Griechische Baukommissionen des 5. und 4. Jahrhunderts. phdthesis. Ludwig-Maximilians-Universität zu München
Wolf, M. (2003). Die Häuser von Solunt und die hellenistische Wohnarchitektur. Mainz: Philipp von Zabern.
Wolfer-Sulzer, L. (1939). Das geometrische Prinzip der griechisch-dorischen Tempel. Winterthur: Vogel.
Wrede, W. (1933). Attische Mauern. Athen: Deutsches Archäologisches Institut Athen.
Yegül, F. (1992). Baths and Bathing in Classical Antiquity. Cambridge, Mass.: MIT Press.
Young, P. H. (1980) Building Projects and Archaic Tyrants. phdthesis. University of Pennsylvania
Fußnoten
Einführende Literatur zur griechischen Geschichte: Welwei 2011a; Welwei 2011b; Günther 2008; Schuller 2010; Murray 1991; Davies 1985; Walbank 1994; Hansen 2006.
Städtegründungen durch Synoikismos hat es vereinzelt auch noch in weit späterer Zeit gegeben. Ein Beispiel dafür ist die Stadt Megalopolis (‚Großstadt‘) auf der Peloponnes, die 367 durch die Übersiedlung der Einwohner von vierzig Dörfern gegründet wurde, um die Unabhängigkeit von Sparta dauerhaft zu sichern.
Alle Datierungen in diesem Beitrag beziehen sich – wenn nicht ausdrücklich anders angegeben – auf die Zeit vor Christus. Die sog. jüngere Kolonisation gehört zu den Folgen der Feldzüge Alexanders des Großen. Es gab auch schon vor der älteren Kolonisation – wenn auch in weit geringerer Zahl – bedeutende Neugründungen. Dazu gehören etwa die zwölf ionischen und die sechs dorischen Städte an der türkischen Westküste und den vorgelagerten Inseln. Für den kulturellen Austausch wesentlich waren auch einige reine Handelsposten wie Phithekussai auf Ischia vor der italischen Küste und Al Mina (antiker Name unbekannt) in Nordsyrien.
Der Untergang der Königsherrschaft ist kaum fassbar, vor allem nicht in zeitgenössischen Quellen. Dass in der Zeit nach den ‚dunklen Jahrhunderten‘ Monarchien überhaupt existiert haben, zeigen in der Hauptsache einige Relikte in den späteren Verfassungen. In Athen etwa trug von den leitenden Beamten (‚Archonten‘) einer den Titel des ‚Archon Basileus‘ (‚Königs-Archon‘). Die spartanische Verfassung sah ein – erbliches – Doppelkönigtum vor, das allerdings in seinen Kompetenzen durch die Doppelung sowie die Macht der Ratsversammlung stark eingeschränkt war, weswegen die spartanische Verfassung in der Antike auch nicht als Monarchie angesehen wurde.
Ein eindrucksvolles Zeugnis dafür und für den Hass auf den Adel finden sich in den Erga (‚Werke und Tage‘) des Hesiod, eines böotischen Bauern-Dichters, der zu Beginn des 7. Jahrhunderts schrieb. Vereinzelt haben Tyrannen ihre Herrschaft auch freiwillig niedergelegt, wie etwa für Pittakos von Mytilene überliefert ist. Vgl. Zusammenfassend zur älteren Tyrannis Murray 1991.
2 Makk 4,13.
Solche Zeichen, meist ein oder zwei Buchstaben, wurden in die Steine eingeschlagen, um die Arbeit einzelner Handwerker oder Unternehmer für die Abrechnung ihrer Bauleistungen zu dokumentieren. Nicht immer sind diese Marken zweifelsfrei zu interpretieren, denn Buchstaben wurden auch als Versatzmarken verwendet, die die Position einzelner Blöcke innerhalb von Reihen oder Schichten kennzeichneten. Zudem wurden die Abrechnungsmarken in der Regel auf den unfertigen Oberflächen der Steine angebracht, also bei der Endbearbeitung, zusammen mit dem ‚Werkzoll‘ (s. u.), abgearbeitet. Sie dokumentieren jedoch – wie die Inschriften häufig auch – die kleinteilige Auftragsvergabe, denn wenn etwa der komplette Rohbau von einer einzigen Bauhütte errichtet worden wäre, wäre die Kennzeichnung einzelner Steine überflüssig gewesen.
Eine inhaltliche Typisierung dieser Inschriften findet sich bei Scranton 1960. Für die Mauerbau-Inschriften vgl. Maier 1959–1961, 11–34.
Vgl. Young 1980, der die Zahl der den Tyrannen zugeschriebenen Bauten und deren ‚Bauprogramme‘ zurückhaltend beurteilt.
Beispiele dafür sind etwa die Kaufleute aus Kition auf Zypern, die für den Bau eines Aphroditeheiligtums im Piräus (?) ein Grundstück erwerben wollten (IG II2 337 = HGiÜ 262), datiert auf das Jahr 333. Erwähnt wird dort auch ein analoger, bereits genehmigter Antrag der „Ägypter“ für den Bau eines Isis-Heiligtums.
Bekannt sind etwa Baugenehmigungen, die zeigen, dass es eine Art Kataster gegeben haben muss, das private Häuser nach Lage und Größe verzeichnete. Die ptolemäischen Herrscher Ägyptens ließen vielfach die – effizienten – älteren Verwaltungsstrukturen des pharaonischen Ägyptens bestehen.
Literatur dazu bei Hellmann 2003, 60.
Stanier 1953. Ein Talent entspricht ca. 25 kg Silber bzw. 6.000 Drachmen.
Das heißt: eine Mine (100 Drachmen) pro Talent (6.000 Drachmen).
Auch die modernen Versuche, auf Basis der erhaltenen Angaben zu Ein- und Ausgaben der Baukommission des Parthenon die Frage der Zweckentfremdung von Bundesmitteln zu klären, haben zu keinem eindeutigen Resultat geführt.
Wittenburg 1978, 12–15, 18f. (letztere Annahme mit Bezug auf Aristophanes und Ps. Xenophon).
Wittenburg 1978, 32f.. Am Nike-Heiligtum standen Schenkel und Häute der Opfertiere der Priesterin zu, cf. IG I2 24.
Der Athener Tyrann Peisistratos kassierte beispielsweise den Zehnten auf die jährlichen Ernteerträge, s. Aristot. Ath. Pol. 16,4.
Hdt. III 57.
Siehe für Epidauros Burford 1969, 120–126. Vgl. auch Hellmann 2003, 43 = IG II2 2499.
Hdt. 2, 180. Inschriftliche Angaben zu den Kosten des spätklassischen Nachfolge-Baus in OGIS 46.
IG I3 402.
HGiÜ 284.
Datiert auf 480–70; zur Inschrift Hellmann 2003, 28.
IG I3 465.
Plin. n. h. 36, 95.
Strab. geogr. 14, 1, 22.
Inschriften: Hiller von Gaertringen 1906, Nr. 156.
Ehrenbeschluss für Antiochos von ca. 299 = Hellmann 2003, No. 27.
Plut. Them. 22, 2
Vitr. 1.6.4–5.
Diog. Laert. 7, 12
Is. de Dicaeogenis hered. 28
Material dazu bei Coulton 1977, 18.
Hdt. 2, 180.
Vgl. zu Anleihen und Subskriptionen Migeotte 1984 und Migeotte 1992.
RE XII Sp 1871–79 (ND 1994) s. v. Leiturgie (J. Oehler).
Strab. 14,1,22; siehe Svenson-Evers 1996 = Aristot. oec. 2. 2, 19.
Plut. mor. 262B.
Gemeint sein dürfte wohl vor allem der Bau des großen Ringhallentempels im Heraion unweit der Stadt Samos (der sog. „zweite Dipteros“).
Aristot. pol. 1313 b 20.
Plat. pol. 567a.
CAH IV2 777.
Hdt. 3, 39.
Das gilt auch – soweit die spärlichen Quellen hier Auskunft geben – für die anschließend angesprochenen Bauprojekte der archaischen Zeit. Denkbar ist allerdings, dass ein Alleinherrscher das gesamte Vorhaben an einen von ihm bestimmten Architekten übergeben hat.
Ein kleiner Bauunternehmer mit zwei Mitarbeitern namens Philokles, der in den Abrechnungen für das Erechtheion als Architekt bezeichnet wird, war sicher nicht der entwerfende und bauleitende Architekt des Projektes, siehe Svenson-Evers 1996, s. v. Philokles.
Diod. 8. 11 (Oldfather 1993, 395 Anm. 3) gibt Athen als Ort der Geschichte an, weist aber selber daraufhin, dass die a. O. erwähnten Geomoroi gar nicht für Athen, sondern nur für Samos und Syrakus bezeugt sind. Gut bekannt waren vor allem die Geomoroi von Syrakus (ein Rat, in dem die Gründerfamilien der Stadt vertreten waren), daher die – hier bevorzugte – Lokalisierung des Berichts in Syrakus; im selben Sinne RE Suppl. I (1903) Sp. 23 s.v. Agathokles (Niese), wo eine Datierung um 700 angenommen wird.
Hdt. 5. 62
Polyain. strat. 5.1.1; 6.5.1.
Die beiden bei Polyainos a. O. geschilderten Episoden klingen zu ähnlich, um nicht der ‚Tyrannen-Topik‘ verdächtig zu sein, d. h. dem üblich gewordenen Schema zu entsprechen, auf das immer dann zurückgegriffen wurde, wenn der jeweilige Autor wenig Detailangaben zur Verfügung hatte. Aber das Muster selbst wird – wenn auch nicht unbedingt in den hier angesprochenen Fällen – doch auf historische Ereignisse zurückgehen. Siehe dazu etwa Finley 1993, 70f..
So wird der Tempelbau in Didyma in hellenistischer Zeit von einem Epistaten geleitet.
Vgl. etwa den Beschluss über die Reinigung der Brunnen in Athen von 440/32 = IG I3 49 = HGiÜ 84.
Zu den Epistaten des Heiligtums von Eleusis, die gleichzeitig als Baubehörde fungierten, siehe Maier 1959–1961, I, 98.
Die Hieropoioi im freien Delos nach 315 leiteten das Heiligtum und verwalteten ständig Baumaßnahmen, s. Wittenburg 1978, 89 mit Lit ebd. Anm. 2.
SEG X 24 dekretierte, dass die Epistaten des Heiligtums von Eleusis, die die Kasse des Heiligtums verwalteten, Bauaufgaben in der Weise wahrnehmen sollten wie die Athener Kommissionen für Tempel und Standbild auf der Akropolis (gemeint sind die entsprechenden Kommissionen für den Parthenon); cf. Wittenburg 1978, 40ff..
Siehe RE s. v. Egdoteres.
Für Epidauros vgl. etwa IG IV2 103 Z. 2; dazu Burford 1969, 103f.;; für Tegea IG V 2, 6. Den Egdoteres von Epidauros wurden Reisespesen nach Korinth, Argos, Megara und Ägina erstattet. In den Inschriften ist auch von Herolden die Rede, die offenbar Ausschreibungen verkündeten.
Nikedekret IG I3, 35 und 45; s. DNP s. v. Poleten; RE XXI 1361 (Lenschau). In Athen sind bei der Restaurierung der ‚Langen Mauern‘ (von Athen zum Piräus-Hafen) an der Auftragsvergabe neben den zehn Poleten und den städtischen Finanzbeauftragten zwei Architekten beteiligt; die Architekten sind ständige Mitglieder, deshalb von Volk gewählt; IG II2 463, s. Maier 1959–1961, I, 58.
Ausführlich zu den Teichopoioi Maier 1959–1961, 61; Hellmann 2003, 32.
Aristot. Ath. Pol. 54.1.
Aristot. Ath. Pol. 50.1.
Aristot. Ath.Pol. 46.1.
Nach Coulton 1977, 21 Anm. 31 z. B. die Naopoioi in Delphi und die Hieropoioi auf Delos3.
Allgemein zu Baukommissionen s. Wittenburg 1978.
SEG X 24, vgl. Svenson-Evers 1996, 243.
Dazu ausführlich Wittenburg 1978, 74.
Epistatai in Athen: Erechtheion-Kommission (u. a. IG I2 372)
Letztere Bezeichnung ersetzt z. B. auf Delos in der Zeit nach 314 den vorher verwendeten Terminus Naopoioi, s. Hellmann 2003, 44.
Die in Inschriften ebenfalls verwendete Bezeichnung Hieropoioi bezieht sich in der Regel auf den Vorstand eines Heiligtums, dem die zentrale Kasse unterstand, z. B. für Rhamnous IG I3 248. In solchen Fällen wurde das Bauprojekt offenbar von den Hieropoioi neben ihren normalen Aufgaben zusätzlich verwaltet; Hieropoioi kann aber auch ‚untere Kultbeamte‘ bezeichnen.
Diese Prüfung wird für Baukommissionen explizit erwähnt im Zusammenhang von Demosthenes‘ Aufgaben bei der Restaurierung der Athener Stadtmauer nach der Schlacht bei Chaironea 338; cf. Aeschin. Ctes. 14. Sanktionen konnten mindestens im 4. Jahrhundert jedoch weder die Logistai selbst noch der Rat festsetzen, sondern nur bei den Gerichten beantragen. Die Initiative für eine Klage gegen die Verwendung der Gelder konnte auch von Personen ohne Amt ausgehen; cf. Arist. Ath. Pol. 46.2.
Fünf Mitglieder hatte etwa die Kommission für die Großen Propyläen, vgl IG I2 366 und Wittenburg 1978, 29f.. Die Zahl scheint später üblich geworden zu sein, denn auch die Kommission, die 264 oder kurz danach lediglich einen Grabbau für Zenon von Kition errichten sollte (vollständiger Volksbeschluss bei Diog. Laert. 7.10.10ff.) hatte fünf Mitglieder. Nur drei Mitglieder hatte hingegen die Erechtheion-Kommission; s. IG I2 372.
Aristot. Ath.Pol. 43.1; 46.1.
Aristot. Ath.Pol. 43.1.
Vgl. Aristot. Ath. Pol. 55 für die Archonten.
Das wurde ausdrücklich von den Richtern verlangt.
In einem Zusatzantrag zu einem nicht erhaltenen Dekret aus Eleusis, dessen Datierung nicht ganz gesichert ist (um 450), wurde festgelegt, dass die Gewählten die Wahl nicht ablehnen konnten. Die Bestimmung kann aber nicht allgemein gegolten haben, denn sonst hätte der Zusatzantrag gar nicht erst gestellt werden müssen. Derselbe Zusatz legte fest, dass die Kommission den Sekretär aus dem Kreis der Mitglieder selbst bestimmen sollte. SEG X 24; s. dazu Wittenburg 1978, 43ff. sowie Kahrstedt 1969.
Das wird durch erhaltene Rechenschaftsberichte vielfach bestätigt. Belege etwa für den Bau der Propyläen auf der Athener Akropolis bei Wittenburg 1978, 29f..
Bekannt vor allem von den letzten Jahren der Parthenon-Kommission, und dort offenbar dadurch bedingt, dass der Bau nach zehn Jahren nahezu fertiggestellt war, die Kommission in den Folgejahren also nur noch wenig Arbeiten abzurechnen hatte; Belege bei Wittenburg 1978, 7.
SEG X 24, Z. 8f.
IG I2 374, Z. 110f. 258f.
Vgl. Lys. or. 24.
Aristot. Ath.Pol. 62.2.
Strab. 9. 1. 12
Vgl. z. B. Hellmann 2003, Nr. 23, 25.
Die Quellen und einige neuere Literatur dazu sind zusammengestellt bei Wittenburg 1978, 48–50.
IG II2 1668. Eine vollständige Übersetzung der Inschrift bei Bundgaard 1957. Die inzwischen ergrabenen Teile des Arsenals sind publiziert bei Steinhauer 1996, der auch die ältere Literatur zur Rekonstruktion des Baus allein auf Basis der Inschrift angibt.
Angegeben sind lediglich die Abstände der Stützenstellungen von den Außenwänden und die Breite des mittleren Durchgangs.
Das heißt, diese Aufträge wurden nicht der ständigen Behörde zur Vergabe öffentlicher Aufträge, den Poleten, zugewiesen, die für die Durchführung der anderen Beschlüsse des Dekrets zuständig waren.
Zur Prostoon-Inschrift s. unten S.
Plut. Per. 13. 1.
Der Begriff ‚Kanon‘, obwohl dem Griechischen entnommen, ist er kein antiker Terminus zur Bezeichnung der Architekturordnungen. Das Wort meint im Bauwesen ursprünglich eine Messlatte oder ein Richtscheit, mit dem die Geradheit von Flächen geprüft wurde.
Zuerst an einem Bankettsaal im Zeusheiligtum von Labraunda im antiken Karien, einem nicht traditionell griechischen Siedlungsgebiet. Labraunda liegt in der Nähe der heutigen Stadt Milas in der Südwesttürkei.
Hdt. 1.60; 1.178; 2.149; 2.168.
Vgl. dazu Jones 2000.
Die jüngste Arbeit, die systematisch aus den an Bauten gemessenen Maßen die antiken Fußmaße zu rekonstruieren versucht, ist Pakkanen 2013.
Vgl. etwa Schwandner in: DAI Architekturreferat 1984, 24; oder auch Wesenberg 1995, 199ff..
Erwähnen muss man hier das äolische Kapitell, das in nur wenigen erhaltenen Exemplaren an der türkischen Westküste gefunden wurde, und dessen Laufzeit sich auf das 6. Jahrhundert beschränkt, sowie verschiedene Formen des Palmblattkapitells, die wohl auf ägyptische Vorbilder zurückgehen, und fast ausschließlich für Innenräume und an kleineren Bauten in hellenistischer Zeit verwendet wurden.
Der Rückgriff auf den ephesischen Basistyp geht wohl auf den Einfluss des Architekten Pytheos zurück, den die antike Überlieferung als Baumeister des Athenatempels von Priene und des Mausoleums von Halikarnass nennt. Das Mausoleum galt als eines der sieben Weltwunder der Antike. Die Quellen zu Pytheos sind zusammengestellt bei Svenson-Evers 1996, s. v. Pytheos.
Die Formen sind zusammengestellt bei Shoe 1936 und Shoe 1952; zur Terminologie Wesenberg 1972.
Vitr. 4. 2. 2.
Paus. 5. 16. 1. Die Holzsäulen sind erst nach und nach, in einem Jahrhunderte andauernden Zeitraum, durch Steinsäulen ersetzt worden. Diese ergänzten Steinsäulen hatten die Form der jeweiligen Epoche, in der der Austausch stattfand, so dass die Reste der heute noch erhaltenen Säulen eine Art ‚Museum‘ (G. Gruben) für den Stilwandel innerhalb der dorischen Säulenformen darstellen. Das Holzgebälk der Heraion ist niemals gegen Steinbalken ausgetauscht worden.
Lykien liegt etwa im Zentrum der Südküste der heutigen Türkei.
Siehe zur technischen Argumentation gegen die Übernahme aus der Holzarchitektur Kienast 2002, mit weiteren Literaturangaben.
Standardisierung und deren Vorteile waren durchaus bekannt. Wichtigstes Beispiel dafür sind die Dachziegel aus Ton, für die es einheitliche Abmessungen gab. Zumindest bei repräsentativen Bauten sind die Ziegel jedoch meistens, die Traufziegel am Dachrand immer individuelle Entwürfe.
Umfassende Darstellung des Tempels bei Cooper and Madigan 1992.
So z. B. am Olympieion in Athen, am Zeustempel von Magnesia und in Diocaesareia; sowie am Mausoleum von Belevi; vgl. Bauer 1973.
Etwa das Geison des Asklepiostempels im Heiligtum des Gottes in Messene; Sioumpara 2011.
Besonders eindrucksvolle Beispiele dafür sind im Mutterland die Frontsäulenstellung des älteren Tempels der Aphaia auf Ägina und im Westen der alte Apollontempel von Syrakus.
Zu dem Tempel im Park von Montrepos auf Korfu vgl. Dinsmoor 1973. Dinsmoor selbst hatte zunächst die Frühdatierung vorgeschlagen.
Überblick bei Fedak 1990.
Der wesentliche technische Unterschied ist der am Rundbau erforderliche, radiale Fugenschnitt der Krepisplatten, Wandquader und Gebälkteile.
In Fällen, wo Tempelbauten niedergelegt und wieder aufgebaut worden sind, spricht man von sog. Wandertempeln. Beispiele dafür bei Alcock 1993, 193.
Die sog. Echohalle im Heiligtum von Olympia, und das benachbarte Gymnasion bestehen beide fast vollständig aus sog. Spolien, also Baugliedern anderer Gebäude.
Ein bekanntes Beispiel dafür sind Säulen vom Olympieion in Athen, die Sulla nach der Eroberung der Stadt abbauen und auf dem Kapitol wieder aufstellen ließ. Auch das bekannte Wrack von Mahdia transportierte Bauglieder, die nachweislich bereits verbaut worden waren.
Vgl. dazu ausführlicher den Abschnitt über Bautechnik im Beitrag zur römischen Architektur im vorliegenden Band.
Zu den wenigen Ausnahmen gehört der Torbogen, der den nordöstlichen Zugang zur Agora von Priene bildet.
Zu den ganz wenigen Arbeiten zum griechischen Bauentwurf, die einen anderen Gebäudetypus behandeln, siehe Riemann 1961 für den Antentempel und Koenigs 1979 für dorische Stoen. Zu Stoen allgemein auch Coulton 1976, wo auch Entwurfsfragen diskutiert sind. Einen Überblick über die ionischen Tempel mit Diskussion der Fragen zum Bauentwurf gibt Knell 1988.
Vor allem in den westlichen Siedlungsgebieten der Griechen gab es auch Ringhallentempel mit vier oder mehr Stufen.
Es gibt Bauten, an denen das nicht der Fall ist. In der Regel ist das ein Hinweis darauf, dass der Architekt bei der Kombination der Rechtecke keine stark gebrochenen Proportionen oder Maße akzeptieren wollte, die sich zwangsläufig ergeben, wenn – wie üblich – die Rechtecke um einen absolut gleichen Betrag vergrößert oder verkleinert werden, wie oben im Text erläutert.
Die Formel ‚Säulenverhältnis
 Stylobatproportion‘ als älteste Form des Entwerfens von Ringhallen wird heute meist nach den Untersuchungen von Jim Coulton (1974b) als ‚early mainland rule‘ angesprochen. Sie war zuvor aber bereits von H. Riemann in seiner Dissertation von 1934 identifiziert worden. Coulton kannte die Arbeit von Riemann offensichtlich noch nicht, als er sein Buch über die griechischen Architekten veröffentlichte. – Der ‚altertümliche‘ Entwurf des Athenatempels von Assos wird meist damit erklärt, dass Assos in der Nähe der ionischen Siedlungsgebiete liegt (an der Westküste der heutigen Türkei), wo man in archaischer Zeit mit dorischer Architektur noch wenig Erfahrung hatte.
Stylobatproportion‘ als älteste Form des Entwerfens von Ringhallen wird heute meist nach den Untersuchungen von Jim Coulton (1974b) als ‚early mainland rule‘ angesprochen. Sie war zuvor aber bereits von H. Riemann in seiner Dissertation von 1934 identifiziert worden. Coulton kannte die Arbeit von Riemann offensichtlich noch nicht, als er sein Buch über die griechischen Architekten veröffentlichte. – Der ‚altertümliche‘ Entwurf des Athenatempels von Assos wird meist damit erklärt, dass Assos in der Nähe der ionischen Siedlungsgebiete liegt (an der Westküste der heutigen Türkei), wo man in archaischer Zeit mit dorischer Architektur noch wenig Erfahrung hatte.
Diese Proportion ergibt sich, wenn man mit
 Einheitsjochen rechnet, und zu dem sich ergebenden Achsgeviert einem Abstand Ecksäulen – Mittelpunkt zu Stylobatkante von drei Zehnteln des Jochs für beide Achsmaße hinzurechnet. Die hier angenommenen drei Zehntel sind ein realisitischer Wert, der konkret vor allem von der Größe des unteren Säulendurchmessers abhängt.
Einheitsjochen rechnet, und zu dem sich ergebenden Achsgeviert einem Abstand Ecksäulen – Mittelpunkt zu Stylobatkante von drei Zehnteln des Jochs für beide Achsmaße hinzurechnet. Die hier angenommenen drei Zehntel sind ein realisitischer Wert, der konkret vor allem von der Größe des unteren Säulendurchmessers abhängt.
D. Mertens, der eine umfassende Monographie der westgriechischen Tempelbauten vorgelegt hat (1984), sind die Proportionen selbstverständlich nicht entgangen, doch hält er sie – aus Gründen, die zu erläutern hier den Rahmen sprengen würde – nicht wie Coulton für entwurfsleitend, und erkennt sie auch nicht als Ergebnis einer Regelanwendung an. Entsprechend erscheinen sie bei ihm auch anders, z. B. als
 statt
statt
 , so dass der Zusammenhang zur Säulenstellung mit
, so dass der Zusammenhang zur Säulenstellung mit
 Säulen weniger evident ist.
Säulen weniger evident ist.
Hephaisteion in Athen, Poseidontempel Sounion, Großer Apollontempel auf Delos, Metroon in Olympia. Es ist zweifelhaft, ob diese Proportion tatsächlich ein konstituierendes Element des jeweiligen Bauentwurfs gewesen ist, denn – abgesehen vom Tempel G in Selinus – gehören die betreffenden Bauten alle zu den klassischen Bauten mit Einheitsjoch, und dürften daher nach Ansicht der meisten Forscher vom Joch her konzipiert worden sein.
Für Riemann war das Normaljoch seinerseits eine abgeleitete Größe, die einem Drittel der Breite der Cella – d. h. der Kulträume innerhalb der Ringhalle – entsprach. Diese Annahme wird nur selten akzeptiert.
Möglichkeiten dazu gab es, doch führt die Unvereinbarkeit beider Entwurfsziele im Ergebnis dazu, dass sich immer Zonen am Bau identifizieren lassen, in denen sich die notwendigen Anpassungen gleichsam zusammendrängen – wo also sozusagen der Preis für den Kompromiss entrichtet wird. Ein Ansatzpunkt in diesem Sinne war, die kontrahierten Eckjoche als eine Art Regulativ zu nutzen: Wenn sich aus dem Rechteck des Stylobats bereits ein annähernd einheitliches Joch ergibt, kann man die restliche Angleichung für das einheitliche Normaljoch dadurch erreichen, dass man das Maß des Frontjochs für das Flankenjoch (oder umgekehrt) einfach übernimmt. Dabei werden die Eckjoche der modifizierten Säulenreihe zwangsläufig gestaucht oder gedehnt. Sie bilden bei solchen Entwürfen dann eine Restgröße, die sich aus der Dehnung der Normaljoche auf ein einheitliches Maß ergibt. Die Eckjoche sind dadurch, im Gegensatz zum Normaljoch, an Fronten und Flanken ungleich.
Vitr. 1.2.4; 4.3.3.
Zu Philon von Byzanz ausführlicher im Abschnitt 2.8.2 über Architekturtexte am Ende dieses Beitrags.
Vitruv benennt – nebenbei bemerkt – diese Proportionsketten nicht ausdrücklich, sondern fordert bei seinen allgemeinen Aussagen stets das modulare Entwerfen. Dieser Forderung entspricht er allerdings nicht bei seinem ionischen, sondern nur bei seinem dorischen Tempelentwurf. Er hat demnach offenbar nicht bemerkt, dass die sich aus den Proportionsketten ergebenden Werte für den ionischen Tempel fast nie kompatibel sind mit dem von ihm benannten Modul. Diese fundamentale Inkonsistenz zwischen seinen theoretischen Forderungen und einem seiner zwei Musterentwürfe zeigt deutlicher als vieles andere, wie begrenzt Vitruvs Verständnis der Strukturen der griechischen Architekturordnungen war.
Vgl. dazu Osthues 2005, Tabelle im Anhang.
Zum folgenden ausführlich Osthues 2005, mit umfangreichen Angaben zur einschlägigen Literatur.
Bei Triglyphen- zu Metopenbreite wie
 und jeweils 2 Triglyphen und 2 Metopen pro Joch ergeben sich insgesamt 6 Zehntel des Jochs für die beiden Metopen und 4 Zehntel für die beiden Triglyphen, also 2 Zehntel des Jochs für jeden Triglyphen.
und jeweils 2 Triglyphen und 2 Metopen pro Joch ergeben sich insgesamt 6 Zehntel des Jochs für die beiden Metopen und 4 Zehntel für die beiden Triglyphen, also 2 Zehntel des Jochs für jeden Triglyphen.
Man kann jedoch einen unbekannten archaischen Architekten auf Sizilien nachweisen, der offensichtlich um einer wirklichen Lösung des Konfliktes willen die genannten konstruktiven und formalen Regeln der Baukunst durchbrochen hat: Der Architekt des sog. Tempels F auf der Akropolis von Selinunt (um 530) hat die Architrave des Ringhalle des Tempels extrem schlank dimensioniert, obwohl das die Bruchgefahr deutlich erhöht haben muss, und zugleich die Triglyphen unkanonisch breit, so dass Architrav- und Triglyphenbreite annähernd gleich waren, und folglich der Konflikt auf diese Weise marginalisiert war; vgl. Osthues 2005, 61ff..
Sicher nachweisbar am Zeustempel in Olympia, begonnen 472.
Vitr. 4.3. 1. Pytheos und Hermogenes galten als ‚Stararchitekten‘ ihrer jeweiligen Epoche. Vitruv nennt zudem den sonst nicht bekannten Architekten Arkesios.
Vitr. 4. 3. 5. Strenggenommen handelt es sich nicht um ‚Halbmetopen‘, sondern um Fragmente von etwa einem Drittel der normalen Metopenbreite.
Xen. mem. 4. 2. 10.
Osthues, Die Architektur des olympischen Metroons, in Vorb.
Coulton 1974b und Coulton 1985. Der 1985 erschienene Beitrag hat eine erweiterte Datenbasis.
Von ihm hängt, bei gegebenen Maßen für den Stylobat und das Normaljoch, ab, wie groß das Eckjoch ausfällt.
Zu den Bauten aus dieser Zeit vgl. Petronotis 1972.
So sind für die Bestimmung der Position der Säulen des Zeustempels von Olympia auf dem Stylobat in die Standplatten Löcher gebohrt und mit Blei ausgegossen worden. In das Blei wurden Achsenkreuze eingerissen, deren Mittelpunkt mit einem Körnerschlag markiert wurde. Das ist im Prinzip dasselbe Vorgehen wie noch heute im Maschinenbau, wenn Bleche an einer exakt ausgemessenen Stelle durchbohrt werden müssen. Am Zeustempel wurde in den Körnerpunkt offenbar der Zirkel eingestochen, mit dem der Standkreis der Säulen auf die Standplatten aufgerissen wurde.
Vgl. als Beispiel dazu die Anweisungen für die Kontrolle des Fugenschlusses der Pflasterplatten des Pteron am Tempel von Lebadeia in der Inschrift IG VII 3073.
Polyklet war ein Bildhauer des 5. Jahrhunderts, der eine – bis auf wenige Fragmente – verlorene Schrift über die ‚richtigen‘ bzw. schönen Proportionen des menschlichen Körpers publiziert hat. Der Begriff ‚Kanon‘ spiegelt dieses Verständnis wider, denn er bezeichnet eine (proportionsbasierte) Regel. Wahrscheinlich haben allerdings schon die älteren Bildhauer der Archaik in der Praxis mit Proportionsregeln für den menschlichen Körper gearbeitet. Dieser Ansatz war möglicherweise aus Ägypten übernommen worden.
Vitr. 1. 2. 3.
Philo. Mech., Paraskeuastika 87, 32.
Vgl. zum Prestige der Architektenarbeit die Belege im Abschnitt über den sozialen Status der Architekten weiter unten in diesem Beitrag, sowie den Schlussabschnitt über das Verhältnis von Architektur und Wissenschaft.
Vitr. 9. praef. 4f. Die geometrische Lösung der Flächenverdoppelung bereits bei Platon (Plat. Men. 82b).
Vitr. 1. 2. 2.
Zu geometrischen Entwurfsanalysen vgl. etwa Theuer 1918; Wolfer-Sulzer 1939; Wedepohl 1967; Hertwig 1968; Petronotis 1972.
Philo. Mech., Paraskeuastika 86, 20.
Vitr. 1. 6. 12.
Xen. Anab. 1. 10. 10.
Vitr. 7. praef. 12.
Siehe zu den Rundtempeln Seiler 1986.
Haselberger 1980; 1983; 1991. Über die Entdeckung hat seinerzeit selbst die Zeitschrift Der Spiegel vom 8.4.1985 berichtet.
Haselberger and Seybold 1991. Siehe auch den Beitrag von Antonio Becchi über die Gestalt der Säule im Band III.
Am Bühnengebäude des Theaters von Aphrodisias; Hueber 1998.
Auf den Orthostaten des Asklepiostempels in Messene; Sioumpara 2011.
Die Platte war als Toichobatplatte mit der Zeichnung nach unten verlegt, so dass sie sicher keine Funktion in dem Kontext hatte, in dem sie endgültig verbaut worden ist.
So Benndorf 1902 und Schlikker 1941.
Hdt. 5. 62.
Vgl. etwa Mertens 1984, 183 Anm. 648f. oder Coulton 1977, 56f..
Das Kapitell ist im Museum des Heiligtums von Epidauros ausgestellt.
IG II2 1678, Z. 11; vgl. ID 1-104 A, Z. 10f.
IG II2 1627.2. 1b Z. 300.
IG II2 1675, Z. 23.
IG II2 1668, Z. 87.
IG XI 2.1, 161 A, Z.75; s. dazu Coulton 1977, 72.
IG II/III2 1666.
Einfügung d. V. für das von Bundgaard 1957 – wohl versehentlich – nicht übersetzte Wort Πεντελη[ι]κα in Zeile 55 der Inschrift.
IG II/III2 1666, Z. 54–61; Übers. Bundgaard.
Deshalb ist auch die teilweise Ergänzung der Formulierung an dieser Stelle als gesichert anzusehen.
Die zitierte Formulierung aus der Prostoon-Inschrift auch in IG II/III2 1685, A, fr. 3, Z. 6; hingegen in IG II/III2 1678 A, fr. b, 4: [… κατὰ τοὺϛ ἀναγρ]αϱέαϛ, τὰ δὲ ἄλλα κατὰ - -, also: einiges gemäß Anagraphé, das andere nach anderen (Angaben); in IG II/III2 1685 B Fr. 5, Z. 6 [… καὶ τοὺϛ ἀν]αγϱαφέαϛ im Gegensatz zu mündlichen Anweisungen (des Architekten) wie ebd. Z. 5: [ὅπω]ϛ ἀν φϱάζει ὁ [ἀϱχιτέκτων…]; vgl. auch IG II/III2 1670, Z. 22: [κ]αὶ τοὺϛ ἀναγϱαφέαϛ ο[ὓϛ ἂν λάβει…] (= die der ausführende Handwerker/Unternehmer bekommt).
IG II/III2 244, Z. 54; 106. Maier 1959–1961, I 45. 46. Maier bezieht sich zudem auf Lattermann 1908, 40f..
Mutulusbreite gleich Triglyphenbreite; Breite beider Viae gleich Metopenbreite minus Triglyphenbreite. Auch an den Architraven ließen sich die betreffenden Maße abgreifen, an der Breite der Regulae bzw. der Zwischenräume zwischen den Regulae.
Philo. Mech., Belopoika 52, 30–47
Vgl. auch Vitr. 2. 9–10.
Stiele häufig aus EscheMartin 1965, 40.
Theophr. lap. 16
Selbst im waldreichen Norden (Makedonien, Thrakien), wo sie noch am ehesten zu erwarten wären, sind reine Holzbauten bisher nicht nachgewiesen. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist vielleicht, dass Vitruv sich dort, wo er auf Vollholz-Bauten zu sprechen kommt (2.1.4), auf so vergleichsweise fernliegende Gebiete wie die nördliche Schwarzmeerküste bezieht.
Theophr. h. plant. 5. 4, 6, wo aber angedeutet ist, dass es sich um eine sehr alte Konstruktion handelt.
Aus Holz dürfte nur das freistehende Bühnenhaus gewesen sein, für den Zuschauerraum nutzte man den Südabhang des Felsens. Temporär errichtete Theaterbauten: z. B. IG XI 158 A.
Theophr. h. plant 5. 7, 4.
Für Klammern wurde vielfach Eisen oder Bronze verwendet, aber selbst am Parthenon oder am Erechtheion waren die Dübel, die die Säulentrommeln verbanden, aus Holz.
Theophr. 5. 6, 4.
Martin 1965, 22–29; Orlandos 1966, I 21–29; Blümner 2004, II 245–297 gibt einen umfassenden Überblick über die bekannten Hölzer und deren Verwendung in allen Gewerken, speziell zum Holz im Bauwesen 311–316; eine weitere Tabelle (nicht nur Bauholz) bei Ulrich 2008, 449. Vgl. auch Meiggs 1982, Kap. 7 und die Appendices zu den einschlägigen Inschriften.
Makedonisches Holz in Delphi und auf Delos, ev. Epidauros: Belege bei Borza 1987, 40 Anm. 36.
Plin. n.h. 16, 141f.
Theophr. 5. 1, 1–5; Ulrich 2008, 448.
Ankauf von zugesägten Brettern: z. B. IG I2 1672 (Eleusis), Z. 146f.,151–153, 156. Vgl. Meiggs 1982, 434f.; Zusägen vor Ort z. B. IG I3 475, 54, 290 (Erechtheion); 476, Z 33, 38f. (Sägen durch spezielle Arbeiter im Tageslohn).
Theophrast erwähnt, dass das Zypressenholz für Decken und Türen am jüngeren Artemision von Ephesos vier Generationen abgelagert worden war, h. plant. 5. 4, 2.
Siehe vorhergehende Anmerkung zum Erechtheion.
Beispiele für das Verdübeln, Verzapfen und Verklammern von Holzbauteilen bei Orlandos 1966, I, S. 46.
Die Verklammerung von Brettern untereinander durch sogenannte Schwalbenschwanz-Klammern – bei Steinbauten sind Holzklammern häufiger nachgewiesen – könnte m. E. aus dem Zimmermannshandwerk stammen.
Wittenburg 1978, 66; Ankauf Klebstoff in Eleusis: IG II2 1672, 161.
Poll. X 188.
Theophr. h. plant 5. 5, 6.
Tabellarische Übersicht bei Martin 1965, 32f..
IG II2 1672, Z. 146; cf Meiggs 1982, 437. Es handelt sich um drei Bretter vom formal
 (nicht wie bei Meiggs irrtümlich angegeben
(nicht wie bei Meiggs irrtümlich angegeben
 ), die zusammen 70 Drachmen kosteten.
), die zusammen 70 Drachmen kosteten.
ID III 5, 36, Z. 15f. (Delphi, Holz aus Sikyon); IG II2 1672, Z. 124f.; vgl. Martin 1965, 32 Anm. 6.
Akrai: Not. Scavi 24, 1970, 438ff.; Syrakus: Not. Scavi 25, 1971, 575ff.
Siehe für Selinunt Durm et.al. 1905, Abb. 62.
Nach Müller-Wiener (1988) wurden größere Steine durch aufgequollene Holzkeile, kleinere durch eingeschlagene Eisenkeile abgesprengt.
Nachweise bei Müller-Wiener 1988, 44 Anm. 6.
Über Ziegel ausführlich Martin 1965, 46–64; über Formziegel Lauter 1986, 53ff.; zu Wohn- und Nutzbauten mit Lehm und Formziegeln s. Hoepfner and Schwandner 1994.
Heiden 1985, 195; zur Forschungsgeschichte der Dachziegel Hueber 1998; neuerer Überblick bei Hellmann 2002, 298–326.
Die Lehmbettung wird erwähnt in der sog. Arsenal-Inschrift IG II2 1668 und in der Inschrift über die Ausbesserung der ‚Langen Mauern‘ von Athen zum Piräus IG II2 463; vgl. dazu auch die Angaben bei Martin 1965, 48 Anm. 4–6.
Eine solche Prüfplatte ist abgebildet bei Martin 1965, Abb. 23.
Eine zusammenhängende Darstellung der mit der Logistik des griechischen Bauwesens verbundenen Fragen ist bisher nicht publiziert worden. Eingehender behandelt werden Fragen der Logistik bei Martin 1965; Müller-Wiener 1988; Orlandos 1966; technische Analysen im Sinne der Mechanik finden sich bei Cotterell and Kamminga 1990. Eine beispielhafte und brilliant illustrierte Darstellung für den Transport vom Steinbruch bis zur Baustelle gibt Korres 1995.
Aen. Tact. 16,14.
Plut. Cato mai. 5.3.1
IG II2 1673.
Diod. 4,80,5f.
Vgl. im Beitrag zum römischen Bauwesen im vorliegenden Band den Abschnitt über Logistik.
Für Epidauros z. B. IG IV2 103 A Z. 30.
Plin. n. h. 36.47.
Vgl. dazu ausführlicher und mit Abbildungen den Beitrag von Uwe Sievertsen über den Alten Orient im Band I.
Eigene Erfahrung des Autors.
IG IV2 103 A Z. 47f. und 63f.
Philo. Mech. VII/VIII 99, 34f.
Vitr. 10. 2, 11–14. Der Architekt Chersiphron (s. u.) wird auch vom älteren Plinius erwähnt.
Zu den griechischen Architekturschriften ausführlicher am Schluss dieses Beitrags.
Zu dieser Diskussion ausführlich Svenson-Evers 1996, 67–99.
Zu Hebetechniken Coulton 1974a; Wilson 2008, 342–45 sowie die einschlägigen Kapitel bei Martin 1965 und bei Müller-Wiener 1988.
Ähnliche Einarbeitungen sind auch beim archaischen Vorgängerbau des Tempels der Athena Alea in Tegea gefunden worden, der ebenfalls Holzsäulen gehabt haben muss.
So bei Coulton 1974a, 7. Ihm folgt Wilson 2008, 342. Gegen diesen zeitlichen Ansatz spricht m. E., dass es Hunderte von Architraven gibt, an denen sich weder Wolfs- noch Zangenlöcher finden, und die trotzdem sicherlich nicht alle mit Hilfen von Rampen in Position gezogen worden sein dürften.
Arist. mech. 851b19; 853a32–853b13.
Vitr. 10. 2, 1–10.
Heron, s. Mechanicorum Fragmenta III 2, p. 294. Vgl. Drachmann 1956, 658–662.
Nicht alle Bossen, die man beobachten kann, sind Hebebossen. Es gibt auch Werkstücke, wie beispielsweise Stufenplatten, an denen Bossen nur an einer Seite vorhanden waren. Da nicht symmetrisch vorhanden, können diese Bossen nicht zum Heben gedient haben. Sie wurden als Ansatzpunkte für Stemmeisen genutzt, um die später sichtbaren Flächen beim Anstemmen nicht zu beschädigen.
Am ausführlichsten immer noch Martin 1965, 179–189.
Bereits erwähnt bei Hom. Od. 9, 384–86.
Funde griechischer Werkzeuge sind, gemessen an ihrer anzunehmenden Verbreitung, relativ selten. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass das Eisen, aus dem sie hergestellt waren, bei Funden meist bis zu völligen Unkenntlichkeit korrodiert ist – Werkzeuge aus Bronze (etwa aus mykenischer Zeit) lassen sich viel häufiger in guten Erhaltungszustand finden. Bildliche Darstellungen auf Reliefs, wie man sie in großer Zahl von römischen Grab-stelen kennt, fehlen weitestgehend für Griechenland. Dafür gibt es in der Vasenmalerei häufiger Darstellungen von Handwerkern bei der Arbeit in ihren Werkstädten. Dort sind auch Werkzeuge dargestellt.
Vgl. dazu die Diskussion bei Schwandner 1991, 216ff..
Einige Angaben auch zu den im Bauwesen verwendeten Instrumenten bei Lewis 2001.
IG II/III2, 1678.
LSJ s. v. ἄκαινα.
Wegen der antiken A-Form wird noch heute im Neugriechischen die Wasserwaage als αλφάδι bezeichnet.
Hom. IL 2, 765.
s. o. unter Logistik.
Vitr. 3. 4. 2.
Diels and Schramm 1920 = Philo. Mech. 100, 55.
Etwa in IG I2 94.28; IG I2 4. 39; s. Wittenburg 1978, 69f..
Abrechnung eines geliehenen Flaschenzuges zum Einsatz im Demeterheiligtum von Eleusis IG II2 1672, Z. 235.
Für Eleusis IG II2 1682, 1666 und 1668; auf Delos ID 507, vgl. auch Vitr. 1. 5.
Die Quellen zu Theodoros sind zusammengestellt und besprochen bei Svenson-Evers 1996, 7–49.
Plini. n. h 36-95-97. Vgl. auch Diog. Laert. 2. 103.
Vitr. 3. 4. 2.
Ausführlicher dazu Cooper 2008, 231f..
Plin. n. h. 36, 71f.; Vitr. 2. 8. 5-7.
Benannt nach Aristot. Eth. Nicom. 1137 b 30. Zur Mauerwerk s. Scranton 1941, 25ff..
Korinth, Apollontempel; Syrakus, Apollontempel und andere. Einer der letzten Bauten, an dem – nicht alle – Schäfte aus einem einzigen Stein gearbeitet waren, ist der spätarchaische Aphaiatempel auf Ägina.
Bei der Wiederaufstellung einer Säule des Zeustempels in Olympia vor wenigen Jahren wurde genauso verfahren. Als Touchierfarbe wurde dabei Kreide verwendet.
Die Bauzeit des Parthenon von neun Jahren gilt, gemessen an der Größe des Gebäudes, als ungewöhnlich kurz. Sie kann auch kaum durch den massenhaften Einsatz von Arbeitskräften erklärt werden, da auf der Baustelle fast ausschließlich Arbeiten für hochqualifizierte Handwerker anfielen.
Einen großen Einfluss auf die Stabilität einer Säulenstellung hat zudem das Gebälk, da es die gegenseitige Stabilisierung der Säulen bewirkt. Deshalb sind viele der heute noch aufrecht stehenden, nicht modern rekonstruierten Säulen sind durch Architrave verbunden. Zu den ältesten Beispielen dafür zählen die erhaltenen Joche am Apollontempel von Korinth und am Apollontempel von Syrakus.
Siehe oben Seite
Überblick über die Forschungsergebnisse und weitere Literatur bei Tuchelt 1991, insb. 38f..
Pausanias weist ausdrücklich darauf hin, dass die seit ältester Zeit wichtige Verbindungsstrasse zwischen Megara und Korinth, die den Landweg auf die Peloponnes darstellte, durch den Kaiser Hadrian auf die doppelte Wagenbreite ausgebaut wurde; Paus. 1.44.6
Zusammenfassende Untersuchungen zum Brückenbau sind bisher nicht vorgelegt worden.
Eleusis, IG I3 79.
Plin. n.h. 4.1.4.
Dem Wortlaut des Textes zufolge überbrückte sie den Archeron, doch ergibt sich aus dem Kontext eindeutig, dass der Arachthos gemeint sein muss, da Plinius angibt, dass der Fluss in den ambrakischen Golf mündet, was für den Archathos, nicht aber für den weiter nördlich fließenden Archeron zutrifft.
Es ist möglich, dass die von Plinius erwähnte Brücke ein Vorgängerbau der heute noch vorhandenen osmanischen Steinbrücke bei Arta war (die allerdings nur etwa 130m lang ist). Arta, das antike Ambrakia, hatte der König Pyrrhos von Epirus 295 zu seiner Hauptstadt gemacht und befestigen lassen. Es ist daher denkbar, dass Pyrrhos auch eine Brücke über den Arachthos schlagen ließ.
Erwähnt bei Thuk. 4.103.5; 4.108.1 im Zusammenhang mit der Einnahme von Amphipolis durch den spartanischen Heerführer Brasidas im Jahr 424. Da die Gegend wegen ihres Schiffbauholzes strategische Bedeutung hatte, liegt es nahe, eine Holzbrücke anzunehmen.
Strab. 9.2.2; 9.2.8; 10.1.8.
Solcher Mörtel wurde erst von den Römern verwendet, vgl. den entsprechenden Abschnitt im Beitrag über das römische Bauwissen im vorliegenden Band.
Hdt. 4.83–89; 137.41.
Sie wurden zunächst von einem Sturm zerstört, ihre – phönizischen und ägyptischen – Baumeister hingerichtet. Danach wurde die Brücke aber erfolgreich repariert (Hdt. 7.34–36 mit detaillierter Beschreibung der Konstruktion).
Hdt 3. 60. 3.
Sicher den Hafenbau behandelt hat Philon von Byzanz im dritten Buch seiner Mechanik (‚Limenopoika‘, um 200). Ob die zehn Bücher ‚peri limenon‘ (‚über Häfen‘, etwa 280–60) des ptolemaischen Admirals Timosthenes aus Rhodos auch die Technik des Hafenbaus behandelten, ist unbekannt; sicher waren sie zum praktischen Gebrauch für die Kapitäne bestimmt, unter anderem durch die dort gegebenen Entfernungsangaben. Der Abschnitt über Hafenbau bei Vitruv (5. 12) bezieht sich auf die erst von den Römern verwendeten Techniken.
Überblick über den aktuellen Forschungsstand bei Blackman 2008; umfassende Untersuchung zum Hafenbereich des Apollonheiligtums und des späteren Freihafens auf Delos, in: Duchêne and Fraisse 2001.
Strab. 14.2.5.
Die südwestliche der Molen reicht noch heute über die Wasseroberfläche, die südöstliche nicht.
Strab. 14.1.24.
Inhaltlich am breitesten angelegt ist Coulton 1977. Die Testimonien zu den Baumeistern der archaischen und klassischen Zeit hat Svenson-Evers 1996 gesammelt; vgl. dazu auch Eiteljorg 1973, sowie Müller 1989b und – allgemeiner für die Handwerksberufe in Griechenland und Rom – Burford 1972.
Hdt. 3.60; 4.87. Nicht ganz sicher ist die Erwähnung in einem Theaterstück von Aischylos.
Athen: Aristot. Ath. Pol. 46.1.5; Inschrift auf einer Statuenbasis aus Paphos auf Zypern, Rehm 1958, Nr. 27 (= OGIS 39); Diod. 4. 41. 3. 3.
Vitr. 1. 3 und Buch 10.
Polyb. 8. 7. 2.
Der Vortrag wurde zuerst abgedruckt in: Allgemeine Schweizer Zeitung, 259–261 vom 1.–3. November 1883; s. Burckhardt 2003, 397–405.
So etwa von Chr. Höcker in DNP s. v. Architekt; Müller-Wiener 1988, 19; contra: Philipp 1968; siehe auch Lauter 1974.
Hom. Il. th 492, lambda 523.
Hdt. 2. 165.
Hdt. 2. 167. Die Stellung Korinths beruhte vor allem auf Handwerk und Handel.
Vgl. dazu die Quellenangaben bei Burford 1972, 129 Anm. 334; zur Verachtung der Handarbeit bei den Stoikern Plut. Mor. 1034 b7; c1.
Plat. pol. 259e-260a.
Plat. Phil. 55d – 56a.
Plat. Gorg. 512b. Der Architekt wird an der angegebenen Stelle als ‚Ingenieur‘ bezeichnet (Mechanopoios). Die Trennung zwischen Architekt und Ingenieur war aber noch im 2. Jahrhundert nicht fest etabliert. Vgl. dazu unten.
Aristot. Magna Moralia 1198a32–1198b. Die Zuschreibung des Werks an Aristoteles ist umstritten; die Stelle gibt jedoch zweifelsfrei Aristoteles' Auffassung in dieser Frage wider, da sich Aristoteles auch an anderer Stelle im selben Sinne geäußert hat (vgl. etwa die in der folgenden Anmerkung genannte Passage aus seiner Politik).
Aristot. pol 1325b23.
Diod. 1. 64. 12.
Der einzige Aufsatz, der unmittelbar den Bauleuten gewidmet ist, ist der Aufsatz von Randall 1953 über die Handwerker des Erechtheion. Vergleichsweise ausführlich ist noch der Abschnitt über die Unternehmer in Epidauros in Burford 1969, 45–158.
Die entsprechenden Arbeiten sind hier meist schon genannt worden. Für Delos: Davis 1937, (Verträge aus Delos); Akropolis, klassische Zeit: Wittenburg 1978; speziell Erechtheion: Randall 1953; Maier 1959–1961; Überblick über die Art der Dokumente: Scranton 1960; Burford 1971, Zweck der antiken Dokumentation.
Text: IG IV2 Nr. 102; engl. Ü.: Burford 1969, 212ff.. Zur Diskussion der Bauinschriften aus Epidauros vgl. Burford 1969 und zuletzt Gounaropoulou 1983. Die Inschrift enthält nicht die Verträge selbst, sondern eine Übersicht über die Verträge mit Angabe des Unternehmers, der Bürgen, der Leistung und der Kosten. Die Zeilen 18 und 19 der Inschrift, die wegen ihrer Position weitere Verträge über die Arbeiten in Stein enthalten haben müssen, sind nicht mehr lesbar.
Die Metallarbeiten für den Asklepiostempel wurden von zwölf verschiedenen Vertragspartnern geliefert, Burford 1969, 156.
Bekannt sind Strafen für schlechte Arbeitsqualität nicht für den Asklepiostempel, wohl aber für die einige Jahrzehnte jüngere Tholos in Epidauros; vgl. Burford 1969, 106f..
Mit Ausnahme wiederum von Antimachos, der in den ersten beiden Jahren vor Ort – und in einem Steinbruch – arbeitete.
Nur zu Anfang der Inschrift ist die Herkunft der Unternehmer genannt.
Dagegen spricht, dass Theodotos sicher nicht der Architekt des nächsten großen Projektes im Heiligtum – der Tholos – war, für die in den Quellen Polyklet von Argos genannt wird (zu ihm s. Svenson-Evers 1996, 415ff.).
Zum Niketempel und zum Erechtheion oben ab S.
Für die Architektur immer noch grundlegend ist Knackfuß 1941.
Begonnen wohl noch vor 300, Bauaktivitäten bis zur Zeit des Kaisers Hadrian im 2. Jahrhundert n. Chr.
Das inschriftliche Material ist zusammenfassend dargestellt und interpretiert bei Voigtländer 1975.
Z. B. Rehm 1958, 34 (datiert 180/79).
McCabe 112.
Ebd. Zeile 4f.
Vitruv (7. praef. 16) weiß von dem archaischen Vorgängerbau nichts und ordnet alle ihm bekannten Namen von am Didymaion tätigen Architekten demselben Bau zu, was sicher nicht zutrifft. Im allgemeinen rechnet die Forschung Demetrios dem hellenistischen Neubau zu. Vgl. dazu ausführlicher Svenson-Evers 1996 s. v. Demetrios.
Vitr. 7. praef. 12.
Die zweite Liste (Vitruv 7. praef. 14) folgt auf die erste, getrennt nur durch einen Absatz über die Bildhauer, die den Skulpturenschmuck des in der Liste erwähnten Mausoleums von Halikarnass geschaffen haben. Fensterbusch versteht in seiner Übersetzung entsprechend die zweite Liste als Fortsetzung der ersten, und ergänzt in diesem Sinne den Wortlaut des Textes (minus nobiles
 „… weniger berühmte [Architekten])“. Zweifel an dieser Deutung ergeben sich jedoch aus mehreren Gründen. Einige der Namen, die Vitruv nennt, sind als Namen von Malern, Bildhauern und Bronzegießern nachgewiesen, keiner jedoch sicher als Name eines sonst bekannten Architekten. Allenfalls der Leonidas der Liste könnte der Architekt des sog. Leonidaions in Olympia sein, wenn Leonidas tatsächlich der Architekt des Baus war und nicht sein Bauherr (Svenson-Evers 1996, 380ff.), bzw. wenn nicht der im 4. Jahrhundert lebende Maler Leonidas von Vitruv gemeint ist. Zudem erwähnt Vitruv – anders als in der ersten Liste – keine Kommentare zu Bauwerken, sondern spricht von Schriften über ‚Symmetrien‘ (= Proportionslehren), was insbesondere für Bildhauer plausibel wäre, die im Gefolge von Polyklets berühmten Kanon der menschlichen Proportionen eigene Beiträge zu diesem Thema veröffentlichten.
„… weniger berühmte [Architekten])“. Zweifel an dieser Deutung ergeben sich jedoch aus mehreren Gründen. Einige der Namen, die Vitruv nennt, sind als Namen von Malern, Bildhauern und Bronzegießern nachgewiesen, keiner jedoch sicher als Name eines sonst bekannten Architekten. Allenfalls der Leonidas der Liste könnte der Architekt des sog. Leonidaions in Olympia sein, wenn Leonidas tatsächlich der Architekt des Baus war und nicht sein Bauherr (Svenson-Evers 1996, 380ff.), bzw. wenn nicht der im 4. Jahrhundert lebende Maler Leonidas von Vitruv gemeint ist. Zudem erwähnt Vitruv – anders als in der ersten Liste – keine Kommentare zu Bauwerken, sondern spricht von Schriften über ‚Symmetrien‘ (= Proportionslehren), was insbesondere für Bildhauer plausibel wäre, die im Gefolge von Polyklets berühmten Kanon der menschlichen Proportionen eigene Beiträge zu diesem Thema veröffentlichten.
Erhaltene authentische Texte griechischer Architekten sind allein die inschriftlich erhaltenen ‚Bauanweisungen‘ und vertraglichen Leistungsbeschreibungen, von denen bereits die Rede war, die jedoch nicht als Fachliteratur angesprochen werden können, weil sie praktischen Funktionen im Bauprozess dienten und nicht der Dokumentation von Wissen.
Vitruv sagt 7 praef. 12 etwa, Theodoros (von Samos) habe ein Buch über den dorischen Heratempel auf Samos geschrieben (aede Iunonis, quae est Sami dorica), obwohl die beiden infrage kommenden Dipteroi ionischer Ordnung sind. Es ist kaum vorstellbar, dass Vitruv ein solch fundamentaler Fehler hätte unterlaufen können, wenn er den Text des Theodoros selbst gelesen hätte (oder den Tempel mit eigenen Augen gesehen hätte). – Da die Handschriften in diesem Punkt nicht variieren, ist die falsche Angabe kaum den Kopisten anzulasten.
Vitr. 7. praef. 1ff.
Vitr. 7 praef. 12. Nur für den – ansonsten nicht bekannten – Seilenos gibt Vitruv kein Bauwerk an. Satyros, der gemeinsam mit Pytheos über das Mausoleum von Halikarnass schrieb, ist nur als Bildhauer bekannt, so dass unklar bleibt, ob er auch als Architekt tätig war. Vorstellbar wäre, dass Satyros in der Schrift ausschließlich über das Skulpturenprogramm des Baus, bzw. seinen eigenen Beitrag dazu, geschrieben hat.
Vitr. 7 praef. 16.
Zur Problematik der Zuschreibung vgl. Svenson-Evers 1996, 7–49.
Der Frühdatierung würde die Nachricht bei Diog. Laert. 2. 103 entsprechen, dass bei der Fundamentierung des ephesischen Tempels im sumpfigen Untergrund des Artemis-Heiligtums Theodoros beratend hinzugezogen wurde, was chronologisch und technisch Sinn macht: Da der erste samische Dipteros früher begonnen worden ist als das Artemision, und gleichfalls in sumpfigem Gelände errichtet worden war, wäre es naheliegend, Theodoros hinzuzuziehen als einen Architekten, der die in Ephesos bestehende Problematik auf Samos bereits erfolgreich bewältigt hatte. Die Pointe wäre dann allerdings, dass Theodoros gewissermaßen zu Unrecht als Experte für schwierige Fundamentierungen gegolten hätte, denn neueren Forschungen zufolge ist der erste Dipteros nach wenigen Jahrzehnten eingestürzt, und zwar eben aufgrund mangelnder Fundamentierung.
Vitr. 1.1.12.
Vitr. 7. praef. 12.
Vitruv spricht von scapos columnarum.
Vitrr 10. 2. 11, Übers. Fensterbusch.
Plin. n. h. 36, 96f.
Pollux 10, 188, 2–4. Auf dieses Zitat hat H. Svenson-Evers aufmerksam gemacht.
Xen. mem. 4. 2, 8–11. Vgl. dazu Coulton 1977.
Vitr. 6. praef. 4.
Ob Leonidas von Naxos den Bau nicht nur finanziert, sondern auch selbst entworfen hat, ist allerdings strittig; vgl. Svenson-Evers 1996 s. v.
Der Architekt des Baus, Sostratos von Knidos, erhielt die ungewöhnliche Ehre, seinen eigenen Namen in der Bauinschrift des königlichen Projekts nennen zu dürfen.
Vitr. 1.1.12.
Der Text der Exzerpte und eine deutsche Übersetzung bei Diels and Schramm 1920. Die Exzerpte lassen nicht sicher erkennen, wie sich die überlieferten Abschnitte auf die ursprünglichen Bücher verteilten, jedoch dürften die zu Anfang der Exzerpte erhaltenen Passagen über die Anlage von Stadtmauern dem siebten Buch (Paraskeuastiká, ‚Vorbereitungen zur Städteverteidigung‘) entnommen sein.
Vgl z. B. Phil. Mech. belopoika 59.37.
Philo. Mech., Paraskeuastika 87.33ff.
Diog. Laert. 9. 49 spricht von der Schrift des Demokrit über den Tempel in Ephesos, die Stadt und über Samothrake. Athenaios (deipn. 12. 525 C), bezeichnet Demokrit als Ephesier, und zitiert aus den „zwei Büchern“ über den Tempel. Da der Tempel an beiden Stellen nicht näher bezeichnet wird, kann es sich nur um ‚den‘ Tempel von Ephesos, also das weltberühmte Artemision, handeln.
Die Belegstellen sind zusammengetragen und übersetzt von Brodersen 1992.
VI 2, Übers. Brodersen 1992b.
Strab. 1.3.11.
Vitr. 1. 1. 17.
Plat. Phil. 55d–56c. Vgl. dazu auch oben den Abschnitt über den sozialen Status der Architekten.
Eukl. opt. 63 Prop. 19–22.
Vitr. 3. 5. 10.
Vgl. Coulton 1977, 67–68; Mertens 1984, 50; vgl. die teilweise sehr stark gebrochenen Werte für das ionische Gebälk bei Knell and Wesenberg 1984, 108 Tab. 6.
Sein Beispiel ist die Flächenverdoppelung eines Quadrats mit zehn Fuß Seitenlänge, also einer Fläche von hundert Quadratfuß auf zweihundert Quadratfuß. Vitruv (9. praef. 4) sagt hier ganz schlicht, dass eine rechnerische Lösung nicht möglich sei, weil als Seitenlänge des zu suchenden Quadrats 14 Fuß zu wenig, 15 Fuß zu viel seien. Die Bestimmung der gesuchten Seitenlänge anhand des Satzes des Pythagoras zieht er – der sonst die Wissenschaftlichkeit der Architektur stets betont – offenbar wegen der dort auftretenden Quadratwurzel nicht einmal in Betracht. Stattdessen gibt er als Lösung die Zeichnung eines Quadrats über der Diagonalen der originalen Quadrats an.
Solche Näherungskonstruktion wurden etwa von den spätmittelalterlichen Baumeistern in Deutschland benutzt. Sie sind beschrieben im 1484 gedruckten Buch von Matthäus Roriczer.
Scriba 2010, 215.
Philo. Mech., Belopoika 4, 7 (51,51).