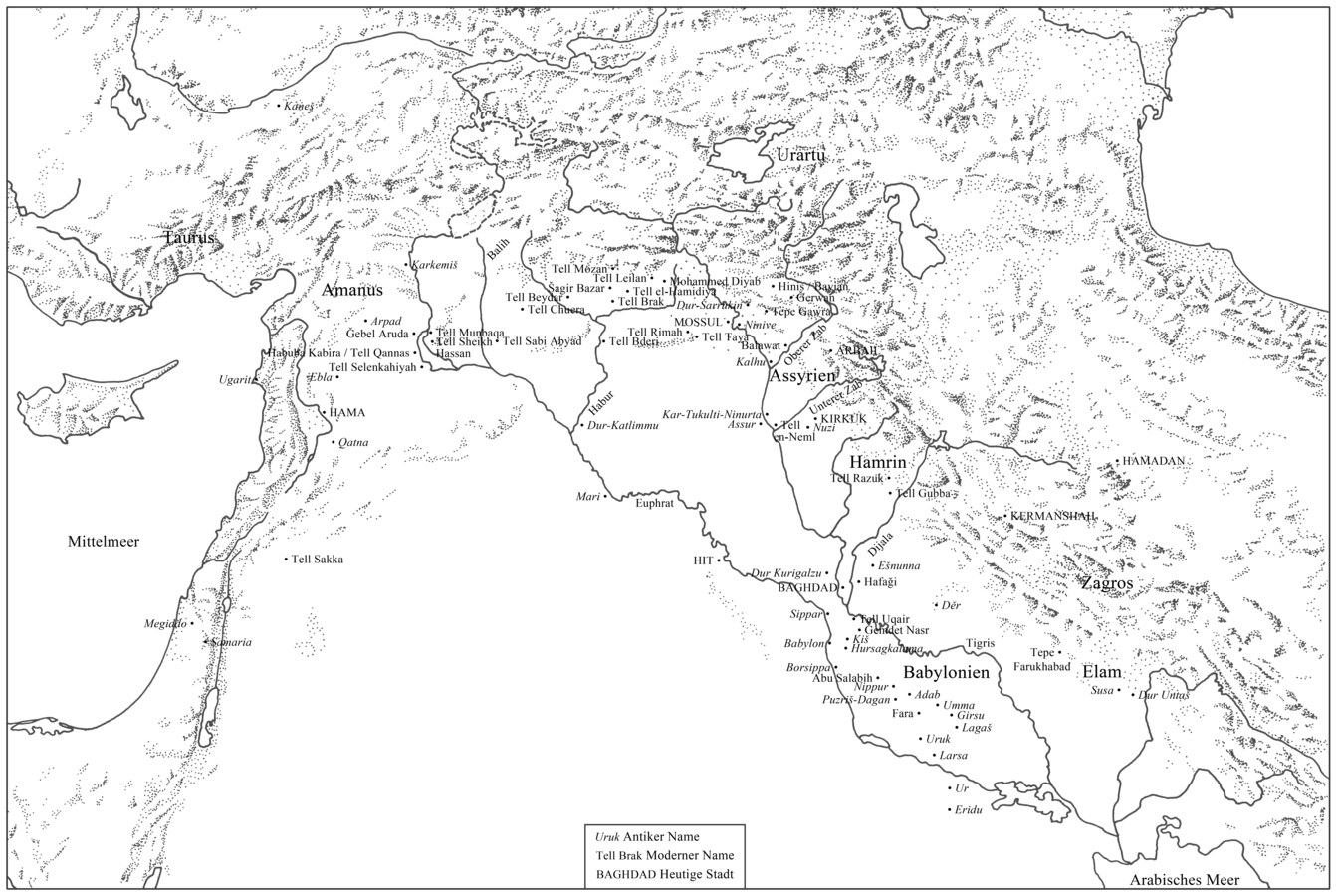3.1 Einleitung
3.1.1 Naturräumliche Bedingungen
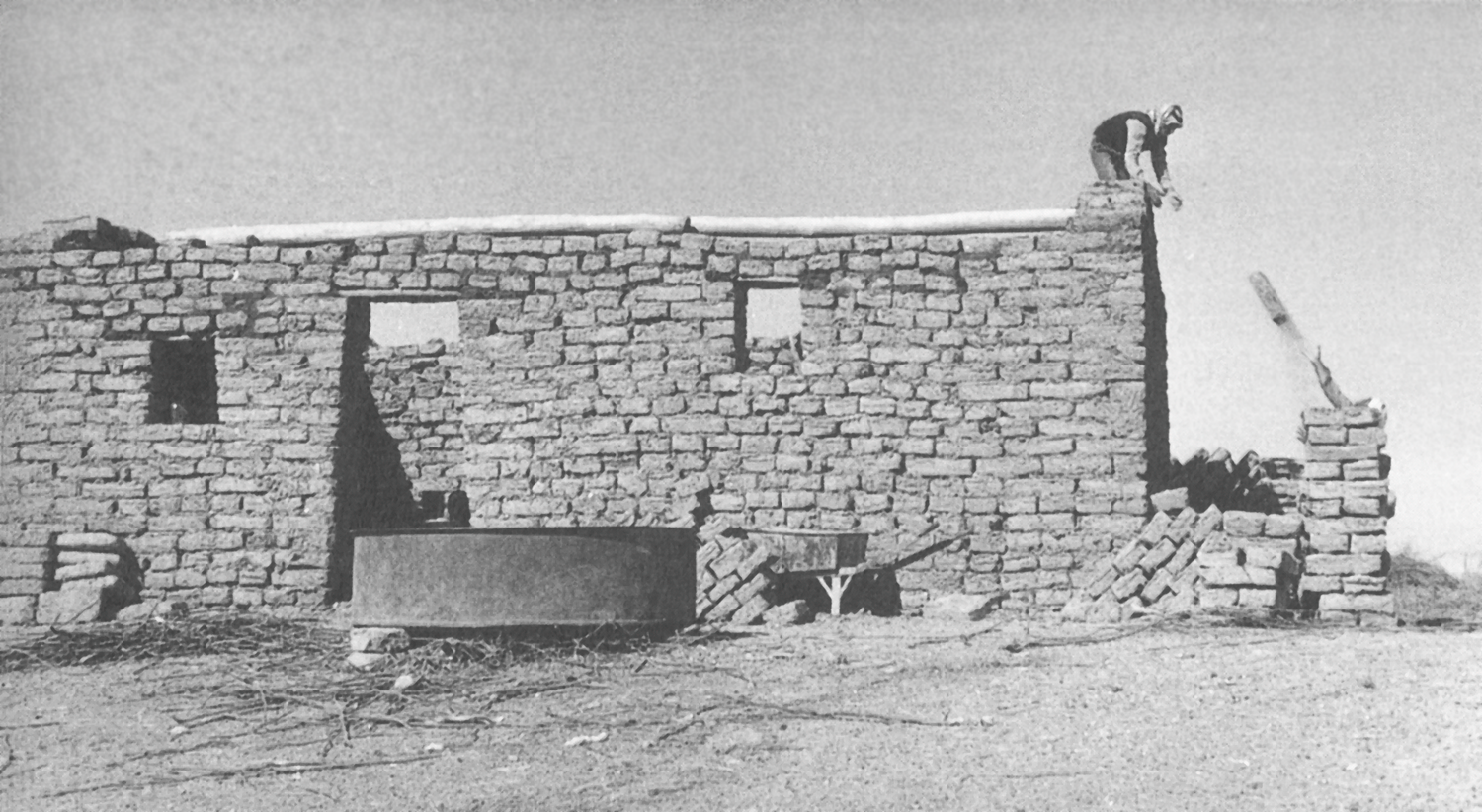
Abb. 3.1: Traditioneller Lehmziegelbau im syrischen Euphrattal
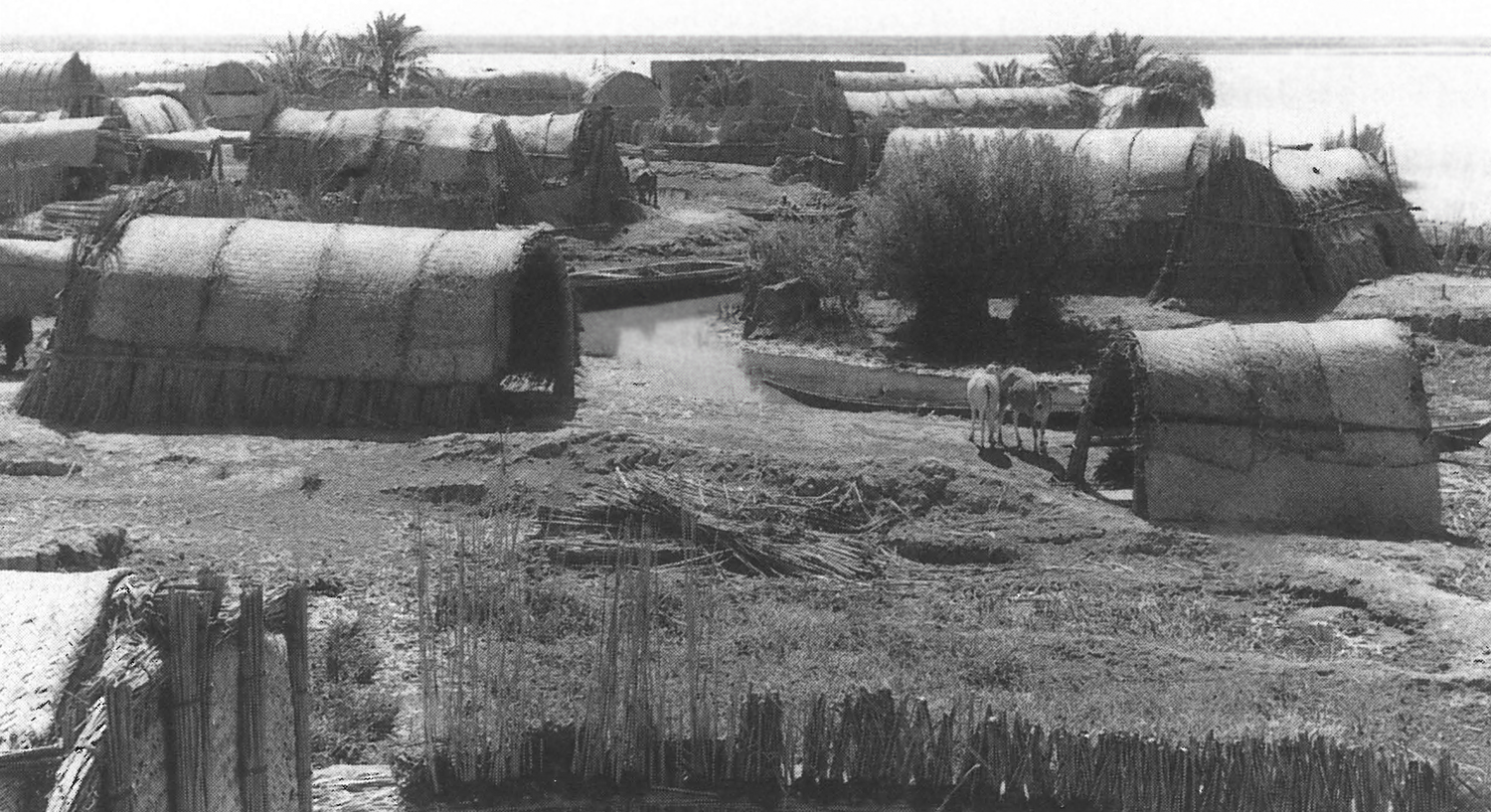
(Foto: Heinz Westphal).
Abb. 3.3:
(Foto: Heinz Westphal).
Schilfbauten, die sich von solchen auf altorientalischen Bilddarstellungen kaum unterscheiden, sind bis in die Gegenwart vor allem in den unzugänglichen Sumpflandschaften am Zusammenfluss von Euphrat
3.1.2 Historischer Rahmen und Gesellschaftsstrukturen
Grundsätzlich ist bei einer Betrachtung des altorientalischen Bauwesens zu berücksichtigen, dass es – selbst wenn man sich auf die vorderasiatischen Kernlandschaften Mesopotamien
Das 4. Jahrtausend v. Chr. etwa ist, nachdem es über lange Zeit nur dörfliche Ansiedlungen und allenfalls etwas größere Zentralorte gegeben hat, in Süd
| Ubaidzeit | (5. Jt. v. Chr.) |
| Urukzeit | (4. Jt. v. Chr.) |
| Frühdynastische Zeit | (Anfang bis Mitte des 3. Jt. v. Chr.) |
| Akkadzeit | (24.–22. Jh. v. Chr.) |
| Ur III-Zeit | (spätes 22.–21. Jh. v. Chr.) |
| Isin-Larsa-Zeit | (ausgehendes 3. bis frühes 2. Jt. v. Chr.) |
| Erste Dynastie von Babylon | (1894–1595 v. Chr.) |
| Kassitische Zeit | (16.–12. Jh. v. Chr.) |
| Mittani-Zeit | (Mitte des 2. Jt. v. Chr.) |
| Mittelassyrische Zeit | (15.–11. Jh. v. Chr.) |
| Neubabylonische Zeit | (frühes 1. Jt. v. Chr.) |
| Neuassyrische Zeit | (10.–7. Jh. v. Chr.) |
| Spätbabylonische Zeit | (spätes 7.–6. Jh. v. Chr.) |
| Achämenidenzeit | (6.–4. Jh. v. Chr.) |
| Seleukidenzeit | (4.–2. Jh. v. Chr.) |
Tab. 3.1: Chronologische Übersicht zum Alten Orient.
Tab. 3.1: Chronologische Übersicht zum Alten Orient.
Schon bald entwickelten sich aus den städtischen Zentren kleinere Stadtstaaten, gekennzeichnet durch ein Wirtschaftssystem aus autonomen Tempel-, Palast- und Privathaushalten, und schließlich im späteren Verlauf des 3. Jahrtausend v. Chr. die ersten größeren Territorialstaaten, das Reich von Akkade sowie der Beamtenstaat der 3. Dynastie von Ur.8 Die zunehmende Erweiterung des geographischen Horizonts und der politischen Handlungsspielräume in jenen Jahrhunderten spiegelt sich in der in unterschiedlichen Quellen überlieferten Ausstattung der wichtigsten Heiligtümer mit Architekturelementen und Inventar aus exotischen, über große Entfernungen heran transportierten Materialien wider.9
Immer wieder folgten jedoch auch längere Perioden, in denen mehrere etwa gleich starke Zentren um die Macht konkurrierten, wie etwa während der Isin-Larsa-Zeit im frühen 2. Jahrtausend v. Chr., bis es dann schließlich einzelnen Dynastien gelang, erneut die Kontrolle über größere Teile des Zweistromlands
Das neuassyrische Großreich, dessen gewaltige Städtebauprojekte nur mit Hilfe des Einsatzes Tausender Kriegsgefangener und Deportierter aus den unterworfenen Gebieten realisiert werden konnten, erstreckte sich in der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. zeitweise vom assyrischen Kernland bis nach Südostanatolien
Die durch die schriftlichen und archäologischen Quellen bezeugten Blütephasen einzelner Stadtfürstentümer, Reiche und Großreiche wie auch die meist weniger gut dokumentierten Verfallszeiten haben im stark von wirtschaftlichen Faktoren geprägten Bauwesen sehr häufig ihren unmittelbaren Niederschlag gefunden. So wird bspw. deutlich, dass gerade in Zeiten schwacher Zentralgewalt, ungeklärter Machtverhältnisse und politischer Wirren die Verantwortung für die Instandhaltung und den Wiederaufbau der Heiligtümer vielfach vom König auf die lokalen Autoritäten überging. Bauinschriften, die dies erweisen, liegen insbesondere für Babylonien aus den ersten Jahrhunderten des 1. Jahrtausends v. Chr. vor.13
3.1.3 Standard-Bauaufgaben und besondere Architekturleistungen
Dass dem Bauwesen in den altorientalischen Kulturen eine prioritäre Bedeutung zugekommen ist, bezeugen nicht zuletzt die zahlreichen Darstellungen von Bauten und Baumaßnahmen in der Bildkunst etwa der frühsumerischen Kultur des späten 4. Jahrtausends v. Chr. (Abb. 3.4) oder der neuassyrischen Zeit (Abb. 3.27, 3.28, 3.29, 3.30).14
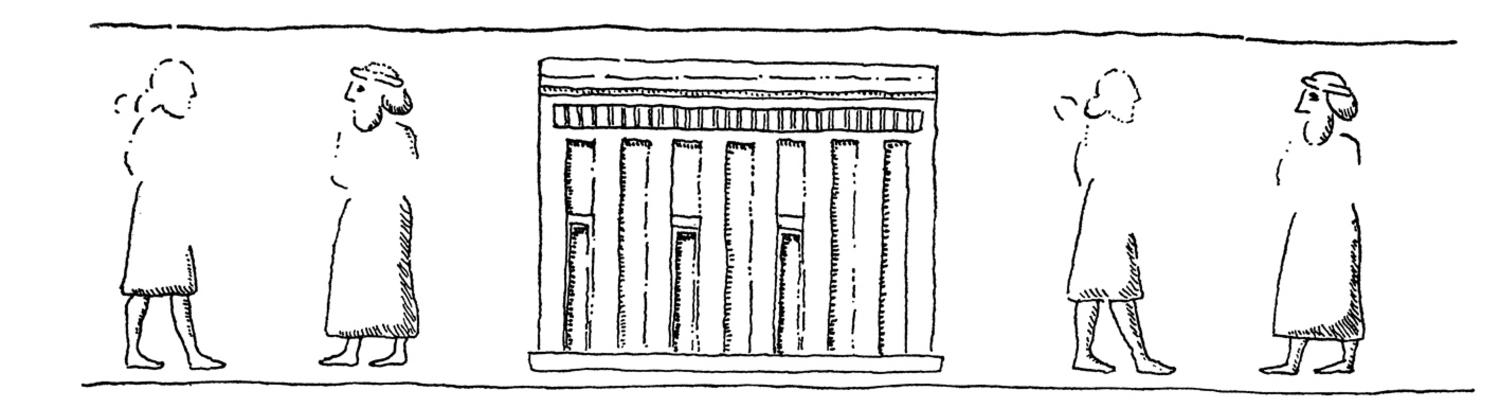
Abb. 3.4:
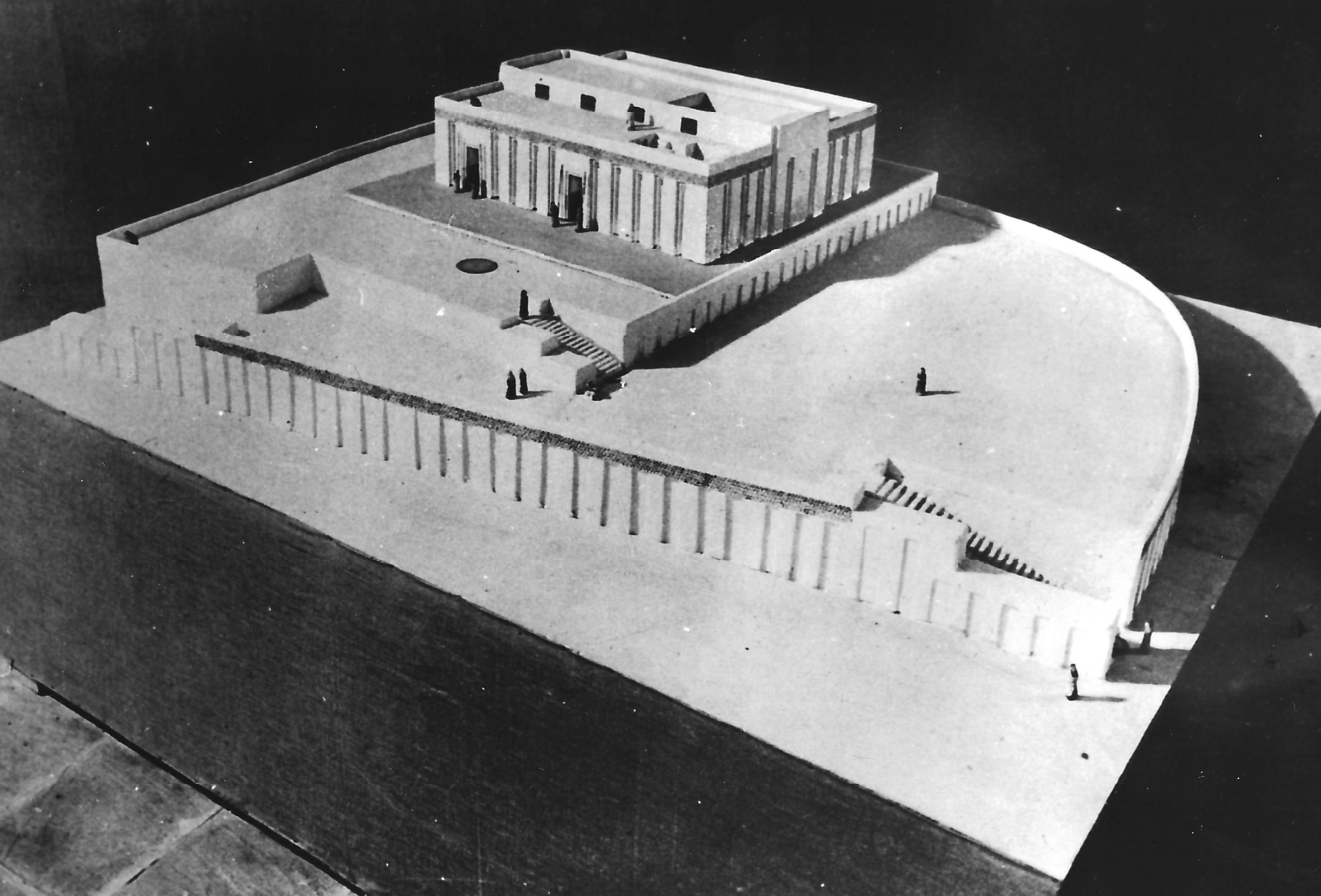
Abb. 3.5: Rekonstruktion der Hochterrasse und des Painted Temple von Tell Uqair
Die Standard-Bauaufgaben des altorientalischen Bauwesens schließen zunächst den privaten, teilweise auch von staatlichen Institutionen
Hinzu tritt weiterhin im Bereich der öffentlichen Architektur der Sakral-, d. h. Tempel- und Zikkurratbau.16 Hierbei ist zu beachten, dass das Gotteshaus im Alten Orient durchaus im wörtlichen Sinne als irdischer Wohnsitz der Gottheit verstanden wurde. Den Tempel
Von großer Relevanz, die im Laufe der Jahrhunderte beständig zunahm, war ebenfalls der Palastbau, über den wir, abgesehen von Baubefunden etwa aus dem altbabylonischen Mari
3.1.4 Methodische Einschränkung
Es sei betont, dass eine umfassende Studie zum altorientalischen Bauwesen bislang noch nicht verfügbar ist.21 Die hier durchgeführte Quellenanalyse muss sich deshalb prinzipiell darauf beschränken, einzelne Schlaglichter auf das Architekturwissen in Mesopotamien
3.2 Wissensbegriff
3.2.1 Religiöser Hintergrund
Zum geistesgeschichtlichen und religiösen Hintergrund des Bauens im Alten Orient liegt eine Vielzahl von Textzeugnissen und archäologischen Quellen vor. Wichtig sind insbesondere Baurituale und Bauopfer, die die Einbindung der Bauvorgänge in eine von magischen Vorstellungen geprägte altorientalische Gedankenwelt, die uns heute auf den ersten Blick irrational erscheint, widerspiegeln. Bspw. wurden Termine für den Beginn einzelner Bauvorhaben durch die Konsultation von Omenserien oder durch eine Opferschau festgelegt, wie überhaupt der Divination im Bauwesen eine entscheidende Rolle zugekommen ist.24
Die Bauritualtexte aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. sind unlängst ausführlich von C. Ambos behandelt worden. Ihr Quellenbestand hat sich in den letzten Jahrzehnten bedeutend erweitert, so dass Zeugnisse mittlerweile aus einer Reihe süd- und nordmesopotamischer Fundorte bekannt sind. Neben den späten Textvertretern gibt es vereinzelt aber auch älteres, präsargonisches, gudeazeitliches und altbabylonisches Belegmaterial aus dem 3. und 2. Jahrtausend v. Chr., das die lange Tradition der Textgattung und der mit ihr verbundenen magischen Handlungen veranschaulicht.25
Die archäologischen Befunde bestehen in Mesopotamien
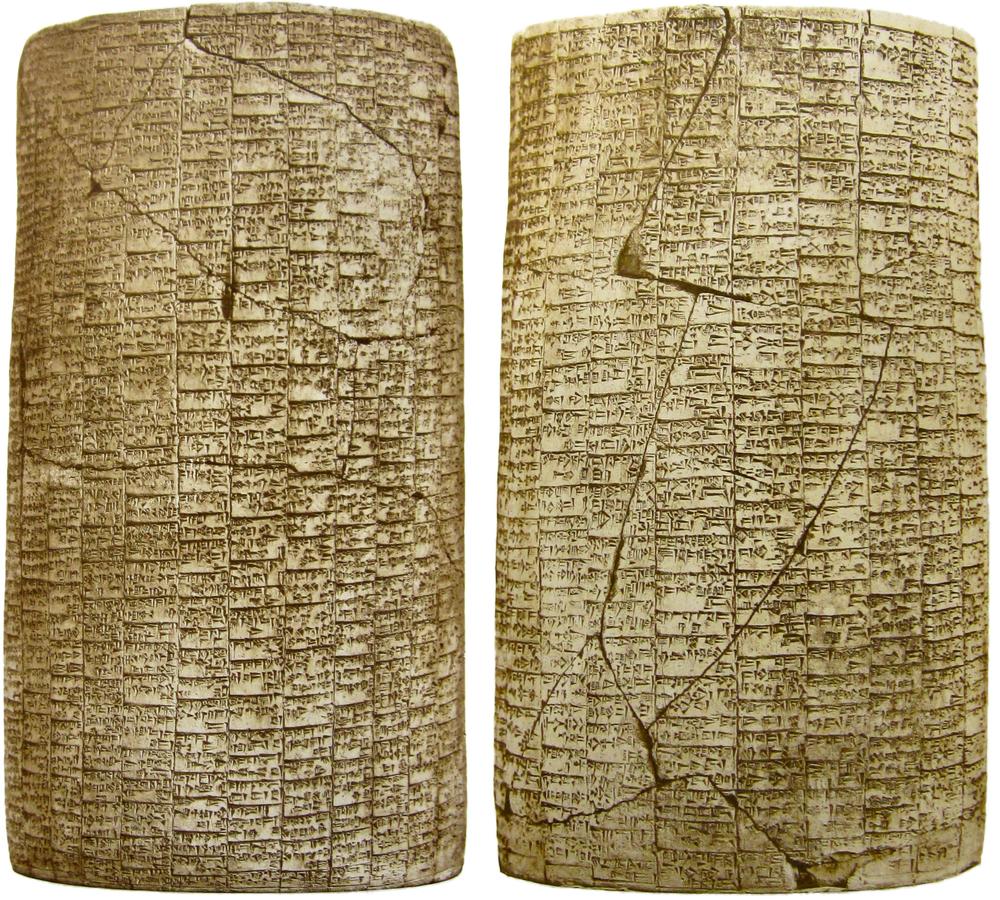
Abb. 3.6: Tonzylinder mit Tempelbauhymne des Gudea von Lagaš
Die Baudepots sind im Kontext von Bauriten zu sehen, über die wir zum einen durch die Bauritualtexte, daneben aber auch durch andere Schriftquellen, darunter v. a. königliche Bauinschriften, informiert sind. Unter den Bauinschriften ist neben den teilweise sehr ausführlichen Zeugnissen aus neuassyrischer und spätbabylonischer Zeit als frühes, mannigfaltige Hinweise auf Bauriten enthaltendes Textbeispiel die auf zwei großen Tonzylindern erhaltene Tempelbauhymne des Gudea
In seiner Arbeit zu den Ritualtexten erörtert Ambos sehr detailliert die zeitliche Abfolge der Rituale im Verhältnis zu den verschiedenen aufeinander folgenden Bauphasen.28 Für die Standfestigkeit einer Konstruktion und das Gelingen einer Baumaßnahme waren die Gunst und Mitwirkung der Götter unerlässlich. Dies betrifft grundsätzlich alle mesopotamischen Bauprojekte, also auch den Haus- und Palastbau29, doch liegt besonders ergiebiges Quellenmaterial für den Bau bzw. die Wiederherstellung und die kultische Einrichtung von Tempeln vor.30
Zunächst wurde von der Gottheit selbst der Zeitpunkt für die Restaurierung eines verfallenen Tempels festgelegt. Ein Opferschauer führte eine Eingeweideschau (bīru31) durch, um die göttliche Zustimmung für die geplante Baumaßnahme einzuholen. Der assyrische König Asarhaddon
Mehrfach bezeugt ist ebenfalls, dass dem Herrscher der Auftrag für die Wiederherstellung eines Tempels von der Gottheit in einem Traumgesicht erteilt wurde. Bekannte Beispiele hierfür stellen Gudea von Lagaš
Texte und Ausgrabungsbefunde zeigen, dass speziell bei Tempelbauten kultische Reinigungen des Baugrundes vorgenommen worden sind, die u. a. im Erdreich verborgenen Gräbern gegolten haben werden. Einen archäologischen Beleg bildet der älteste Bauzustand des frühdynastischen Tempelovals von Hafaği aus der ersten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr., ein wichtiges Schriftzeugnis einmal mehr der Baubericht des Gudea
War ein zu restaurierendes Gebäude schwer beschädigt, musste es bis auf die Grundmauern abgetragen werden. Insbesondere bei Sakralbauten bemühte man sich jedoch darum, die Kontinuität des – der altmesopotamischen Vorstellung nach zu Urzeiten von den Göttern selbst errichteten – Bauwerks nicht abreißen zu lassen.35 So oblag es dem Baumeister, aus den Trümmern des Altbaus einen „früheren Ziegel“ (libittu maḫrītu) zu bergen, über dem anschließend, unter Rezitation einer Beschwörung, die den Bau des uranfänglichen Tempels durch die Götter schildert, ein Opfer aus Milch, Bier, Wein usf. dargebracht worden ist.

(Foto: Olaf M. Teßmer).
Abb. 3.7: Gründungsfigur des Lugalkisalsi, Herrscher von Ur
(Foto: Olaf M. Teßmer).
Dass man zuweilen erhebliche Anstrengungen unternommen hat, die alten Fundamente aufzudecken, um neue Mauern möglichst exakt daran zu orientieren, und hierbei fast schon archäologisch vorging, belegen die Inschriften der spätbabylonischen Herrscher. Nabonid
Auch die Ausgrabungsbefunde an Tempeln lassen erkennen, dass die Mauern aus späteren Bauzuständen häufig unter nur geringen Modifikationen auf denjenigen der Vorgänger errichtet worden sind, was zur Folge hatte, dass sich die Grundrisse in jenen Fällen sehr langsam wandelten. Ein anschauliches Beispiel bildet der Sin-Tempel von Hafaği
Einen wichtigen Bestandteil der Rituale, die mit der Freilegung der alten Fundamente einhergingen, stellten Opfer und Gebete an die Unterweltsgottheiten dar, da die Erdarbeiten von diesen als Störung empfunden werden konnten. Gefahr drohte insbesondere, wenn man auf alte Gründungsbeigaben stieß, weshalb diese gegebenenfalls wie bedrohliche materia magica unschädlich gemacht werden mussten. Von Bauurkunden, die der Nachwelt den Namen eines Bauherrn mitteilen sollten, ging demgegenüber keine magische Wirkung aus.41
Weitere rituelle Handlungen wurden bei der Vorbereitung der Baumaterialien vollzogen. So erfährt man von dem neuassyrischen Herrscher Sargon II.
Wie schon die – bei einem kompletten Neubau natürlich nicht erforderliche – Aufdeckung der alten Fundamente war auch die Anlage neuer Gründungen von Bauritualen begleitet. In den neuen Fundamenten wurden Gründungsbeigaben in Form von Steinen, Metallen, Kräutern, Hölzern, Flüssigkeiten, Getreidekörnern oder Textilien zurückgelassen. Substanzen wie Getreidekörner oder Stoffstücke hat man z. T. einfach über die Fundamentgräben verstreut. Bei Ausgrabungen sind daneben aber vielfach sowohl im Fundamentbereich wie auch im aufgehenden Mauerwerk größere Ansammlungen von Gründungsbeigaben entdeckt worden. Hierunter befinden sich z. B. Tieropfer, nagelförmige, dabei häufig partiell figürlich gestaltete Objekte (Abb. 3.7), Tafeln aus mitunter sehr wertvollen Materialien sowie tönerne Zylinder und Prismen.44 Vornehmlich sind derartige Baudepots, die gleichfalls in den Schriftquellen erwähnt werden, für Tempel, Paläste und Stadtmauern45 bezeugt. Sehr aufwendige Beispiele kommen etwa aus dem Ištar-Tempel des mittelassyrischen Herrschers Tukulti-Ninurta I.
Da es für den Herrscher von großer Bedeutung war, seinen Namen und seine Taten zukünftigen Generationen zu überliefern, stellen die Funde aus den Depots oft königliche Bauurkunden dar. Hohe Beamte und lokale Würdenträger haben bisweilen ebenfalls entsprechende Urkunden hinterlegt. Nach ihrer Auffindung bei Renovierungsarbeiten sind die Texte zusammen mit den neuen Inschriften wieder an ihren Platz zurückgelegt worden.47
Ein zentrales Geschehen bei der Anlage der Fundamente war die Herstellung des ersten Ziegels durch den Herrscher. Auch hier gibt es einen früheren Beleg der Zeremonie im Bericht des Gudea

Abb. 3.8: Weihplatte des Urnanše
Rituale begleiteten ferner die Anbringung der Türen und offenbar auch die Errichtung des Daches. Nach der Fertigstellung eines Wohnhauses wurde ein umfassendes Reinigungsritual durchgeführt, das einem Exorzismus gleichkam und in dessen Verlauf die Baumeistergötter Kulla und Mušda(ma) die Baustelle verließen. Ähnlich wurden auch Heiligtümer vor dem Einzug der Gottheit einer kultischen Reinigung unterzogen. Einen Nachweis hierfür liefert wieder die Zylinderinschrift des Gudea
Als Schutz gegen böse Dämonen hat man sowohl beim Bau eines Hauses, Palasts oder Tempels als auch später noch, insbesondere anlässlich besonderer Ereignisse wie Todesfällen oder Krankheiten, apotropäische Figuren verscharrt bzw. magische Zeichnungen an den Wänden angebracht. Gefährdete Punkte bildeten v. a. Durchgänge und Fenster. Häufig wurden übelabwehrende Figuren bei Ausgrabungen unter den Fußböden entdeckt. In den neuassyrischen Palästen sind sie zudem auf Orthostatenreliefs, mit denen die Wandsockel verkleidet waren, abgebildet worden.51
Den Abschluss königlicher Bauprojekte bildeten große Feste, zu denen uns verschiedene archäologische und inschriftliche Hinweise vorliegen. Die Darstellung des Herrschers als Ziegelkorbträger in Verbindung mit einer Bankettszene (Abb. 3.8) bezeugt offenbar bereits für den frühdynastischen Stadtfürsten Urnanše
Die berühmte, wenn auch stark fragmentierte Stele des Ur III-zeitlichen Königs Urnammu
Nachrichten über große Feste im Anschluss an königliche Bauunternehmungen liegen gleichfalls aus neuassyrischer Zeit vor. So erfährt man, dass Assurnasirpal II.
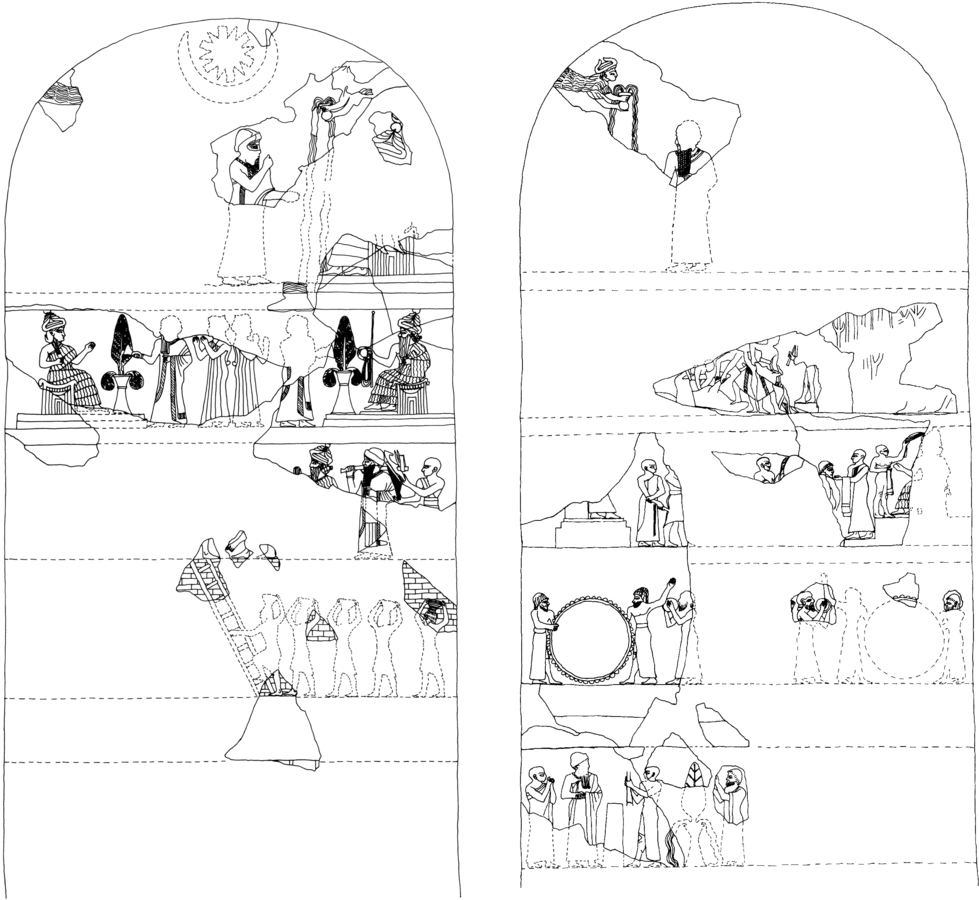
Abb. 3.9: Rekonstruktion der Vorder- und Rückseite der Stele des Urnammu aus Ur
Insgesamt lassen die Quellen erkennen, dass im Verständnis der altorientalischen Zeit der Erfolg einer Baumaßnahme gleichermaßen von den technischen Fertigkeiten der Baumeister wie von der Mitwirkung kundiger Ritualexperten abhing, die sicherzustellen hatten, dass die Arbeiten unter dem Schutz und Beistand der Götter durchgeführt werden konnten. Ihre Aufgabe bestand allerdings nicht darin, etwaige handwerkliche Unzulänglichkeiten der Konstruktion auszugleichen.57
3.2.2 Umgang mit ungünstig verlaufenen Bauprojekten
Über ungünstig verlaufene oder gescheiterte Bauprojekte liegen aus den altorientalischen Texten, insbesondere den offiziellen Inschriften der Herrscher, kaum direkte Nachrichten vor, sieht man einmal von den Bestimmungen in den §§ 229–233 des Codex Hammurapi ab, die den Haftungsumfang von Baumeistern bei durch ihr Verschulden eingetretenen Tötungen und Schäden regeln.58
Vielleicht spielte hierbei auch religiöse Scheu eine Rolle, da zumindest im Bereich des Sakralbaus der im altorientalischen Verständnis durch göttlichen Zorn ausgelöste Einsturz eines Tempels und der damit einhergehende Auszug der Gottheit aus ihrem Heiligtum eine Unterbrechung des regulären Kults bedeuteten, die viele Gefahren mit sich brachte. Im Extremfall konnte sogar ein das ganze Land betreffender Ausnahmezustand, etwa durch Ernteausfälle, eindringende Feinde usf. eintreten. Lieber als über die unbehagliche Tatsache des Auszugs nach einem Schaden sprach man deshalb über den freudigen Wiedereinzug der Götter in ihre restaurierten Heiligtümer. Den Tempelbauritualen fiel die Aufgabe zu, in ihrer Eigenschaft als Übergangsrituale die geordnete Rückführung in den idealisierten Zustand vor Eintritt des Schadens, zum Ausdruck gebracht durch das Bild des Tempels als Wohnsitz der göttlichen Herzensfreude, sicherzustellen.59
Allenfalls noch lassen sich im vorliegenden Zusammenhang Texte wie die oben schon erwähnte Inschrift des Nabonid anführen, in der dieser den raschen Verfall des Ebabbar in Sippar nach der Renovierung Nebukadnezars II. damit begründet, dass es seinem Vorgänger nicht gelungen sei, die ältesten Fundamente des Heiligtums aufzudecken. Die Instandsetzung habe infolgedessen nicht in einer die Gottheit vollauf befriedigenden Weise durchgeführt werden können.60
Gelegentlich werden in den Bauinschriften darüber hinaus begonnene, dann aber wieder unterbrochene Bauprojekte angesprochen, die nach der unfreiwilligen Zäsur schließlich doch noch zu einem glücklichen Ende geführt worden sind. Einen Beleg hierfür stellen die inschriftlich und archäologisch dokumentierten Baumaßnahmen am Anu-Adad-Tempel von Assur
Einen sehr interessanten Befund bilden ebenfalls die unten im Abschnitt zur Bauplanung näher behandelten Fundamentkonstruktionen in dem mittel- bis spätbronzezeitlich (ca. 18.–14. Jh. v. Chr.) datierenden Königspalast von Qatna
3.2.3 Nicht angewandtes Wissen
3.3 Bauverwaltung
3.3.1 Auftragsvergabe
Über die Strukturen der öffentlichen Bauverwaltung sind wir aus den altorientalischen Quellen ebenfalls nicht sonderlich gut, aber doch zumindest punktuell unterrichtet. Aussagekräftig sind hauptsächlich sumerische Verwaltungsurkunden aus dem 3. und neuassyrische Briefe aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. Die ab der frühdynastischen Zeit bezeugten offiziellen Bauinschriften der Herrscher hingegen enthalten so gut wie keine die Bauverwaltung betreffenden Hinweise, sondern reflektieren primär die mesopotamische Königsideologie.68
Gemäß dieser Ideologie war es erstes Privileg und oberste Pflicht eines jeden Herrschers, durch seine Taten, darunter nicht zuletzt auch Bauunternehmungen, die Götter zufrieden zu stellen, um auf solche Weise für sich und seine Untertanen göttliches Wohlwollen zu erlangen. Entsprechend treten in den Königsinschriften aller Epochen vom 3. bis zum 1. Jahrtausend v. Chr. zumeist nur der Herrscher selbst als der die Initiative ergreifende Bauherr sowie diverse Gottheiten auf, in deren Namen bzw. Auftrag und unter deren Ägide die einzelnen Projekte durchgeführt worden sind.69

Abb. 3.10: Stele des Šamaš-šumu-ukin, wahrscheinlich aus Babylon / Neubabylonische Zeit ©The Trustees of the British Museum.

Abb. 3.11: Sitzbild mit Darstellung des Gudea
In diesen Kontext gehören auch zahlreiche bildliche Darstellungen des Herrschers als Bauherr. Beliebt war v. a. das Korbträgermotiv, das sich bereits in der Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr. bei Urnanše
Alle übrigen am Bau beteiligten Personen, die mit der Organisation der Bauprojekte betrauten Beamten, die Handwerker und Arbeiter, aber auch die planenden Architekten werden weitgehend ausgeblendet, jedenfalls bleiben sie anonym. Das Gelingen eines Werks hat man stattdessen einmal mehr den Göttern zugeschrieben, so bspw. bestimmten Erscheinungsformen des Weisheitsgottes Enki/Ea.72
Ungeachtet der Darstellungsweise der Inschriften kann man jedoch davon ausgehen, dass in der realen Baupraxis neben dem Herrscher nicht zuletzt die z. T. sehr mächtigen Priesterschaften der großen Heiligtümer immer wieder Einfluss auf die Durchführung der sie unmittelbar betreffenden Bauvorhaben genommen haben werden. Textzeugnisse, die dies näher belegen könnten, liegen aber nur in äußerst begrenztem Umfang vor.73
Zu erwähnen sind hier in erster Linie die Orakelbefragungen bei Baubeginn, wie sie etwa aus der späten neuassyrischen Zeit bekannt sind. Deutlich lassen die Orakel die für das Bauwesen zentrale Bedeutung der in den Händen der Priesterschaft liegenden Divination erkennen. So berichtet Sargon II.
Außer göttlichen Weisungen haben namentlich die neuassyrischen Herrscher ihre Bautätigkeit aber auch der eigenen Entschlusskraft und Kompetenz zugeschrieben und das Bauen allgemein als probates Mittel zur Selbststilisierung gesehen. Der neuassyrische König präsentiert sich in seinen Inschriften vorzugsweise als diejenige Person, die das gesamte Werk plant und durchführt. Sanherib
Dass insbesondere beim Residenzstadt- und Palastbau, denen in neuassyrischer Zeit ein sehr hoher Stellenwert zugekommen ist, durchaus ein starkes persönliches Interesse des Herrschers am Baufortschritt bestanden hat, unterliegt allerdings keinerlei Zweifel und ist auch durch Briefe gut bezeugt. So wissen wir aus rund 40 königlichen Anordnungen, dass Sargon II.
In welcher Weise nach der einmal gefassten Entscheidung zur Durchführung eines Bauprojekts die jeweiligen Architekten und Bauausführenden bestimmt wurden und wie die konkrete Abstimmung zwischen dem Bauherrn und der Bauleitung zur Realisierung des Vorhabens vonstatten ging, bleibt einstweilen noch weitgehend im Dunkeln, lässt man einmal außer Betracht, dass Tiglatpilesar III.
Weitere Anhaltspunkte hinsichtlich der wechselseitigen Verständigung von Bauherren, Architekten und Bauleitern liefern die von H. Schmid als Planbeschreibung des spätbabylonischen Tempelturms von Babylon
Schließlich wird sich die Auswahl der Bauausführenden in vielen Fällen bereits daraus ergeben haben, dass die staatlichen Haushalte in Mesopotamien
3.3.2 Die Bauadministration der Tempel- und Palasthaushalte und privatwirtschaftliche Tätigkeit im Bauwesen
Früheste Schriftzeugnisse, in denen von Baumeistern (sumerisch: šidim) die Rede ist, stammen aus öffentlichen Haushalten des späten 4. Jahrtausend v. Chr. in Südmesopotamien
Die mesopotamische Gesellschaft der frühdynastischen Zeit (Anfang bis Mitte des 3. Jt. v. Chr.) war gemäß I. J. Gelb durch eine Vielzahl in sich weitgehend autarker öffentlicher und privater Haushalte gekennzeichnet.81 Die öffentlichen Haushalte, zu denen die Tempel-, Palast- und Beamtenhaushalte zählten, scheinen dabei im Verlauf des Frühdynastikums die privaten Haushalte der Großfamilien immer stärker in den Hintergrund gedrängt zu haben.82
Frühdynastische Belege der Tätigkeit von Baumeistern, darunter auch solche mit Namensnennung, kommen aus Ur
Ein sehr instruktiver präsargonischer Text stammt aus Abu Salabih
Auch in Texten der Akkadzeit (24.–22. Jh. v. Chr.) werden
Hervorzuheben ist ein Archiv aus der Gruppe A der sog. mu-iti-Texte aus Umma, das von B. R. Foster bearbeitet worden ist. Möglicherweise dokumentiert das Archiv ein größeres öffentliches Bauvorhaben unter einem frühen Akkadeherrscher. Allerdings ist unklar, ob es der Zeit von Sargon
Etwas klarer sieht man bei einem weiteren großen öffentlichen Bauprojekt der Akkadzeit. Es handelt sich um den Neubau und die prächtige Ausgestaltung des Ekur, des Heiligtums des Enlil in Nippur
Dass auf keiner einzigen Tafel ein Baumeister erwähnt wird, ist dadurch zu erklären, dass das uns vorliegende Archiv ausschließlich auf Abläufe Bezug nimmt, die die künstlerische Ausgestaltung des Ekur betrafen. Die Texte hatten mithin die Tätigkeit respektive Entlohnung von Handwerkern zum Gegenstand, die im Rahmen des „Handwerkerhauses“ (é-giš-kin-ti) wirkten und zu denen die Baumeister nicht rechneten. Vermutlich haben die bislang noch unbekannten Texte, in denen sie aufgeführt waren, in einem anderen Archivkontext gestanden.89
Mit Blick auf die an der Ausschmückung des Ekur beteiligten Handwerker des Handwerkerhauses verweist Neumann ebenfalls auf Parallelen aus späterer Zeit. So findet die Tätigkeit hochqualifizierter Handwerker im Bereich des Tempelbaus Entsprechungen etwa in den ausführlichen Baubeschreibungen Gudeas sowie in Inschriften des kassitischen Herrschers Agum-kakrime
Umfangreiches und zugleich sehr aussagekräftiges Belegmaterial zur
Vornehmlich waren die Ur III-zeitlichen
Baumaterialien und Arbeitsgeräte, die von den Bauleuten in Empfang genommen wurden, kamen teilweise aus den Depots der jeweiligen Verwaltungen. Belegt sind Hölzer und Holzgegenstände, Gefäße, Metallgeräte, Taue,
Die Anzahl der Arbeiter war abhängig von Art und Umfang der jeweiligen Bauprojekte sowie der Quote der beteiligten Baumeister. In einigen Texten aus Umma wird als Einsatzort der Arbeiter das é-šidim, also die Werkstatt respektive der Arbeitsbereich des Baumeisters, genannt. Vielleicht bezieht sich der Begriff auch auf spezifische Baustelleneinrichtungen, zu denen Materiallager, Asphaltöfen usw. gehörten. Urkunden, die die Bauarbeiten am Šara-Tempel von Umma
Die Arbeitsleistung der
Erst unlängst ist ein bedeutendes Corpus bei Raubgrabungen entdeckter Ur III-zeitlicher Verwaltungsurkunden, die neben anderem die Organisation eines großen Mauerbauprojekts zum Gegenstand haben, veröffentlicht worden.92 Die nach ihrem mutmaßlichen, bislang noch nicht exakt lokalisierten Herkunftsort benannten „Garšana-Texte“ bereichern unser Wissen um die Ur III-zeitliche Bauverwaltung um wesentliche Details. Sie kommen aus einer südmesopotamischen Verwaltungseinheit in der Provinz Umma
Einen zentralen Bereich des öffentlichen Bauwesens bildeten gleichfalls die landwirtschaftlichen Wasserbauten. Sie waren notwendig, um das Hochwasser von Euphrat
Schon früh im 3. Jahrtausend v. Chr. stellte die Errichtung und Pflege der Bewässerungsanlagen, die die Fruchtbarkeit und den Wohlstand des Landes garantierten, eine der wichtigsten Aufgaben der staatlichen Autoritäten im südlichen Zweistromland
Umfangreiche wasserbauliche Maßnahmen sind bspw. für Urnammu
Ur III-zeitliche Wirtschaftstexte aus Umma
H. Neumann wirft in Zusammenhang mit der Tätigkeit der Baumeister im Kontext der Palast- und Tempelökonomie
Neumann nimmt an, dass man sich die Verhältnisse während der Ur III-Zeit trotz ungünstigerer Quellenlage ähnlich vorzustellen hat, zumindest hinsichtlich eines Teils der für die öffentlichen Haushalte geleisteten Arbeit. Zugleich steht aber fest, dass die staatlichen Wirtschaftseinheiten in ihrem Personalbestand auch eigene
Eine Rationsabrechnung aus dem Bereich der „Neuen Mühle“ in Girsu
Für die Ausführung privater Bauaufträge durch einzelne
Er hält es für sehr wahrscheinlich, dass die §§ 228–233 und 274 des Codex Hammurapi auch schon die privatrechtliche Situation am Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. reflektieren. Die den
Neumann verweist in diesem Zusammenhang gleichfalls auf eine Ur III-zeitliche Urkunde aus Girsu, die das Problem der Bestätigung von Ansprüchen auf ein Guthaben behandelt. Aus der Urkunde geht hervor, dass eine Schuld in Gerste, die zwei Personen gegenüber der staatlichen Verwaltung haben, auf einen
Bei Tötung durch Hauseinsturz aufgrund unsachgemäßer Bauausführung muss gemäß CH § 229–230 der Baumeister bzw. dessen Sohn haften. Eben jene Situation scheint in der Urkunde gegeben zu sein. Während aber der
Tatsächlich handelt es sich beim Codex Hammurapi ja auch nur um einen Rechtsstandard, dessen Normen sich nicht zwangsläufig mit der Rechtssprechung im konkreten Einzelfall decken müssen.101 Die Urkunde deutet jedenfalls darauf hin, dass die
Erwähnenswert ist weiterhin eine Gruppe altbabylonischer Texte aus Kiš. Sie stammt offenbar aus einer Verwaltungseinheit, die „al-tar“-Arbeiten wie die Ziegelherstellung und den Ziegeltransport organisiert hat, d. h. Tätigkeiten, die von ungelernten Kräften durchgeführt werden konnten. Die Tafeln geben unmittelbaren Einblick in den Aufbau und die Arbeit der Behörde.103
An der Spitze des Amts befand sich ein Leiter (šūzubtum), unterstützt von zwei Schriftführern (níg-šu). Fünf Aufseher (waklum) wiesen die Arbeiter an. Bei letzteren konnte es sich um Dienstverpflichtete handeln, namentlich Soldaten (rēdû), die direkt dem Amtsleiter unterstanden. Für ein Stück Land, das ihnen zugeteilt worden war, schuldeten sie der Krone Dienst. Die übrigen Arbeiter waren Tagelöhner. Den Texten ist zu entnehmen, dass man Tätigkeiten am Bau, für die keine ausgebildeten Handwerker erforderlich waren, vorzugsweise von Dienstverpflichteten oder Tagelöhnern hat ausführen lassen.104
Ein gutes Beispiel der Administration eines großen Bauprojekts aus der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. stellt die Errichtung der assyrischen Residenzstadt Dur-Šarrukin
Obwohl die großen Bauprojekte prinzipiell Angelegenheit des Königs waren, konnte sich der Palast zu ihrer Durchführung ebenfalls an die Tempeladministrationen wenden. So legt F. Joannès dar, dass in neu- und spätbabylonischer Zeit (erste Hälfte des 1. Jt. v. Chr.) verschiedene große königliche Bauunternehmungen de facto von den Heiligtümern durchgeführt worden sind, denen die königliche Verwaltung einen Teil der finanziellen Mittel und der erforderlichen Baumaterialien zuwies.105
Ferner hat man in spätbabylonischer Zeit für einzelne Bauaufgaben, v. a. solche, bei denen Backsteine benötigt wurden, auch Privatunternehmer hinzugezogen. Diese wiederum konnten Subunternehmer, z. B. Flussschiffer für den Ziegeltransport, engagieren, um ihre mit der Administration, d. h. der Palast- oder Tempelverwaltung, geschlossenen Lieferverträge zu erfüllen.
Die betreffenden Unternehmer waren keineswegs ausschließlich auf öffentliche Arbeiten spezialisiert, sondern verfügten über Finanzmittel und Arbeitskräfte, die es ihnen erlaubten, in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen auf einen punktuellen Bedarf zu reagieren. In Borsippa und Babylon haben sie sich bloß in der Zeit der großen Bauprojekte der spätbabylonischen Könige (Abb. 3.24, 3.34, 3.49) an der Ziegelfabrikation und -anlieferung beteiligt.
Bestimmte Markierungen, insbesondere in aramäischer Schrift geschriebene Namen, auf spätbabylonischen Ziegeln aus Babylon
3.3.3 Mittelverwaltung, Bauleistungskontrolle und Bauabnahme
Aus der an den Beginn des 2. Jahrtausends v. Chr. datierenden Korrespondenz der assyrischen Handelskolonien in Anatolien
Zugleich entwickelten sich in Assyrien nach der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. Krieg, Kriegsbeute und Tribute zu bevorzugten Instrumenten, die für die zahlreichen großen Bauvorhaben erforderlichen Mittel, Arbeitskräfte und Baumaterialien aufzubringen.109 Allerdings ist zu beachten, dass diese Art der
Auch ist die Beschaffung und Verwaltung
Aussagekräftige Quellen hierzu sind nach wie vor rar. Immerhin gibt es sporadische Hinweise auf die
Weiterhin belegen Briefe, dass der Bau der Wohnhäuser von Dur-Šarrukin
Auch über die Wohnhäuser hinaus scheint man einen beträchtlichen Anteil der Baukosten von Dur-Šarrukin
Abschließend sei noch ein amarnazeitliches Zeugnis über die
Über die Leistungskontrolle im Zuge von Baumaßnahmen und die Modalitäten der
3.3.4 Baubehörden und Baugesetze
Die Parzellenhäuser weisen untereinander vergleichbare Grundrißelemente, allerdings in variierender Anordnung, und normierte Gassenfrontbreiten auf, denen gemäß Pfälzner mit einer Ausnahme das sumerische Längenmaß nindan zugrunde liegt. Im einzelnen konnten die Frontbreiten der Häuser 6 m, 7,5 m, 9 m, 12 m und 15 m betragen. Das entspricht 1 nindan, 1
 nindan, 1
nindan, 1
 nindan, 2 nindan und 2
nindan, 2 nindan und 2
 nindan. Die Frontbreite von 8 m geht demgegenüber möglicherweise auf ein lokales nordmesopotamisches Maßsystem zurück. Aufgrund der standardisierten Frontabmessungen der Häuser nimmt Pfälzner an, dass die Grundstücke den Bewohnern institutionell zugewiesen worden sind, während die im Einzelfall stark variierende Bauausführung in den Händen der einzelnen Haushalte gelegen habe.
nindan. Die Frontbreite von 8 m geht demgegenüber möglicherweise auf ein lokales nordmesopotamisches Maßsystem zurück. Aufgrund der standardisierten Frontabmessungen der Häuser nimmt Pfälzner an, dass die Grundstücke den Bewohnern institutionell zugewiesen worden sind, während die im Einzelfall stark variierende Bauausführung in den Händen der einzelnen Haushalte gelegen habe.
In den Parzellenhäusern sieht er einen frühen Beleg städteplanerischen Vorgehens, das den Administrationen einer Reihe frühbronzezeitlicher Orte im nordmesopotamischen Raum die geregelte Anlage städtischer Siedlungsviertel ermöglicht habe. Von daher sei das Konzept der Parzellenhäuser als integraler Bestandteil der Urbanisierung Nordmesopotamiens im 3. Jahrtausend v. Chr. zu sehen.115
Für die neuassyrische Zeit ist die Existenz Aufsicht führender Baubehörden zumindest indirekt daraus zu erschließen, dass Sanherib
Weiterhin ist der die Errichtung von Dur-Šarrukin
Bekannt sind schließlich die schon erwähnten
3.4 Bauplanung
3.4.1 Bauplanung und berufliche Qualifikation
Auch die eher begrenzte Zahl von itinnum-Belegen in den Texten des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr. spricht dafür, dass die Berufsqualifikation der Baumeister auf einer intensiven Ausbildung beruht haben muss. Namentlich die Quellen aus altbabylonischer Zeit (erste Hälfte des 2. Jt. v. Chr.) signalisieren dabei, dass der spezifischen Wortbedeutung von itinnum weder eine einseitige Übersetzung im Sinne von „Architekt“ noch eine Wiedergabe im Sinne von „Maurer“ gerecht wird.
Aus mittelassyrischer Zeit (zweite Hälfte des 2. Jt. v. Chr.) liegen Nachrichten über nach Assyrien verschleppte hurritische Bauleute vor. Zumindest in einer Reihe von Fällen handelt es sich offenkundig um qualifiziertes Fachpersonal, dem eine wichtige Rolle bei den Bauarbeiten in Kar-Tukulti-Ninurta
Ein bedeutendes spätbabylonisches Textdokument zur Unterweisung von
Die Lehrzeit beträgt acht Jahre. Selbst wenn hierin neben der unmittelbaren Lehrzeit auch die Arbeitspflicht des Lehrlings gegenüber dem Lehrmeister enthalten sein dürfte, signalisiert die beträchtliche Ausbildungsdauer einen erheblichen Umfang und Schwierigkeitsgrad der vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten.124 Zum Vergleich beträgt nach einem anderen spätbabylonischen Lehrvertrag die ebenfalls recht lange Lehrzeit für das Zimmermannshandwerk sechs Jahre.
Zwar sind aus den Urkunden u. U. nicht direkt ersichtliche Eigenheiten der beiden Lehrverhältnisse denkbar, weshalb man vor einer vorschnellen Generalisierung hinsichtlich gängiger Ausbildungszeiten gewarnt hat, doch steht außer Zweifel, dass der Beruf des Baumeisters in Mesopotamien
Selbstverständlich kann nicht für jeden itinnum oder šidim das gleiche Qualifikationsniveau vorausgesetzt werden. Neumann nimmt an, dass es ähnlich wie in anderen Handwerksberufen keine strikte Trennung zwischen dem planenden und leitenden
Bezieht man neben den Textquellen auch die archäologischen Befunde stärker in die Betrachtung ein, verändert sich der Blickwinkel. Es zeigt sich, dass das Thema Bauplanung
Im privaten Wohnhausbau ist angesichts zahlreicher ethnographischer Parallelen aus dem Irak
In den Städten, etwa dem frühbronzezeitlichen Tell Chuera
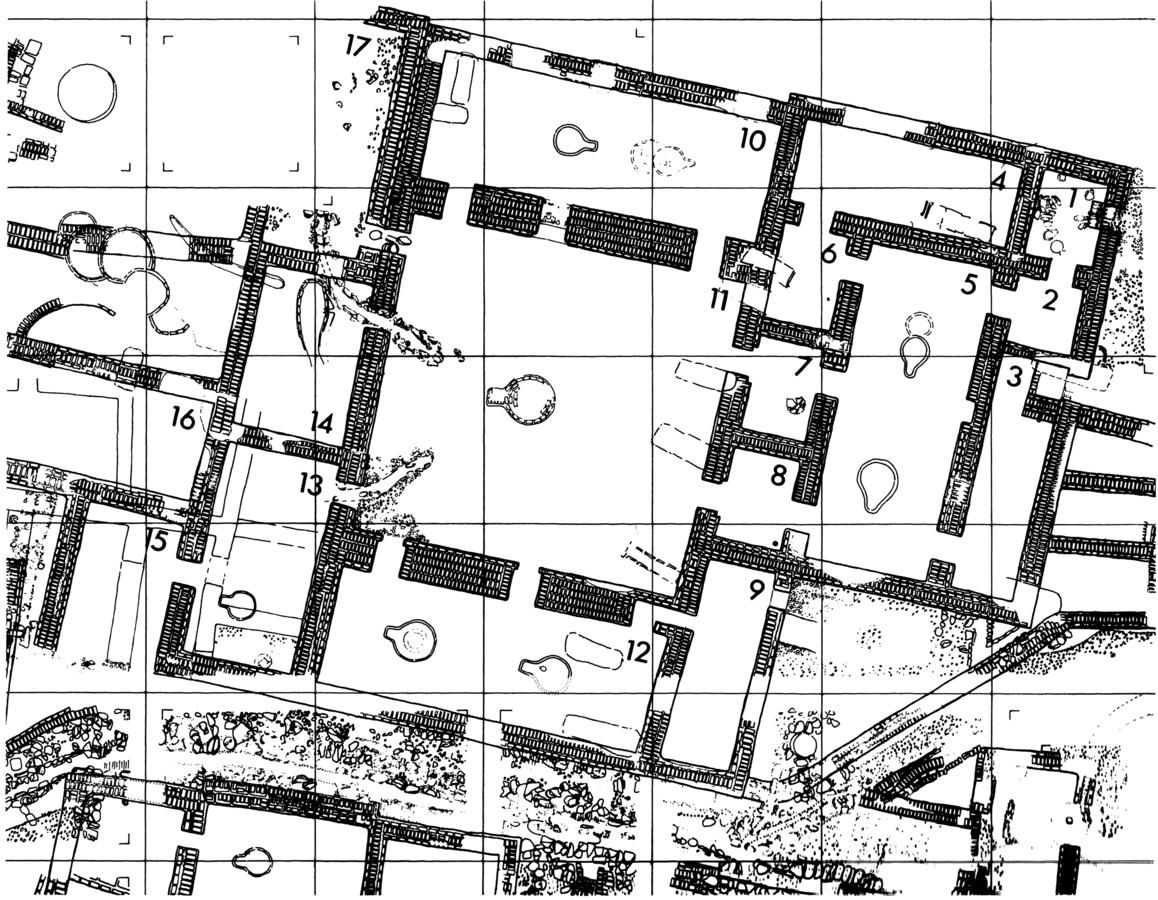
Abb. 3.12: „Osthaus“ in Habuba Kabira
Auch die den
Ein Nebeneinander unterschiedlicher Formen des städtischen Wohnhausbaus ist während der Isin-Larsa- und der frühen altbabylonischen Zeit (erstes Viertel des 2. Jt. v. Chr.) in den beiden Wohnvierteln bzw. Nachbarschaften TA und TB im Scribal Quarter von Nippur
Ganz ähnlich sind auch schon die Wohnhäuser der urukzeitlichen, in das späte 4. Jahrtausend v. Chr. datierenden Stadt Habuba Kabira
Aus dem architektonischen Befund hat man nicht nur auf eine bewusste Vorausplanung vieler Häuser, sondern auch auf eine Ausführung der Bauarbeiten durch erfahrene Bauleute geschlossen. In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass bereits die Verwaltungsurkunden und lexikalischen Listen der Uruk IV- und III-Zeit – d. h. die frühesten Textzeugnisse aus Mesopotamien überhaupt (spätes 4. Jt. v. Chr.) – Belege des Terminus šidim, d. h. der Berufsbezeichnung des Baumeisters, enthalten.132
Da die Häuser in Habuba Kabira
Die Errichtung oder Instandsetzung großer öffentlicher Bauten wie sie bspw. Tempel, Paläste, Magazine oder auch Verteidigungsanlagen repräsentieren, stellte im Regelfall deutlich höhere Anforderungen an die Qualifikation der damit beauftragten Personen als der Wohnhausbau. Insofern steht außer Frage, dass die Konzeption entsprechender Bauten in dem hier behandelten Zeitraum von der Mitte des 4. bis zur Mitte des 1. Jahrtausends v. Chr. grundsätzlich in den Händen ausgebildeter Baumeister und Spezialisten gelegen haben muss.
Über die genauen Modalitäten der Planung öffentlicher Bauten erfährt man aus den Texten allerdings kaum etwas. Die königlichen Bauinschriften, wie sie etwa aus der mittel- und neuassyrischen Zeit bekannt sind, erhalten prinzipiell die Fiktion aufrecht, dass Planung und Leitung der großen Bauprojekte allein in den Händen des göttlich inspirierten Königs gelegen haben. Auch andere Textgattungen wie etwa Briefe und Urkunden liefern zum Planungsprozess lediglich sehr begrenzte und punktuelle Informationen. Erwähnung verdienen hauptsächlich noch Bauzeichnungen
Aus jenem Grund kommt an dieser Stelle den Ergebnissen der archäologischen Forschung erhöhte Bedeutung zu. Dabei handelt es sich jedoch um eine Reihe sehr weit gestreuter Einzeluntersuchungen, meist Ausgrabungspublikationen, die singuläre Beobachtungen, Schlüsse und Hypothesen zum Planungsprozess und zur Bauausführung spezifischer Bauwerke enthalten. Hier kann diese Literatur deshalb nur auszugsweise erörtert werden. Zu nennen sind u. a. die umfangreichen Endpublikationen der Ur III-zeitlichen bis altbabylonischen und spätbabylonischen Stufentürme von Uruk
Einen im vorliegenden Zusammenhang relevanten Punkt bildet ebenfalls der Architekturdekor. Innerhalb des öffentlichen Bauwesens ist dem Architekturdekor als vielgestaltigem baulichen Ausdrucksmittel seit der Zeit des Aufkommens erster Städte in Mesopotamien
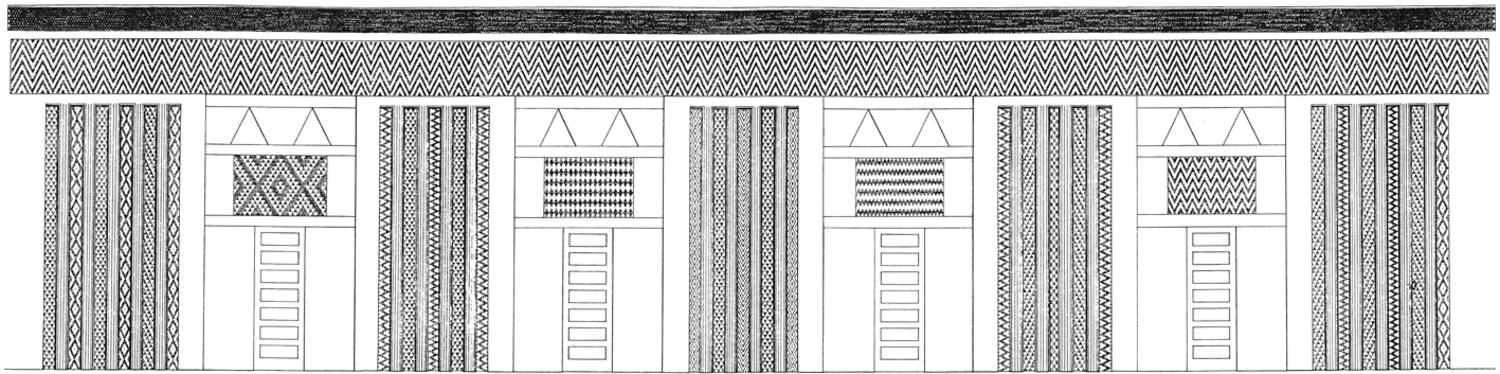
Abb. 3.13: Rekonstruktion der Südostfassade der Pfeilerhalle im Eannabezirk von Uruk
Gute Beispiele für die schon in früher Zeit sehr weit fortgeschrittene Entwicklung des Bauschmucks stellen die aus Stein respektive Keramik bestehenden Stiftmosaiken des Steinstifttempels, des Mosaikhofs und der Pfeilerhalle (Abb. 3.13) im späturukzeitlichen Eannabezirk von Uruk
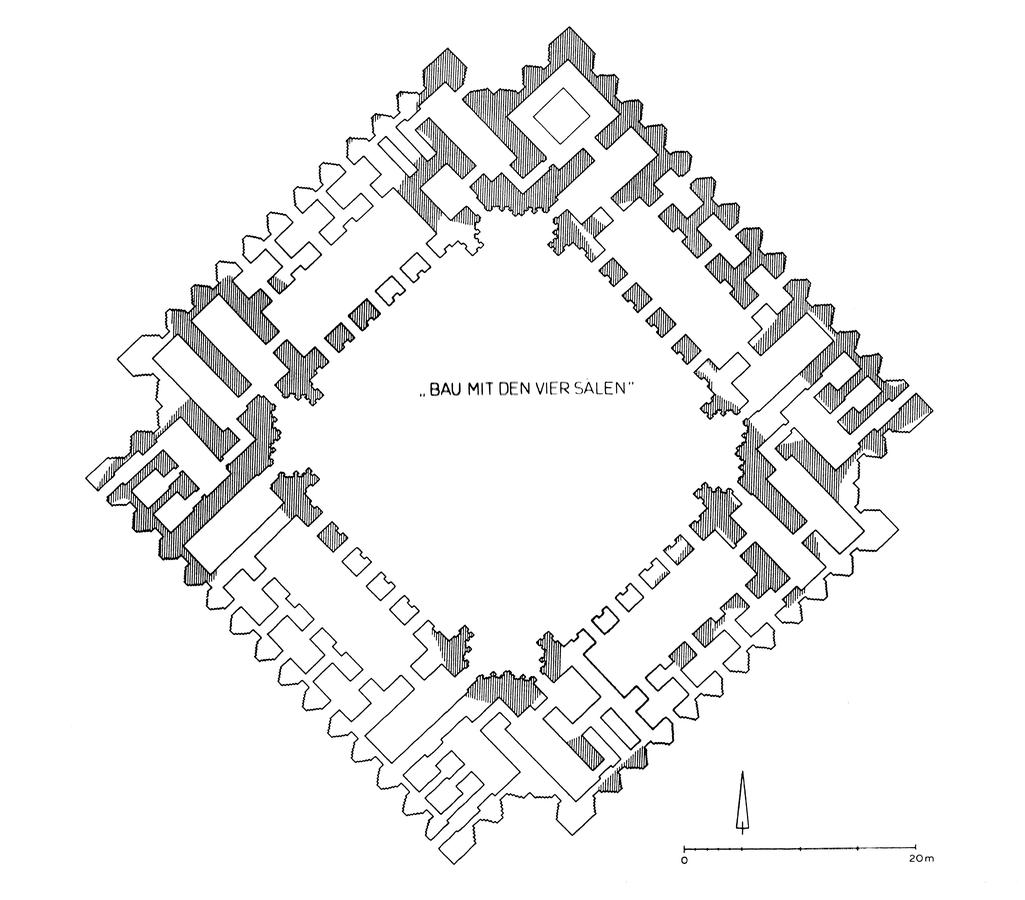
Abb. 3.14: Grundrissrekonstruktion des Gebäudes E im Eannabezirk von Uruk
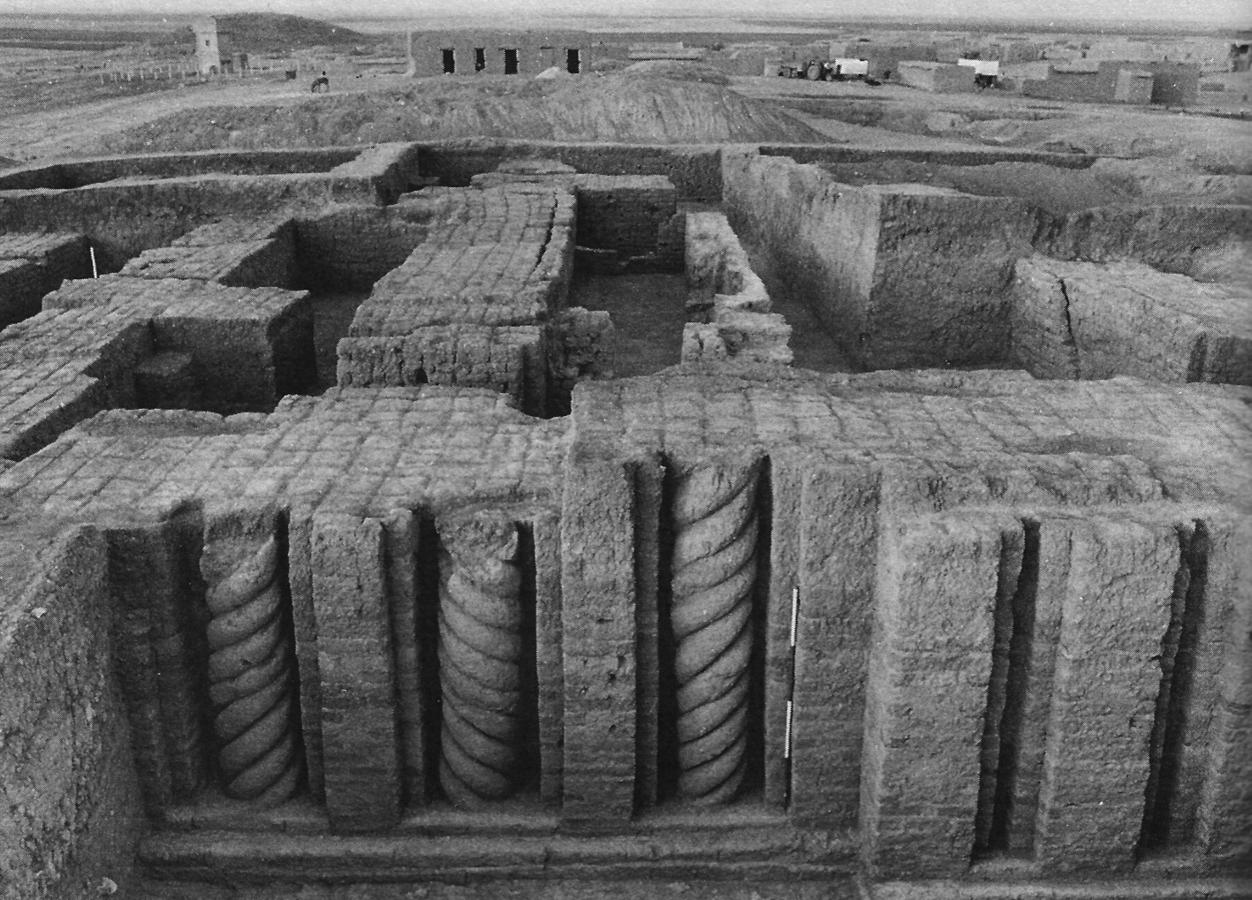
Abb. 3.15: Nordfassade des Tempels der Bauschicht II im nordöstlichen Teil der Akropolis von Tell Leilan
Ein weiteres Beispiel für die hohe Komplexität des Baudekors der altorientalischen Monumentalarchitektur repräsentieren die im Gegensatz zu den Stiftmosaiken durch alle Epochen hindurch bis in die Spätzeit nachweisbaren Pfeiler-Nischen-Gliederungen der Gebäude. Auch hier ist ein früher Höhepunkt der Entwicklung bereits während der Späturukzeit fassbar, in der die Arrangements vorzugsweise in kleinformatigen Riemchenziegeln ausgeführt worden sind.141 Die vielgestaltigen Wandgliederungen aus Vor- und Rücksprüngen zeugen von einer außerordentlichen Meisterschaft in der
Aus jüngeren Epochen der altorientalischen Geschichte sind als Belege eines ähnlich hohen Grads in der Verfeinerung des Ziegeldekors, die wiederum die Mitwirkung spezialisierter Fachkräfte am Planungs- und Bauprozess reflektieren, schließlich noch diverse Fassadengliederungen aus spiraligen Halbsäulen und stilisierten Palmstämmen zu nennen. Die Gliederungen wurden an Bauten des frühen 2. Jahrtausends v. Chr. in Ur
Weder für die Stiftmosaiken, noch für die Pfeiler-Nischen-Gliederungen oder die Ziegeldekore aus Halbsäulen und Palmstämmen ist bislang jedoch näher erforscht worden, inwieweit ihre genaue Konzeption bereits während eines frühen Zeitpunkts der Gebäudeplanung erfolgt ist oder ob sie primär in die Verantwortung der mit der Bauausführung betrauten Baumeister auf der Baustelle fiel.143 Zumindest bei den Pfeiler-Nischen-Gliederungen dürfte aber letzteres der Regelfall gewesen sein, wie die Untersuchungen von R. Eichmann zur urukzeitlichen Architektur von Uruk
3.4.2 Bauplanung und Wissen um Umweltbedingungen
In der Architektur des Alten Orients resultierten nicht wenige statische Probleme aus den spezifischen Materialeigenschaften, namentlich der unzureichenden Feuchtigkeitsresistenz, des wichtigsten Baustoffes, i. e. des ungebrannten Ziegels. Insofern spielte das Wissen um Umweltbedingungen in der Bauplanung stets eine hervorragende Rolle.
Einen Bereich, in dem es unmittelbar zum Tragen gekommen ist, bildet der Fundamentbau. Vornehmlich haben die Fundamente altorientalischer Gebäude dazu gedient, den aufgehenden Mauern stabile Auflageflächen zu verschaffen. Gerade in über längere Zeit hinweg besiedelten Orten war der Untergrund in Höhe der obersten Ablagerungen oft nicht in der Weise verdichtet, dass Absenkungen zuverlässig ausgeschlossen werden konnten. Von daher gründete man die Häuser vielfach nicht einfach zu ebener Erde, sondern errichtete Fundamentplatten aus Ziegeln, setzte die Mauern der Neubauten auf die gleichmäßig abgeglichenen Stümpfe von Vorgängerbauten, schachtete Baugruben aus oder legte Fundamentgräben an.
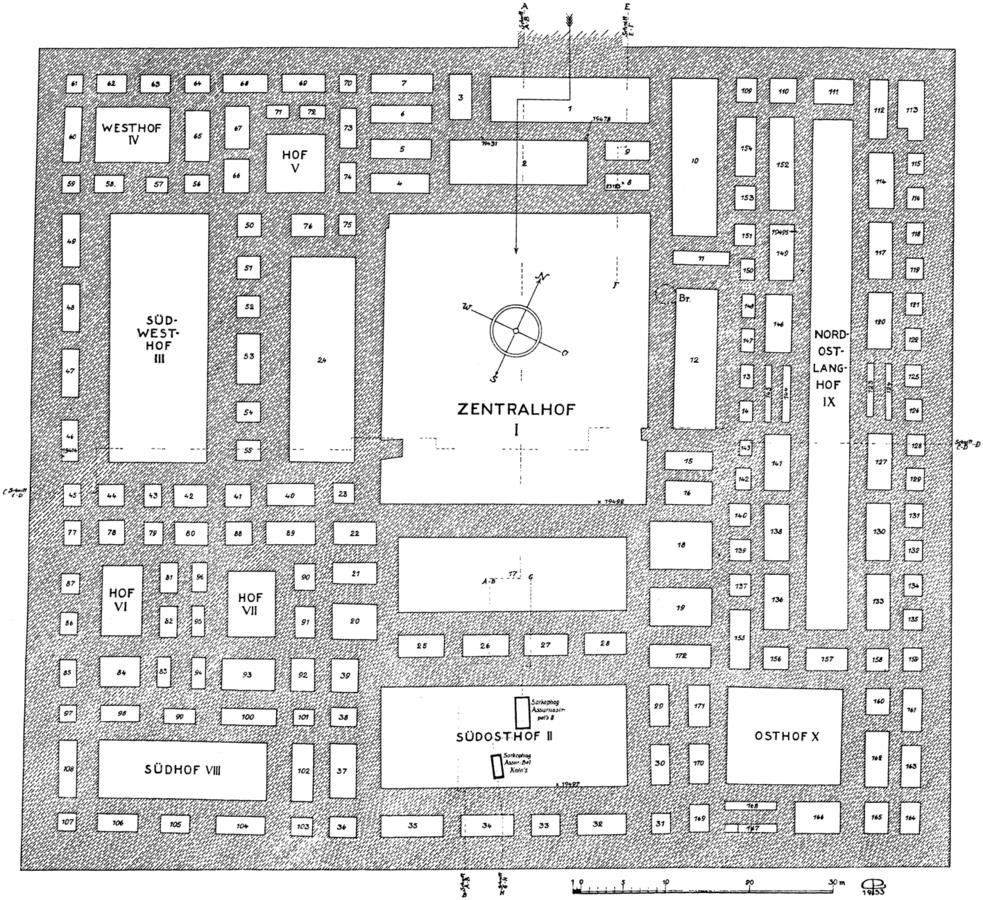
Abb. 3.16: „Urplan“ des Alten Palastes in Assur
In der urukzeitlichen Monumentalarchitektur, wie sie insbesondere aus dem Eannabezirk von Uruk
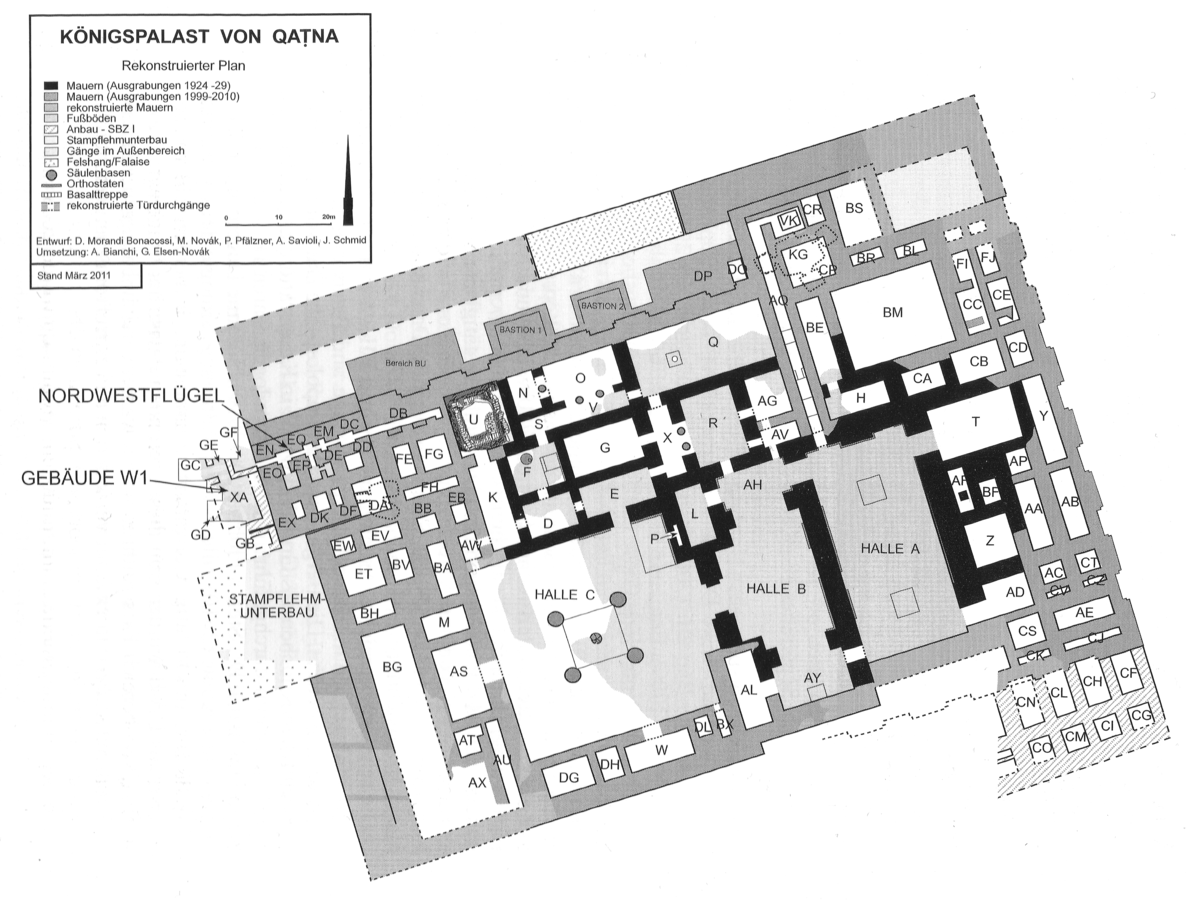
Abb. 3.17: Grundrissrekonstruktion des Königspalastes von Qatna
Gelegentlich konnten die Fundamentkonstruktionen allerdings neben der Standsicherheit auch der Entwässerung dienen. Eine besonders aufwendige Technik ist aus dem mittelbronzezeitlichen Königspalast von Qatna
Der Bauplatz des Palastes bestand in einem plateauartigen Felssporn, der auf drei Seiten von Niederungen umgeben war. Auf dem Sporn hatte sich schon in der Frühbronzezeit (3. Jt. v. Chr.) ein in seinen einzelnen Bereichen unterschiedlich hoch anstehender Siedlungshügel gebildet. Da man die Mauerfundamente des Palastes grundsätzlich bis zum gewachsenen Boden hinabführen wollte, mussten in den hoch anstehenden Teilen des Siedlungshügels sehr tiefe Baugruben ausgehoben werden, während in anderen Bereichen die Fundamentmauern teilweise oberirdisch bis auf die Höhe des vorgesehenen Fußbodenniveaus aufgemauert worden sind.
In den Gruben konnten noch die sukzessive erhöhten Arbeitsflächen nachgewiesen werden, von denen aus die Fundamente angelegt worden sind. Weiterhin wurden in den Fundamentbereichen Konstruktionstreppen sowie die Hufabdrücke von Lasttieren festgestellt, die offenbar das Material befördert haben. Schließlich konnte auch aufgezeigt werden, dass es während der Ausführung der Fundamente zu Planänderungen gekommen ist, die sehr weitreichende Modifikationen des Palastgrundrisses nach sich gezogen haben.148
Es wurden drei verschiedene Konstruktionsweisen der Fundamente beobachtet.149 Alle drei bestehen im Kernbereich aus Lehmziegelmauern. Das Lehmziegelmauerwerk ruhte jeweils auf einer Steinunterfütterung aus ein bis drei Lagen Kalkstein und Basalt, die ihrerseits auf dem natürlichen Fels aufsaß.
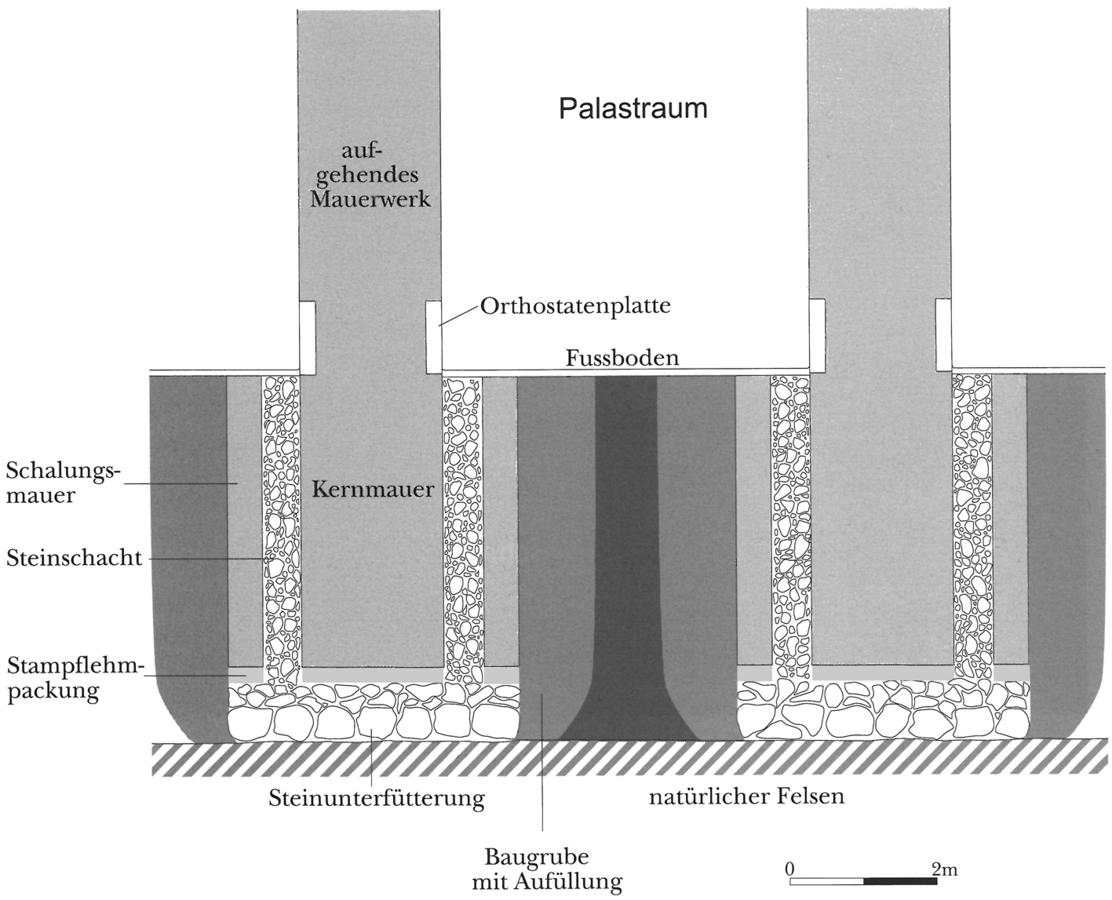
Abb. 3.18: Schematische Skizze des Aufbaus eines Fundaments im Königspalast von Qatna
Bei der ersten Variante hat man die Fundamentmauern mit einer einreihigen Steinverblendung aus kleineren Bruchsteinen versehen, die mittels eines kompakten Lehmestrichs verbunden waren. Sowohl die Fundamentmauern als auch die Verkleidungen zeigten eine auffällige Böschung. Diese Technik trat v. a. in jenen Bereichen des Palastes auf, in denen sich zuvor im Terrain Senken befunden hatten.
Bei der zweiten Variante, die gleichfalls in Senkenbereichen festgestellt wurde, waren die Fundamentmauern von ca. 30–40 cm starken Steinsetzungen flankiert, die von einem leichteren Lehmmörtel gehalten wurden. Die Böschung fiel hier deutlich geringer aus. Anscheinend ist diese Bauweise nur bei jüngeren Um- und Einbauten am Palast zur Anwendung gekommen.
Die dritte Variante war die aufwendigste (Abb. 3.18). Sie dominiert insbesondere im Zentrum des Palastes, d. h. in Höhenbereichen mit tiefen Fundamentgruben. Hier bildete die eigentliche Fundamentmauer eine Art Kernmauer, die auf beiden Seiten von rund 0,6–1 m breiten, mit Steinen gefüllten Schächten flankiert war. Die Steine sind in den Schächten ohne Bindungsmaterial aufgeschichtet worden und wurden auf der der Kernmauer gegenüber liegenden Seite jeweils von einer schmalen Schalungsmauer aus Lehmziegeln gestützt. Ebenso wie die Fundamentmauern saßen die Schalungsmauern und Schächte bei dieser Konstruktionsweise auf den zuvor beschriebenen Steinunterfütterungen.
An verschiedenen Stellen im Palast ließ sich beobachten, dass die Fußböden der Räume über die Schalungsmauern und Steinschächte hinwegzogen und an den Außenkanten der Kernmauern abschlossen. Das aufgehende Mauerwerk, das in vielen Räumen ebenfalls noch mit einer Verkleidung aus Kalksteinorthostaten zum Schutz der Mauerfüße versehen war, saß also exakt über den Kernmauern und besaß deren Breite.
Offenkundig hat bei allen drei Fundamentkonstruktionen im Palast von Qatna
Da bei der dritten Konstruktionsweise die Steine ohne Mörtelmasse aufgeschichtet werden konnten, war sie zugleich die effektivste. Die Feuchtigkeit, respektive das Grund- und Regenwasser, konnte hier am schnellsten entweichen. Möglicherweise wurde das Wasser in einen tiefliegenden Sammler im Nordwestteil des Palastes geleitet.150
Bislang sind die aufwendigen Fundamentkonstruktionen des Palasts von Qatna
Durch Witterungseinflüsse, v. a. Regen und Spritzwasser, aber auch aufsteigende Feuchtigkeit und auskristallisierende Salze besonders gefährdete Bereiche der altorientalischen Lehmziegelbauten bildeten weiterhin die Mauerfüße. Bei der Gebäudeplanung wurden deshalb verschiedentlich Vorkehrungen getroffen, die einer Beschädigung und Schwächung jener äußerst sensiblen Mauerbereiche entgegenwirken sollten.
Üblicherweise handelt es sich hierbei um eine strukturell vom aufgehenden Mauerwerk und häufig auch den Fundamenten verschiedene Ausgestaltung der Mauersockel. Vielfach bestand sie in der Verwendung eines besonderen Baumaterials wie bspw. gebrannter Ziegel oder Stein. Letzteres ist etwa an späturukzeitlichen Wohnhäusern aus Habuba Kabira
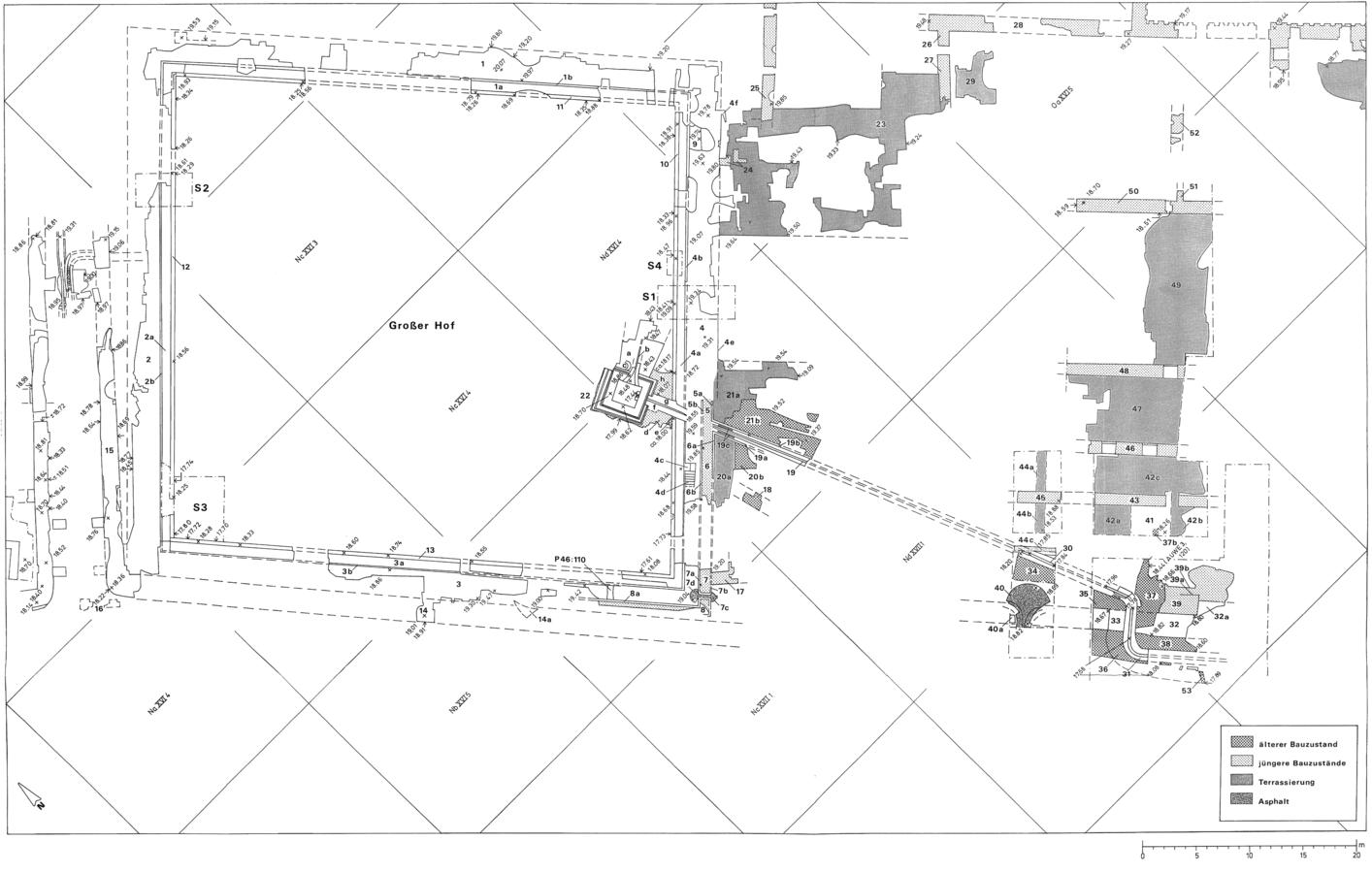
Abb. 3.19: Mutmaßlicher bewässerter Garten (sog. „Großer Hof“) mit Wasserbecken und Zuleitungskanal aus Backsteinen im Eannabezirk von Uruk
Meist waren die Sockel breiter bemessen als die darüber befindlichen Wandpartien. Allerdings konnten Sockel aus Backsteinen allein das Aufsteigen von Salzen nicht verhindern. Dies ermöglichte erst der Einsatz von
An Bauten in Nippur hat man gleichfalls Backsteinlagen zwischen Fundament und aufgehendem Mauerwerk als Sperrbahnen gegen Nässe („damp courses“) eingezogen, die aber unterhalb des Fußbodenniveaus lagen und insofern keine Mauersockel darstellten.

Abb. 3.20: Abwasserleitung aus Tonröhren und steingedecktem Kanal in Habuba Kabira
Von den genannten technischen Vorkehrungen sind ferner diverse, gewöhnlich aus Backsteinen bestehende Arten der äußeren, bisweilen auch inneren Verkleidung von Lehmziegelmauern und -mauerfüßen zu trennen, die indes ebenfalls maßgeblich dem Schutz der Lehmziegelkerne gegen Nässeeinwirkungen gedient haben dürften. In der mesopotamischen Architektur finden sich mannigfache Belege hierfür ab dem Ende des 3. sowie im 2. und 1. Jahrtausend v. Chr. Manchmal hat man sich bei stärkeren Schäden an den Mauerfüßen auch einfach damit beholfen, dass man das Begehungsniveau erhöht hat, so dass die unteren Wandpartien in den Fundamentbereich rückten.153
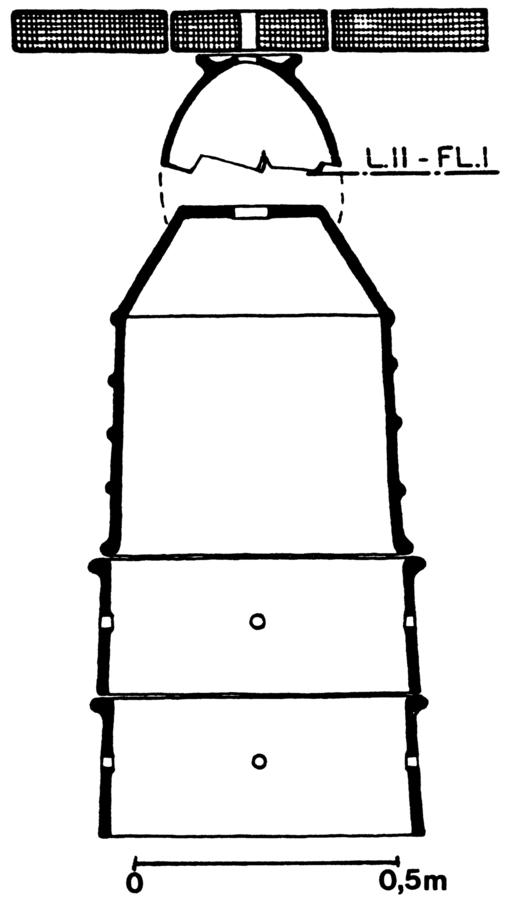
Abb. 3.21: Sickerschacht eines Wohnhauses im Scribal Quarter von Nippur
Die Bauplanung
Die Vorrichtungen zur Entsorgung von Gebrauchs- und Regenwasser überwiegen deutlich gegenüber denen der Frischwasserversorgung. Als Entwässerungsanlagen begegnen am häufigsten Sickerschächte aus Terrakotta, zusammengesetzt aus mehreren übereinander liegenden Ringsegmenten und einer Einlauftrommel, sowie Ziegelkanäle. Die Installation von Sickerschächten mit ihren begrenzten Aufnahme- und Ableitungskapazitäten bot sich allerdings primär im südlichen Zweistromland
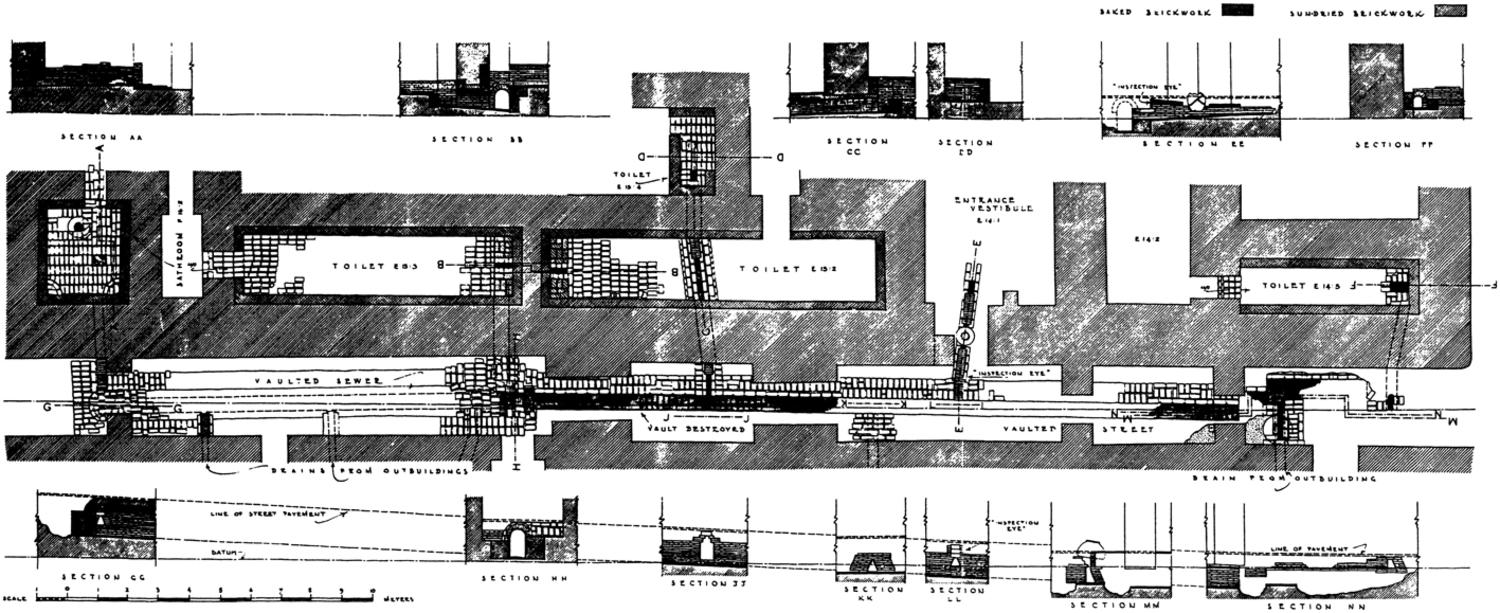
Abb. 3.22: Sammler aus Backsteinen im Bereich des Northern Palace von Ešnunna
Tonrohrleitungen und Tonrinnen verdankten ihre Beliebtheit einer Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten als Unterführungs-, Verbindungs-, Überbrückungs- und nicht zuletzt Zuleitungselemente. So wurden Tonrohre als geschlossene Zuleitungen für Frischwasser bereits im 4. Jahrtausend v. Chr. geschätzt, wie z. B. die Befunde in Uruk
Als Vorform horizontaler Entwässerungsanlagen lassen sich einfache Bodenrinnen identifizieren, die ebenso wie die ersten Steinkanäle bereits ab prähistorischer Zeit belegt sind. Ein Entwicklungssprung ist in der späten Ubaid- und insbesondere der Urukzeit feststellbar. So können während des späten 4. Jahrtausends v. Chr. im Eannabezirk von Uruk
Wie die Befunde aus Uruk spiegeln auch die Anlagen in Habuba Kabira
Charakteristisch für die Entwicklung im südmesopotamischen Schwemmland
Aus dem nordmesopotamisch-syrischen Raum sind im 3. Jahrtausend v. Chr. vor allem Steinkanäle bezeugt, so etwa aus Tell Chuera
Bloß am Rande sei noch auf den Zusammenhang von Bauplanung
3.4.3 Entwurfsleitende Motive
1Funktionale Forderungen, die man an das Bauwerk stellt,
2Konstruktive Möglichkeiten, über die man verfügt,
3Formale Vorstellungen, die man verwirklichen will.
Auf der Grundlage dieser knappen Formel verständigen sich praktizierende Architekten bis heute über die Vielfalt der Faktoren, deren Produkt das fertige Gebäude ist. Die Faktoren stehen in einem Spannungsverhältnis, das sich je nach der Gewichtung durch die Planer und Bauausführenden ändert. Zugleich implizieren die Kausalkategorien durchaus auch Elemente, die aus spezifischen Kulturtraditionen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen sowie den örtlichen Gegebenheiten resultieren. An dieser Stelle ist ein näherer Blick auf die besondere Situation im Alten Orient zu werfen, um die Motive, die die dortige Bauplanung bestimmt haben, noch etwas deutlicher hervortreten zu lassen.
Nachweislich orientieren sich bei altorientalischen Bauten Entwurf und Bauausführung in sehr vielen Fällen an bestimmten architektonischen Traditionen, Konventionen und Typen, die innerhalb eines gewissen Spielraums variiert werden konnten. Klassische Beispiele bilden das Mittelsaalhaus, wie man es etwa aus der Architektur der Ubaid- und Urukzeit kennt (Abb. 3.5, 3.12, 3.25, 3.51), die ab der Ur III-Zeit bezeugte Breitraumcella (Abb. 3.57) und das bābānu-bītānu-Schema aus Tor- und Wohnbezirk im neuassyrischen Palastbau (Abb. 3.26, 3.31).160 Gerade in der deutschen Bauforschung hat die typologische Analyse der altorientalischen Architektur stets eine zentrale Rolle gespielt.161
Gleichzeitig ist auf die Beschränkungen hinzuweisen, denen die Planer oft ausgesetzt waren. Hier sind etwa die Größe und der Zuschnitt der bebaubaren Parzelle oder auch ältere Bauten und Bauteile zu nennen, auf die Rücksicht zu nehmen war. Nicht selten orientierte man sich mit dem Neubau an der Grundrissgestalt eines Vorgängers, dessen Mauern auf einheitlichem Niveau gekappt und anschließend als Fundamente benutzt wurden. Dahinter konnten, wie bereits angesprochen, neben pragmatischen auch religiöse Gründe stehen, denn Baubefunde und Texte dokumentieren, dass eine Grundregel bei der Restaurierung eines altorientalischen Tempels darin bestand, den Bauplatz des Vorgängers zu respektieren und möglichst nicht zu verändern, um keinen göttlichen Unmut zu erregen. In der Praxis bereitete die Einhaltung dieser Regel aber bisweilen Schwierigkeiten.162
Die funktionalen Anforderungen, denen ein neu zu errichtendes Bauwerk entsprechen sollte, haben die Bauplanungen selbstredend ganz maßgeblich bestimmt. Zuweilen, bspw. wenn Bauinschriften existieren, liegen diese Anforderungen offen zutage, häufig jedoch, so z. B. bei mehrdeutigen Grundrissmerkmalen und fehlenden Rauminventaren, können sie aus dem archäologischen Befund nicht mehr im Detail rekonstruiert werden. Die funktionale Bestimmung der späturukzeitlichen Bebauung im Eannabezirk von Uruk
Eine Beeinflussung der Bauplanung durch die konstruktiven Möglichkeiten lässt sich v. a. am Beispiel der Raumbreiten aufzeigen. Diese waren in Mesopotamien
Die Verwirklichung formaler Vorstellungen nahm insbesondere in der öffentlichen Architektur einen wichtigen Part ein, da dort die größten finanziellen Mittel zur Disposition standen. Genauere Informationen zu den entwurfsleitenden Motiven
Nach außen bekundeter Antrieb der Bauaktivitäten, namentlich im Bereich des Tempelbaus, war zumeist das fromme Bestreben, die Götter zufrieden zu stellen, wie es beispielhaft die große Bauinschrift des Gudea
Allerdings verfolgten verschiedene Machthaber, darunter nicht zuletzt die assyrischen Könige mit ihren z. T. gigantischen Städte- und Palastbauprojekten daneben auch sehr viel profanere Absichten, die mit einem ausgeprägten individuellen Gestaltungsanspruch einhergingen. Man wollte sich prächtige und weitläufige Residenzen zum eigenen Ruhm und Vergnügen schaffen. Schon früh konkurrierte so der assyrische Palastbau mit dem gleichzeitigen Tempelbau. Sehr deutlich geht dies aus dem Namen hervor, den Tukulti-Ninurta I.
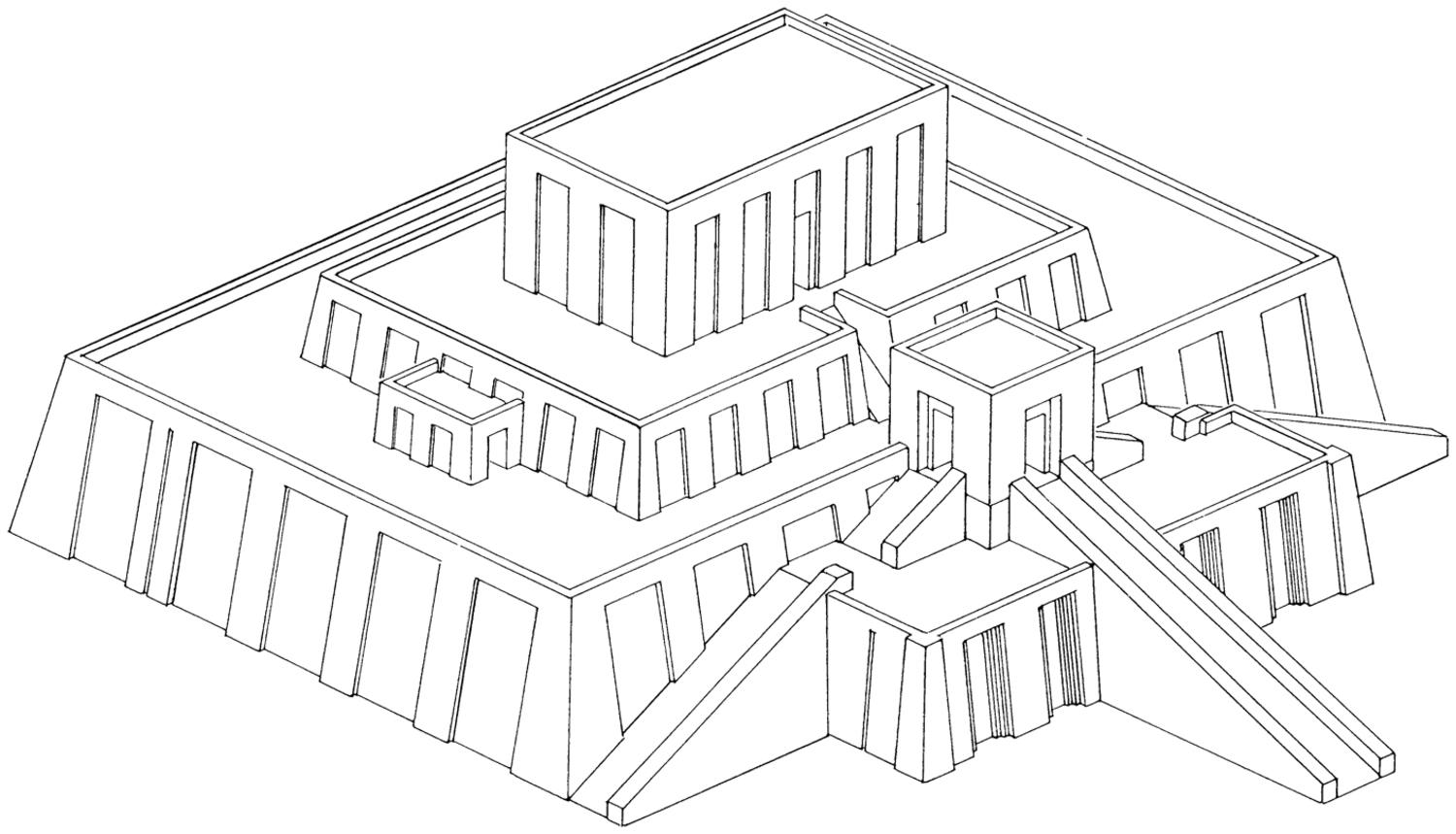
Abb. 3.23: Zikkurrat des Urnammu im Nannaheiligtum von Ur
Sanherib
Indes ist die Anlage neuer Residenzstädte, wie sie aus mittel- und neuassyrischer Zeit in mehreren Beispielen überliefert ist, gewiss auch aus pragmatischen Gründen erfolgt. So dürfte Tukulti-Ninurta I.
Politische Motive bei der Planung und Durchführung öffentlicher Bauvorhaben sind ihrerseits schon in der Architektur aus der Epoche der frühen Staatenbildung, wie sie uns im 4. Jahrtausend v. Chr. exemplarisch in den beiden großen Kultbezirken von Uruk
Explizit wird die propagandistische Absicht in den Bauinschriften der assyrischen Herrscher artikuliert. So betont Assurnasirpal II.
Noch deutlicher als bei Assurnasirpal II.
3.4.4 Planungsniveau und Planungstiefe
Die bislang detaillierteste Untersuchung zur Planung und Ausführung eines monumentalen altorientalischen Bauwerks liegt für Etemenanki, die spätbabylonische Zikkurrat von Babylon
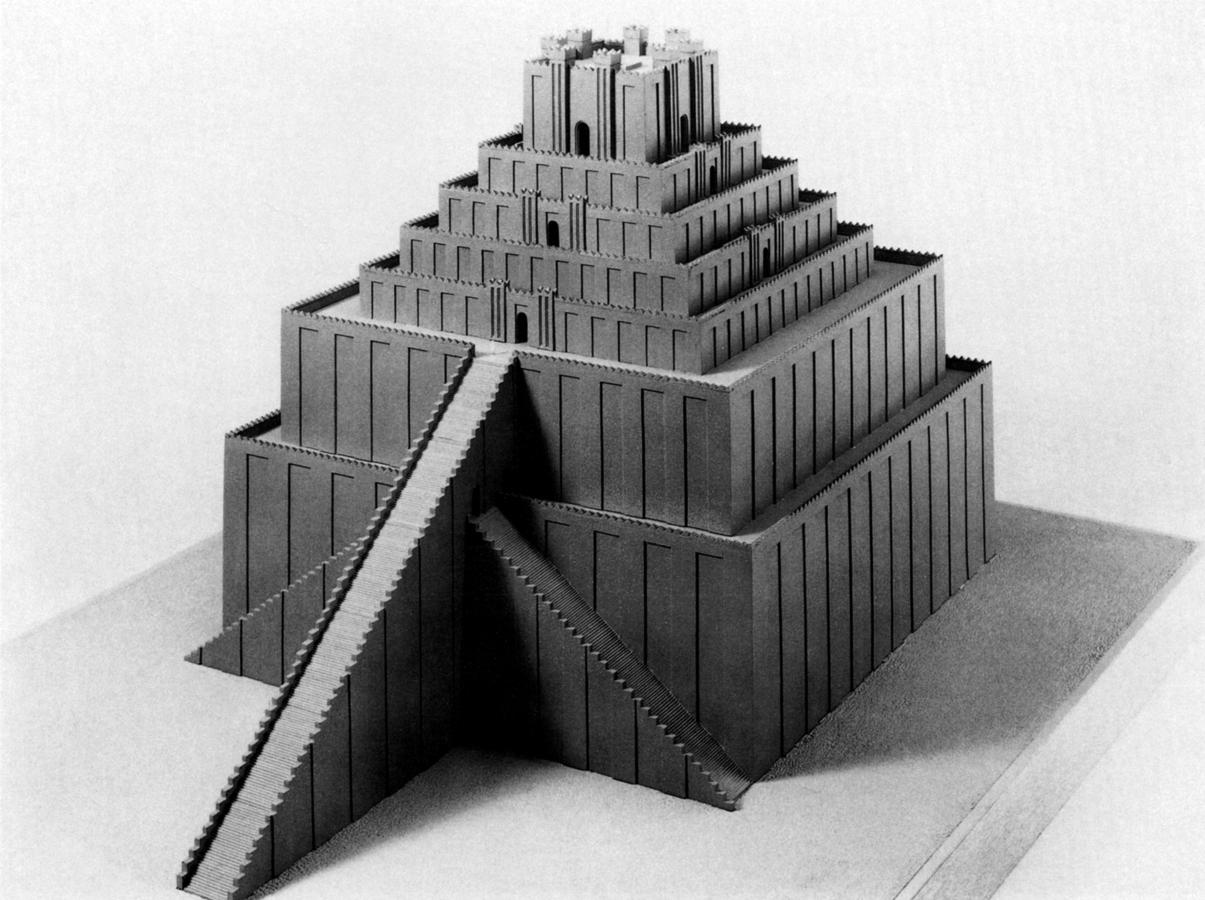
Abb. 3.24: Zikkurrat im Mardukheiligtum von Babylon
Der Ruine des Tempelturms Etemenanki wurden lediglich zwei kurze Feldforschungen gewidmet. Im Jahre 1913, bei der einzigen Gelegenheit, an die normalerweise unter dem Grundwasserspiegel liegenden Teile zu kommen, beschränkte sich R. Koldewey darauf, den Grundriss der aus einem Mittel- und zwei Seitenläufen bestehenden Treppenanlage und des Backsteinmantels der Zikkurrat zu klären sowie den Anschluss des Mantels an den Lehmziegelkern zu erkunden. Er ahnte damals noch nicht, wie unterschiedlich man diesen Befund interpretieren und mit den schriftlichen Quellen verknüpfen konnte.
Später erkannte Koldewey die Notwendigkeit, auch das aus Lehmziegeln bestehende Kernmassiv der Zikkurrat genauer zu erforschen. Dies geschah aber erst 1962 unter der Leitung von Schmid. Zwar blieb die Sondage auf die über dem Wasser anstehenden Teile der Zikkurratruine begrenzt, doch konnte das Verhältnis des Lehmziegelkerns zum Backsteinmantel bestimmt werden. Zudem erbrachte Schmid den Beweis, dass der letzte Tempelturm in Babylon
Die im Zikkurratmassiv erfassten Vorgängerbauten können in die neuassyrische und sehr wahrscheinlich altbabylonische Zeit datiert werden. In ersterem Fall steht Asarhaddon
Für Schmid bot sich an, den Befund beider Feldforschungen im Zusammenhang aufzuarbeiten, da erkennbar war, dass sich die Dokumentationen ergänzen würden. Im Zuge der Auswertung konnte er darüber hinaus aber auch das Verhältnis der Ruine zu einem bereits 1876 bekannt gewordenen und 1913, zeitgleich mit den ersten Ausgrabungen an Etemenanki, umfassend edierten Keilschrifttext eruieren, der den Tempelturm beschreibt und die primäre Informationsquelle zu seinem Aufbau und offenbar auch zu seinem Hochtempel ist. Es handelt sich um die nach ihrem Kopisten benannte Anubelšunu-Tafel. Mit ihrer Veröffentlichung war die Diskussion um die Rekonstruktion der Zikkurrat von Babylon
Die Anubelšunu-Tafel repräsentiert die 229 v. Chr. in der Regierungszeit Seleukos II.
Die in der Anubelšunu-Tafel vorkommenden Längenmaße basieren auf der babylonischen Elle ammatum, deren gängiger absoluter Wert bei 50 cm liegt und 30 ubānu, d. h. Finger(breiten), entspricht. Allerdings differenziert der Schreiber in der Bezeichnung der Elleneinheiten. Opinio communis ist, dass den Angaben im fünften Abschnitt der Tafel eine Elle von anderthalbfacher Größe der Normalelle zugrunde liegt. Die Maße des Baukörpers hat man einmal im Sechzigfachen, sonst im Zwölffachen der Elle, d. h. in nindan, ausgedrückt.
Ein Kardinalproblem der Anubelšunu-Tafel bestand stets in der Unsicherheit darüber, ob der sechste Abschnitt den Tempel Esagila oder den Hochtempel auf dem Turm beschreibt. Den Raummaßen ist dort keine Maßeinheit beigefügt, nur für ein großes Bett werden explizit Ellenmaße genannt. Man hat deshalb lange darüber gestritten, ob auch die übrigen Maße in Ellen oder als Sechzigstel des nindan, d. h. als Fünftelellen, zu verstehen sind. Nur dann nämlich lassen sie sich auf den Hochtempel beziehen. Dass in der Tat Sechzigstel des nindan gemeint gewesen sein dürften, kann Schmid jetzt anhand eines annähernd zeitgenössischen Textes mit Maßangaben, die offenkundig in Fünftelellen zu lesen sind, demonstrieren. Gegenüber der Elle und ihrer Untereinheit Finger respektive ubānu bildete die Fünftelelle für die Baumeister eine besser geeignete Maßeinheit, um sowohl im Hausbau übliche Mauerstärken als auch Raumgrößen auszuweisen.
Weiterhin ist evident, dass in der Kopie des Anubelšunu
Im Zuge seiner detaillierten Analyse der archäologischen und philologischen Quellen kann Schmid über den Befund an den Zikkurrattreppen deutlich machen, dass die Anubelšunu-Tafel den jüngsten Zustand des Stufenturms, also die Zikkurrat mit dem Backsteinmantel, beschreibt. Er kann aufzeigen, dass das in der Tafel überlieferte Höhenmaß der untersten Terrasse auf den Gründungshorizont der Zikkurrat bezogen ist und die Höhe der Brüstung auf der Terrasse mit einschließt. D. h., Anubelšunu gibt einen Aufriss der Zikkurrat wieder, der auch das nicht sichtbare Fundament impliziert. Das Höhenmaß kann somit nicht von einem nachträglichen Aufmaß stammen, sondern muss ein Maß der Planung sein. Damit gelingt Schmid der äußerst bedeutsame Nachweis, dass die von Anubelšunu
Die Vorlage der Beschreibung könnte eine einfache, mit Maßangaben versehene Zeichnung gewesen sein, wie sie für altorientalische Zikkurratbauten in Form von Grund- bzw. Aufrisszeichnungen durchaus belegt sind. Für die Treppen gab die Zeichnung vermutlich aber nur die generelle Form und nicht die Maße an, da deren genaue Bestimmung der Ausführungsplanung überlassen blieb. Dies erklärt, weshalb die Treppen in der Anubelšunu-Tafel keine Erwähnung finden.
Die Erkenntnis, dass die Anubelšunu-Tafel ein Planungsstadium der Zikkurrat wiedergibt, verleiht dem Text einen neuen Stellenwert. Seine Informationen können nun in Abhängigkeit vom Befund relativiert werden, während umgekehrt die Grabungsergebnisse jeweils vor dem Hintergrund der Umsetzung eines Bauplans in die Wirklichkeit zu bewerten sind.
Festzuhalten ist, dass der Bauplan von Etemenanki die Ausführung nur in ihren Grundzügen und nicht in der Art einer modernen Werkplanung determiniert hat. Entsprechendes dürfte dann sehr wahrscheinlich auch für die Bauplanung älterer Perioden gelten.176 Sofern es nicht doch noch ein uns unbekanntes Zwischenstadium eines Werkplans gegeben haben sollte, mussten dadurch abgesehen von der Berechnung und individuellen Gestaltung der Treppen wohl auch alle übrigen Details der Expertise der ausführenden Baumeister auf der Baustelle vorbehalten bleiben. Im konkreten Fall der beiden Zikkurrat-Seitentreppen etwa waren die Bauleute bei der Realisierung prinzipiell bloß an das Steigungsverhältnis für die Tritt- und Wangenstufen, an die Terrassenhöhen und an die Grundregel, Terrassenmantel, Treppen und Wangen im Mauerwerksverband auszuführen, gebunden.177
Schmid konnte die Anubelšunu-Tafel lediglich deshalb als Planbeschreibung des spätbabylonischen Stufenturms Etemenanki identifizieren und zugleich das hinter der Ausführung des Gebäudes stehende Dimensionierungsprinzip entschlüsseln, weil er den Baubefund des Grundrisses gezielt im Hinblick auf den Aufriss interpretierte.
Entscheidend war neben der Kenntnis der Maßeinheit und des Maßsystems die Feststellung der ungewöhnlichen Ausführungsgenauigkeit, mit der man das im Text erwähnte Grundrissquadrat der Zikkurrat von 180 Ellen Länge und Breite angelegt hatte. Aus diesem Ellenmaß und der Beobachtung, dass darauf 270 Ziegel entfielen, ließ sich das Richtmaß für Ziegel und Fuge nach folgender Rechnung ermitteln: 180 Ellen x 30 ubānu = 5400 ubānu. 5400 ubānu : 270 = 20 ubānu = 33,9 cm für Ziegel und Fuge. Bei Kantenlängen des Ziegels von 31,5 bis 32 cm blieben für die Fuge 2 bis 2,4 cm = 1
 bis 1
bis 1
 ubānu und damit genügend Spielraum für Ausgleichsmaßnahmen.178
ubānu und damit genügend Spielraum für Ausgleichsmaßnahmen.178
Auf analoge Weise ins babylonische Maßsystem umgerechnet, verrieten als nächstes die Gliederungsmaße der aus Vor- und Rücksprüngen bestehenden Mantelfassaden das zugrunde liegende Dimensionierungsprinzip und damit die Richtmaße.
Es folgte die Entdeckung, dass die Stufen der Treppenwangen in der Einheit ubānu, dem Dreißigstel der Elle, bemessen worden sind, Höhe und Breite im Verhältnis 8:11 gestanden und die Höhe jeweils 10 Ziegelschichten betragen hat. Hiermit war nicht nur das exakte Steigungsverhältnis der Zikkurrattreppen zu bestimmen, sondern auch das Verfahren zu rekonstruieren, nach dem die Treppen von den Baumeistern berechnet worden sind. Mittels dieser Erhebung konnten die Maßangaben auf der Anubelšunu-Tafel relativiert und die Tafel selbst als Planbeschreibung erkannt werden. Für Schmid eröffnete sich die Möglichkeit, die im Gegensatz zu den Seitentreppen unmittelbar auf die zweite Terrasse führende Mitteltreppe und das Hofniveau zu berechnen und nachzuweisen, dass sich der Terrassenkörper von Etemenanki im Laufe der Zeit um mehr als einen halben Meter abgesenkt hatte.179
Baumaßnahmen an Etemenanki sind urkundlich für die Zeit vor Sanherib
Schmids Untersuchungen hatten nun zweifelsfrei ergeben, dass die Anubelšunu-Tafel innerhalb der langen Baugeschichte des Tempelturms die Planbeschreibung für die spätbabylonische Zikkurrat des Nabupolassar
Der in der
Die Zikkurrat Asarhaddons
Bei dem Baukörper der spätbabylonischen Zikurrat, so wie er aus den Angaben der
Entsprechend sei durch die Höhe der Ruine aus der Zeit Asarhaddons
Bevor der Entwurf der Zikkurrat des Nabupolassar
Die Planarbeit beruhte also nicht nur auf einer detaillierten Kenntnis des Zustands der Vorgängerbauten sowie der Baugrundverhältnisse, sondern erforderte bereits erste Maßnahmen auf der Baustelle. Vermutlich sind sie schon vor Einsetzen der eigentlichen Planung, mit Sicherheit aber vor der Ausarbeitung des geltenden Entwurfs, durchgeführt worden. Um mit dem Neubau beginnen zu können, war es ja ohnehin unumgänglich, den Schutt und die nicht mehr standsicheren Partien der Vorgängerbauten zu entfernen. Hierbei scheint auch der Lehmziegelmantel der Zikkurrat des Asarhaddon
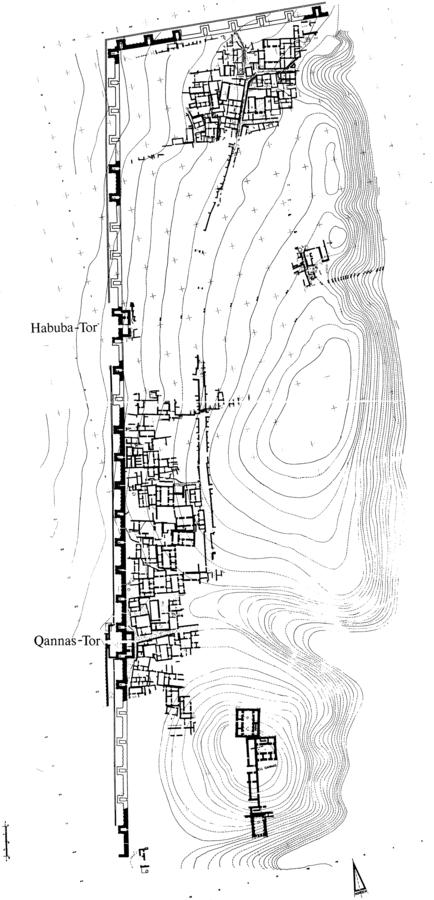
Abb. 3.25: Stadtanlage von Habuba Kabira
Schmid nimmt an, dass die Untersuchungen an der Ruine keine völlig exakten Werte für das Maß geliefert haben, um das der Zikkurratmantel gegen das Hofniveau abzuteufen war. Jedenfalls war es später nötig, die Seitentreppen umzuplanen und tiefer anzusetzen, um sich damit einen verbindlichen Bezugshorizont zu schaffen. Hieran lassen sich gewisse Probleme bei der Treppenplanung ablesen und vielleicht erklärt sich hieraus auch, weshalb in der Planbeschreibung der
Die Analysen verdeutlichen, dass die Beschreibung der
Weitere eingehende Studien zum Planungsprozess altorientalischer Bauten sind zuletzt von R. Eichman und M. van Ess vorgelegt worden. Sie können hier nur kurz angesprochen werden. Eichmann befasst sich mit der Architektur aus den Archaischen Schichten von Uruk
Van Ess behandelt in ihrer Arbeit die Architektur des Eanna-Heiligtums von Uruk
Vielfältige Hinweise auf ein hohes Maß an Vorausplanung finden sich ebenfalls im Bereich des altorientalischen Städtebaus.187 Hier liegt mit der späturukzeitlichen Niederlassung Habuba Kabira
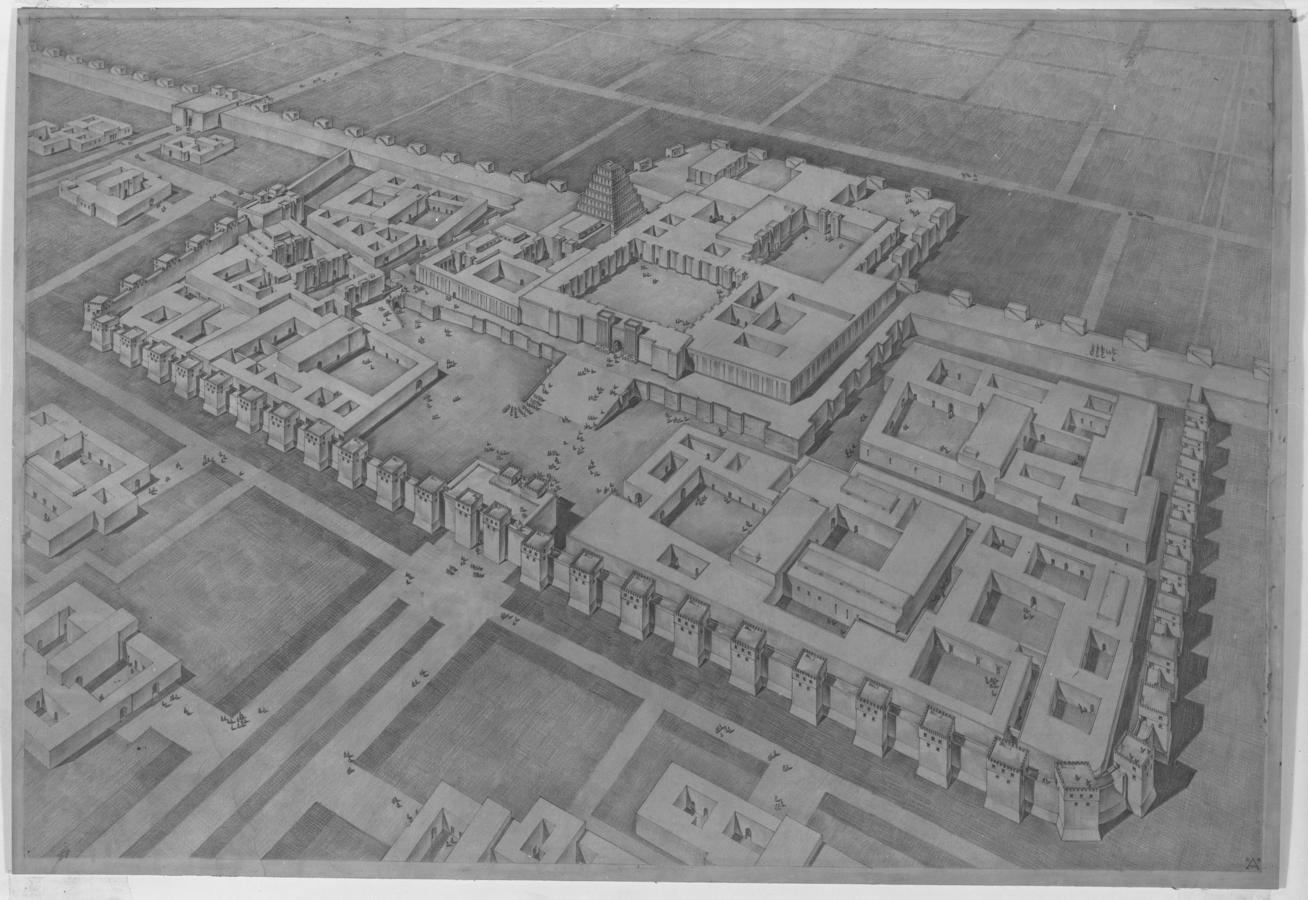
Abb. 3.26: Rekonstruktion der über ausgedehnten extramuralen Gärten angelegten Zitadelle von Dur-Šarrukin
Für den späteren Städtebau ab der Akkadzeit (24.–22. Jh. v. Chr.) zeigt M. Novák am Beispiel der Residenzstädte auf, dass die Akzentuierung bestimmter Bauten und intraurbaner Achsen einen Reflex der kosmologischen Ordnung darstellen konnte. Sehr deutlich wird das etwa in Dur-Šarrukin
3.5 Logistik
3.5.1 Ressourcen, Verkehrswege und Transport
Ungeachtet der Erwähnung importierter Baumaterialien in Herrscherinschriften seit der jüngerfrühdynastischen Zeit dürfte im 3. Jahrtausend und vielfach auch noch im 2. Jahrtausend v. Chr. die tatsächliche Menge der in Verbindung mit öffentlichen Bauprojekten nach Mesopotamien
Hierbei ist zu betonen, dass neben dem in den Textquellen deutlich überwiegenden staatlichen Wirtschaftssektor in Mesopotamien
Bei den außerhalb des Zweistromlandes gelegenen Regionen, aus denen man Baumaterialien bezog, handelt es sich primär um die benachbarten Bergländer, die sich vom Taurus- respektive Amanusgebirge
Die wichtigste Verbindung zu den Rohstoffquellen in Syrien
Anhaltspunkte für den Lastentransport des frühen 2. Jahrtausends v. Chr. auf dem Euphrat
Außer zum Seehandel im Ostmittelmeerraum
Zahlreiche weitere Verkehrsrouten, bei denen Streckenabschnitte zu Land und zu Wasser einander abwechselten, verbanden Euphrat
Der Tigris
Die Passage durch das Zagrosgebirge auf das iranische Plateau erfolgte auf dem Landweg. Eine wichtige Route bildete hier seit alters die Wegstrecke, die heute durch die Städte Bagdad
Schon sehr früh entwickelte sich zudem weiter südlich das elamische Susa
Sehr schwere Lasten, zu denen auch Baumaterialien zählen, ließen sich in Mesopotamien
Kennzeichnend für die mesopotamische Flussschiffahrt waren vornehmlich kleinere Wasserfahrzeuge aus lokal verfügbaren Materialien, die sich im Laufe der Jahrtausende kaum gewandelt haben. Modelle von Booten liegen bereits aus der Ubaidzeit vor und spätestens ab dem 4. Jahrtausend v. Chr. sind die Kenntnis des Segels und eine frühe Seeschiffahrt im Golf bezeugt.
Bildliche Darstellungen auf urukzeitlichen Siegeln zeigen, dass im Süden Flöße und Boote aus Schilf, die gestakt und gepaddelt wurden, in Gebrauch waren. Weiter stromaufwärts hat man Flöße und runde Boote aus Häuten und Korbgeflecht benutzt
Auf den besser schiffbaren Abschnitten der Wasserwege verkehrten daneben auch größere Boote. Wir wissen nicht viel über ihre Bauart, doch noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts n. Chr. erfolgte der Lastentransport auf dem mittleren Euphrat hauptsächlich auf Flößen aus Holz und Reisig, die mit Tamarisken- oder Weidenrinden festgezurrt waren und denen aufgepumpte Ziegenhäute zusätzlichen Auftrieb gaben. Die Flöße konnten je nach Größe Lasten von ca. 5 bis 36 Tonnen tragen und man darf annehmen, dass auf ähnliche Weise konstruierte Flöße in Mesopotamien
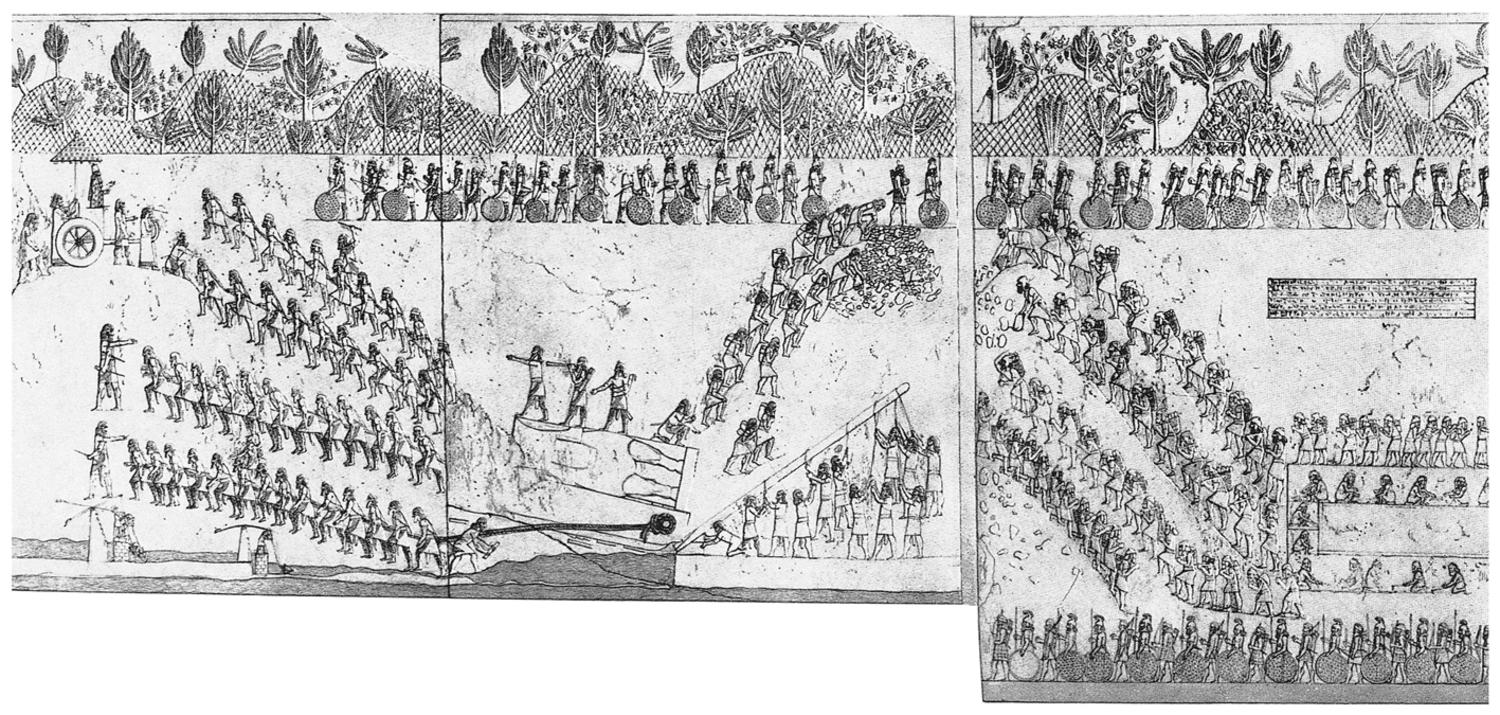
Abb. 3.27: Orthostatenreliefs mit Darstellungen von Steinbrucharbeiten und des Transports einer Torhüterfigur, aus dem Südwestpalast Sanheribs in Ninive
Im Bereich des Landtransports spielten angesichts des oft unwegsamen Geländes, das den Einsatz von Wagen erschwerte, Lasttiere die wichtigste Rolle. Dass allerdings auch die menschliche Muskelkraft bei der Beförderung schwerer Lasten ein zentraler Faktor war, dokumentieren anschaulich die Orthostatenreliefs Sanheribs
Unter den Lasttieren ist in Mesopotamien
Ab dem späten 4. Jahrtausend v. Chr. treten im Zweistromland
Einen näheren Einblick in den Bereich der Materialbeschaffung und des Transports bei einem großen Bauprojekt der neuassyrischen Zeit gewähren Briefe aus der Zeit Sargons II.
Stroh in Gestalt von Häcksel wurde u. a. bei der Ziegelproduktion benötigt, die vor Ort von der lokalen Bevölkerung durchgeführt wurde, während Schilflagen beim Aufmauerungsprozeß in regelmäßigen Abständen in das Ziegelwerk integriert wurden, um Setzungsproblemen vorzubeugen. Die Materialien wurden aus den nahe gelegenen Provinzen herbeigeschafft, und der Bedarf war so groß, dass ein hoher assyrischer Würdenträger sich in einem Brief beklagte, dass alles Stroh in seinem Land für Dur-Šarrukin
Baugestein unterschiedlicher Art gab es in Nordmesopotamien
Prinzipiell bereiteten der Abbau des Materials und die Beförderung zu den Baustellen in Dur-Šarrukin
Die Kolosse konnten eine Höhe von nahezu 6 m und ein Gewicht von 50 Tonnen erreichen und ihre Bereitstellung oblag den Großen des Königs. Beim Transport bestand die schwierigste Aufgabe darin, dass die rohbehauenen Figuren aus Steinbrüchen auf dem Dur-Šarrukin
Sehr detaillierte bildliche Darstellungen der Vorfertigung und des Transports steinerner Bauteile, die nur wenig jünger als die Korrespondenz Sargons
Zum Transport, der in der Nähe des Flussufers und unter den Augen des Königs stattfindet, hat man die gewaltige Türhüterfigur auf eine Art Schlitten gelegt, der von vier Kolonnen aus Zwangsarbeitern mit langen Seilen fortbewegt wird. Die Männer werden von Vorarbeitern eingewiesen und von in Reihen aufgestellten Soldaten beaufsichtigt. Unter dem Schlitten befinden sich Rundhölzer. Ein langer Baumstamm, der von Männern mit Hilfe von Schlingen betätigt wird, kommt als Hebel zum Einsatz. Eine weitere Gruppe von Arbeitern trägt währenddessen Steine ab, offenbar um die Bahn zu ebnen.
In einer angrenzenden Szene wird gezeigt, wie Steinbrucharbeiter eine abgewinkelte Rinne in den Felsen schlagen. Aus der Beischrift geht hervor, dass es auch hier um die An- bzw. Vorfertigung von Türhüterfiguren für die Leibungen der großen Palasttore in Ninive
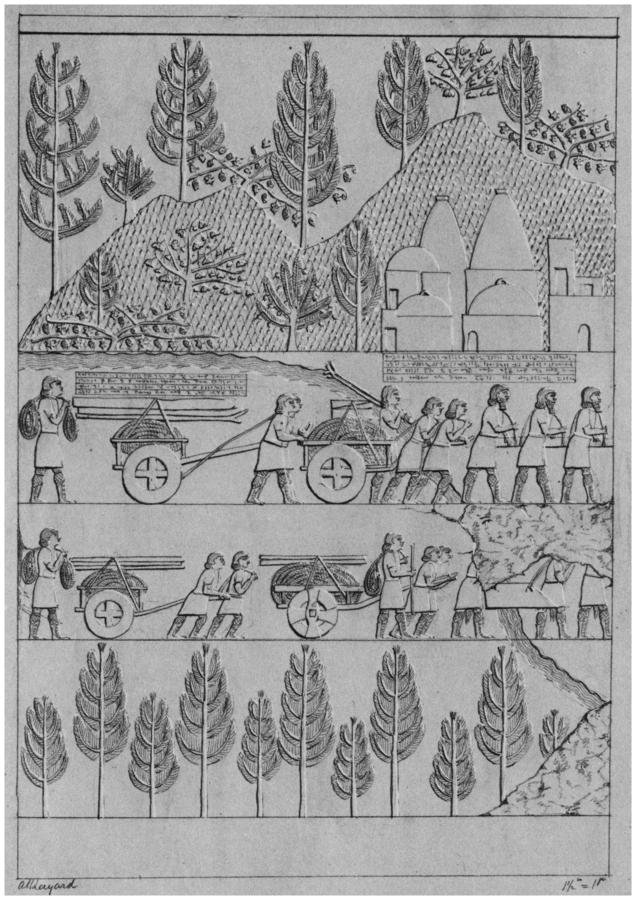
Abb. 3.28: Orthostatenrelief mit Darstellung des Transports von Arbeitsmaterialien, aus dem Südwestpalast Sanheribs

Abb. 3.29: Orthostatenrelief mit Darstellung des Holztransports zu Wasser, aus dem Königspalast Sargons II.
Holz für die neue Residenzstadt Sargons II.
Hauptsächlich kam das Bauholz
In Assur
Einiges Holz
Außer den Briefen aus der Zeit Sargons II.
Auf einem Fragment des Bronzetors von Balawat
Besonders aussagekräftige Darstellungen liegen aus dem Palast Sargons II.
Vermutlich zeigen die Reliefszenen das Schlagen von Hölzern im Amanusgebirge
Neben Steinen und Bauholz gelangten unter Sargon II.
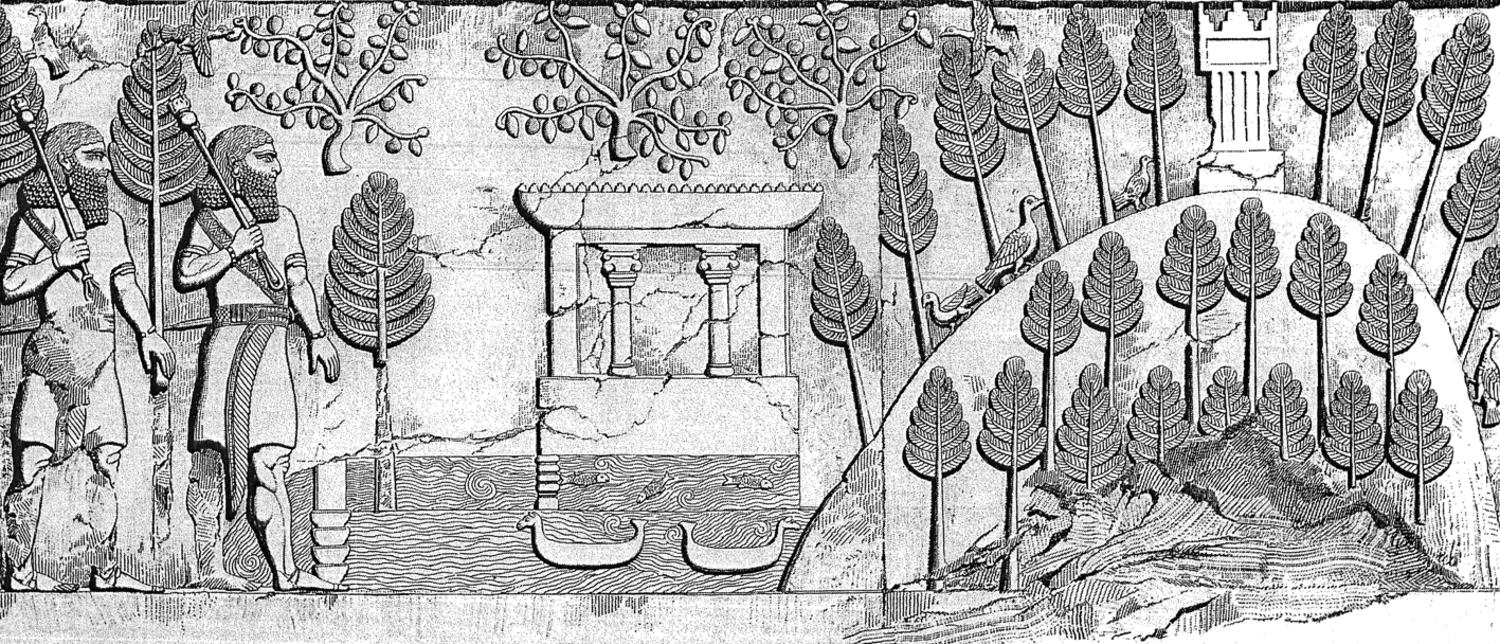
Abb. 3.30: Orthostatenreliefs mit Darstellung eines Parks, aus dem Königspalast Sargons II.
Bei der Anpflanzung der Bäume wurden Planzeichnungen zugrunde gelegt. Das geht aus einem Brief des Gouverneurs von Kalhu
3.5.2 Baustellen-Logistik
Bereits aus mittelassyrischer Zeit gibt es einige Wirtschaftstexte, die die Bauarbeiten in der unter Tukulti-Ninurta I.
Gemäß Briefen aus der späten neuassyrischen Zeit war gängige Praxis, dass königliche Beauftragte den Herrscher über erforderliche Bauarbeiten im Detail informiert, den Fortgang der Arbeiten auf der Baustelle überwacht und gesteuert sowie gleichfalls den Materialfluss kontrolliert haben. Bei Arbeiten an einem Tempel in Uruk
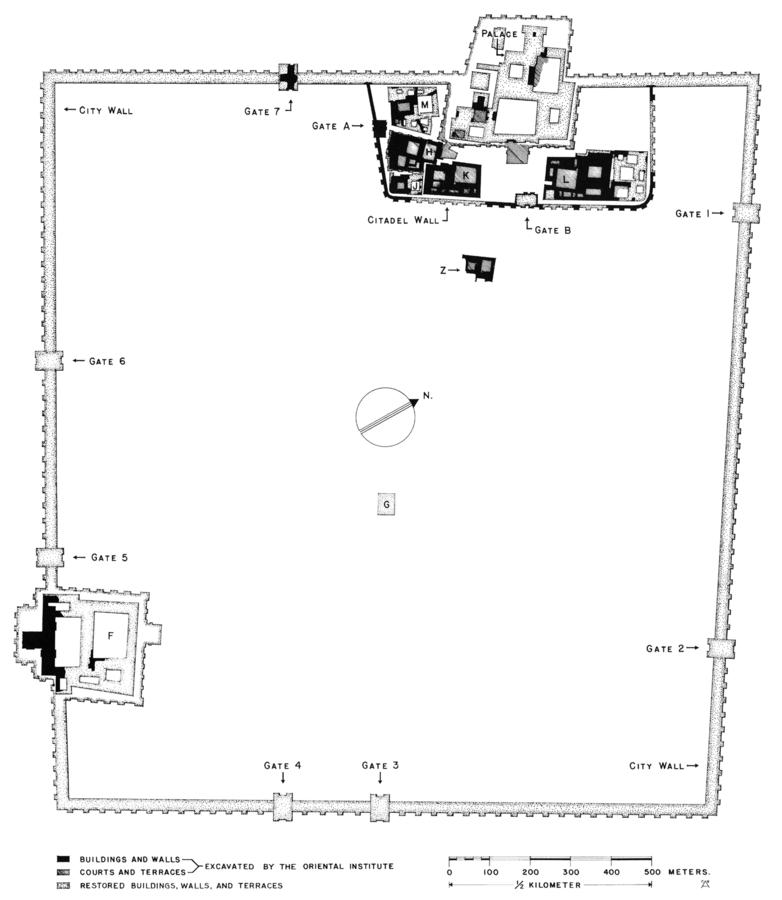
Abb. 3.31: Stadtanlage von Dur-Šarrukin
Indes ist nicht immer eindeutig zu entscheiden, ob die in der Korrespondenz geschilderten organisatorischen Abläufe spezifische oder allgemein typische Gegebenheiten repräsentieren. Zumeist aber standen konkrete Probleme hinter der Abfassung der Briefe. So berichtet der Gouverneur von Assur
Bei den Großbauprojekten stand die Masse der Arbeiter unter militärischer Kontrolle. Den Annalen Assurnasirpals II.
Von Asarhaddon
Neben den Hinweisen auf Zwangsarbeit liegen aus neuassyrischer Zeit freilich auch Arbeitsverträge von Ziegelfabrikanten, Baufachmännern und Zimmerleuten vor, bei denen der Vertragspartner jeweils der Palast gewesen sein könnte.209
Im Folgenden soll noch einmal etwas näher auf das schon verschiedentlich erwähnte Bauprojekt von Dur-Šarrukin
Die Mauern von Dur-Šarrukin
Offizielle Königsinschriften und Reliefs aus dem Königspalast von Dur-Šarrukin
Die Briefe, die fraglos nur einen Teil der gesamten Korrespondenz zu Dur-Šarrukin
Der Briefwechsel behandelt in der Hauptsache praktische Fragen wie die Planung, Organisation und Beaufsichtigung der Arbeiten sowie die Rekrutierung von Bauleuten und die Beschaffung von Baumaterialien. Einmal mehr bildeten auftretende Probleme den wichtigsten Grund für die Verfertigung der Briefe.211
Initiator des Bauprojekts war der König selbst. Dies geht nicht nur aus den offiziellen Inschriften Sargons II.
Eine Anweisung an den Gouverneur von Kalhu
Das Gros der Arbeitskräfte und Baumaterialien für Dur-Šarrukin
Während solchermaßen kein Mangel an einfachen Arbeitern herrschte, scheint der Bedarf an Handwerkern und Spezialisten das Angebot überstiegen zu haben, obwohl auch hier neben den einheimischen Kräften Nichtassyrer und Personen aus den unterworfenen Gebieten einen erheblichen Anteil stellten. Ein Brief des Gouverneurs von Zobah
So beklagt sich der mit dem Bau des Kanals zur Wasserversorgung der Stadt betraute Baumeister Paqaha
Bemerkenswert ist, dass die Order zur Steigerung der Zahl spezialisierter Kräfte direkt vom König und nicht vom königlichen Schatzmeister, dem Hauptkoordinator des Bauprojekts, ausging. Neben dem persönlichen Interesse des Herrschers am Baufortschritt spiegelt sich hierin auch das stark zentralisierte assyrische Verwaltungssystem
Während die überwiegende Zahl der Briefe die Beschaffung von Baumaterialien betrifft, beziehen sich verhältnismäßig wenige Schreiben unmittelbar auf die Arbeiten auf den Baustellen in Dur-Šarrukin
Andere Schreiben haben den Bau des nach Dur-Šarrukin
Abschließend soll noch auf einige Überlegungen zur Rekonstruktion der Baudurchführung sowie zur Baustellenorganisation im Bereich der spätbabylonischen Zikkurrat von Babylon
Gleich nach dem Beschluss Nabupolassars
Das Kernmassiv stand jetzt auf einer abgeglichenen Arbeitsebene, unterhalb derer es allseitig von dem 5 bis 6 m breiten Rest des neuassyrischen Lehmziegelmantels umfasst war. Da die Flanken des Kernmassivs unregelmäßig verliefen, ließen sich die Außenfluchten der alten Zikkurrat nur dadurch ermitteln, dass man sie unterhalb der Arbeitsebene in Gruben untersuchte und hierzu den Lehmziegelmantel durchstieß. Zwar hatten sich auch dort keine intakten Außenkanten erhalten, doch konnte beobachtet werden, dass das Kernmauerwerk in etwa 1 m Tiefe in Form einer breiten Stufe vor den korrodierten Terrassenfuß trat. Es zeigte damit ungefähr das Benützungsniveau der frühesten, mutmaßlich altbabylonischen Zikkurrat an.
Auf der Grundlage der Sondagen fasste man den Entschluss, für den Neubau nicht das höherliegende neuassyrische, sondern das tieferliegende ältere Hofniveau wieder aufzunehmen. Darin lag wohl auch politisches Kalkül: Der spätbabylonische Bauherr wollte augenscheinlich unmittelbar an die ruhmreiche altbabylonische Tradition anknüpfen. Von dem tieferen Horizont ging dementsprechend die Treppenberechnung für die Zikkurrat Nabupolassars
Mit Hilfe der Sondagen waren damit die nötigen Informationen zu den tiefliegenden Bauhorizonten gewonnen und auch in etwa die Außenfluchten der alten Zikkurrat ermittelt worden. Die Baumeister mussten nun die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der neue Mantel das Kernmassiv auf allen Seite in gleicher Stärke von 30 babylonischen Ellen umschließen konnte.
Hierzu wurden über der Arbeitsebene die Flanken des Kernmassivs in einer Weise lotrecht abgearbeitet, dass sie eine Distanz von 120 Ellen zueinander erhielten. Die so geschaffene Meßbasis lag jedoch nicht genau zentrisch zur alten Zikkurrat, weil man deren Außenfluchten in den Gruben nur ungefähr hatte erfassen können. Dennoch ist die Meßbasis, wie Schmid hat aufzeigen können, sehr exakt. Das Sollmaß des Abstands der Meßebenen wird auf der Nordseite des Kernmassivs um 8 cm, auf der Süd- und Ostseite um 18 cm und auf der Westseite um 13 cm überschritten.
Über die wirtschaftliche und technische Organisation der Großbaustelle von Etemenanki haben wir fast keine Nachrichten. Wenn aber ganze Völkerschaften für die Anfertigung und den Transport des Baumaterials aufgeboten wurden, kann man den Aufwand und die logistischen Probleme zumindest erahnen.
Schmid legt zudem dar, dass man die Arbeit an der Zikkurrat in Baulose eingeteilt und den einzelnen Meistern weitreichende Kompetenzen beim Ausheben des Baugrabens und Anlegen des Mantelmauerwerks übergeben hat. Dies zeigen z. B. sehr unterschiedliche Vorgehensweisen bei der Ausführung der Pfeiler-Nischen-Gliederungen in den einzelnen Mantelabschnitten.218 Vermutlich sind 12 Großgruppen am Werk gewesen. Über deren Meistern standen sehr wahrscheinlich die von Nabupolassar
Durch die in das Kernmassiv eingegrabene, eine rund 50 cm breite Stufe bildende Meßbasis und die Sondagen wurde die Arbeit zweifellos erleichtert. Die Meister der einzelnen Baulose konnten die Fluchten, die sie gerade benötigten, selbst einmessen und überprüfen. Sie wussten weiterhin genau, was sie unter der abgeglichenen Arbeitsfläche erwartete: Knapp 1 m unterhalb der Meßbasis trat mit dem Hofniveau der ältesten Zikkurrat das Mauerwerk um etwa 1,5 m vor. Es reichte mit schwach geböschter Außenfläche noch mindestens 2,2 m tiefer und unterschnitt hierbei den Grundwasserspiegel um gut 1,3 m.
Die Vorbereitungen auf der Baustelle, auf die die Gründungsurkunde Nabupolassars
Zunächst konnte der Baugraben noch über dem Grundwasserspiegel ausgehoben werden. Hierbei grub man den Lehmziegelmantel Asarhaddons
Nabupolassar
Es ist davon auszugehen, dass jedes Baulos eine Baustelleneinrichtung mit Materiallager, Lehm- und Wassergruben, Asphaltöfen und eigenen Zugangswegen zum Bau besessen hat.219 Mit dem Anwachsen des Backsteinmantels und dem Verfüllen des Grabens wurde der Transport der Materialien zunächst einfacher, später jedoch musste man sie in immer größere Höhe heben. Hierzu konnte man natürlich die Zahl der Arbeiter steigern. Auf der Manteloberfläche hingegen konnten nicht beliebig viele Maurer zum Einsatz kommen. Der eigentliche Engpass wird somit im Verlegen der Ziegel zu sehen sein. Mittels einer groben Schätzung der Ziegelmengen vermittelt Schmid hierbei eine ungefähre Vorstellung vom Material- und Zeitaufwand beim Zikkurratbau.
Der Aufbau des Backsteinmantels begann von den Außenrändern her mit zwei Ziegelschichten, die die Grabensohle etwa auf halber Breite überdeckten und so den Randverband sicherten. Erst die dritte Ziegelschicht schloss an den Lehmziegelkern an. Damit erhielt der Mantel in Sohlenhöhe 40 bis 41 Ziegel (13,56 bis 13,90 m) Stärke und erforderte für eine einzige Schicht etwa 36.400 Quadratziegel.
Was innerhalb eines Jahres zu schaffen war, lässt sich anhand der 30 Ellen Höhe überschlagen, die Nabupolassar
Für den ersten Bauabschnitt, bei dem bloß der Mantel mit 2 Rand- und 6 Vollschichten aufgemauert wurde, waren etwa 250.000 Ziegel erforderlich. Die Ziegelschichten senkten sich jedoch uneinheitlich ab, so dass man ausgleichen musste, um einen genauen Bezugshorizont für den weiteren Aufbau der Zikkurrat zu erhalten. Diesen berechneten die Baumeister nach der Höhe von 10 Schichten über der Sohle des Mantels. Dort wurden mittels einer Ausgleichsschicht die eigentlich erst ab der Hofebene geplanten Seitentreppen dergestalt angelegt, dass ihre Antritte exakt auf gleicher Höhe zu liegen kamen. Tritt- und Wangenstufen konnten nun zur Höhenkontrolle für den Mantel herangezogen werden.
In einem nächsten Schritt gründete man 4 Schichten höher am Anschluss an die beiden Seitentreppen den Mitteltreppenlauf. Da jene Höhe 10 Ziegelschichten unter dem Hofniveau liegt, von dem aus die Mitteltreppe erst angetreten wird, wollte man auf solche Weise den Verbund der Läufe am Zusammenschluss sichern. Jede Ziegellage erforderte für die Seitentreppen 6.800 und für die Mitteltreppe 4.000 Quadratziegel.
Zweieinhalb Jahre setzt Schmid für den Aufbau des Zikkurratmantels und der Treppen bis auf Hofniveau an. Die sieben vortretenden Stufen der Seitentreppen waren anschließend im verfüllten Baugraben verschwunden und der Grundriss der neuen Zikkurrat samt Treppenanlage vollständig angelegt. Bereits knapp eine Million Ziegel waren hergestellt, transportiert und verbaut worden. Aber erst nach einem weiteren Jahr und einem Verbrauch von 400.000 Ziegeln erreichten die Bauarbeiten die Meßbasis. Ab hier erlangte der Mantel seine Planstärke von 30 Ellen bzw. 45 Ziegeln (= 15,25 m). Für die nächsten 10 Schichten behielt er diese Stärke bei und erforderte so 500.000 Ziegel.
Weiter oben war das Kernmassiv abkorrodiert, so dass sich die Stärke des Backsteinmantels innerhalb der nächsten 16 Ziegelschichten auf etwa 18 m oder 54 Ziegel erhöhte. Für diesen Abschnitt lassen sich zwei Jahre und 860.000 Ziegel veranschlagen. Dann war die Höhe erreicht, bis zu der das Kernmassiv von Etemenanki heute noch ansteht und der Backsteinmantel vor seiner Ausraubung im 19. Jahrhundert stand.
Vermutlich war man im 8. Jahr Nabupolassars
Nebukadnezar II.
Schmid mutmaßt, dass gerade diese enorme Herausforderung Nebukadnezars
Nach dem auf der
Auch die zweite Terrasse umhüllte noch die Überreste der alten Zikkurrat und überbaute sie erst mit ihren obersten Ziegellagen. Setzt man die Böschung der Kernmassivflanken wieder mit 80° an, dürfte der Mantel für die zweite Terrassenstufe unten rund 50 Ziegel (= 17,9 m) und oben 62 Ziegel (= 21 m) mächtig gewesen sein. Angesichts 192 Schichten hätte man für jenen Mantelteil annähernd 8 Millionen Ziegel benötigt. Um den alten Zikkurratkörper vollständig zu ummanteln, verbaute Nebukadnezar
Den Bauaufwand für die vier oberen Terrassen samt ihrer mit Holzstämmen bewehrten Überdeckungen berechnet Schmid überschlägig nach den Stufenkörpern ohne Brüstungsmauern mit 5.200.000 Backsteinen und Füllungsziegeln. Für den Hochtempel kalkuliert er rund 300.000 Ziegel. Der gesamte Oberbau der Zikkurrat hätte es demnach auf etwa fünfeinhalb Millionen Ziegel gebracht.
Die Bauzeit für den Oberbau von Etemenanki ist mit Blick auf die technische Kompliziertheit des in sich nicht homogenen Mauerwerks, die gewaltige Höhe des Turms und den aufwendig gebauten, vielräumigen Hochtempel mit 8–10 Jahren zu bemessen. Damit hätte Nebukadnezar in etwa 25 Jahren 22 Millionen Ziegel verbaut und die Zikkurrat seines Vaters vollendet. Insgesamt hätte der Bau nach den Berechnungen Schmids etwa 32 Millionen Ziegel erfordert. Auch wenn dies alles Schätzungen sind, können sie doch die Größenordnung des Bauprojekts und die sich daraus ergebenden Anforderungen an die Baustellen-Logistik deutlich machen. Beim Tod Nebukadnezars
Eine alternative Kalkulation des Arbeits- und Zeitaufwandes bei der Errichtung der spätbabylonischen Zikkurrat von Babylon
Als Ausgangspunkt seiner Erhebungen dient Sauvage J. Vicaris Schätzung ca. 36 Millionen in der Zikkurrat verbauter Ziegel.222 Er gelangt so mittels verschiedener Hypothesen zu einem Ansatz von 7.200 Manntagen für das Formen der Backsteine, 21.600 Manntagen für das Formen der Lehmziegel und 360.000 Manntagen für das Verlegen der Ziegel. Für die Wegstrecke vom Euphratufer, wo die Ziegellieferungen wahrscheinlich eingetroffen sind, bis zur Baustelle setzt er, unter Einbezug des Materialtransports
Vor dem Hintergrund dieser Zahlen vertritt Sauvage die Auffassung, dass die monumentalen mesopotamischen Ziegelbauten weniger große Arbeiterheere erfordert haben als gemeinhin vermutet wird. Er konstatiert aber gleichfalls, dass am Bau der spätbabylonischen Zikkurrat von Sippar
Weiterhin ist Sauvage durchaus bewusst, dass nicht alle Arbeiter unbegrenzt zur Verfügung gestanden haben, da sie abgesehen von ihren Dienstverpflichtungen auf der Baustelle teilweise auch andere Aufgaben erfüllen mussten. Wohl aus jenem Grunde setzten die Bauarbeiten sehr oft nach der Ernte ein, in die das Gros der Bevölkerung eingespannt war. Hinzu kam das Problem der eingeschränkten Verfügbarkeit von Spezialisten, insbesondere qualifizierten Maurermeistern. Die Dauer von Bauprojekten hing somit maßgeblich von der Zahl der jeweils disponiblen Handwerker ab.
Schließlich muss Sauvage einräumen, dass neben den in seine Berechnungen eingeflossenen Tätigkeiten zusätzlich noch eine Reihe weiterer Arbeiten wie etwa die Präparierung des Ziegellehms, die Herstellung des Mörtels, das Brennen der Ziegel, die Beschaffung des Bitumens, die Produktion und Verlegung der Schilfmatten, die Anfertigung und der Transport der Holzanker für die Bewehrung sowie die Aufsicht über den Baufortgang angefallen sind. Er konzediert überdies, in seiner Kalkulation den vorbereitenden Arbeiten auf der Baustelle keinerlei Rechnung getragen zu haben und führt an, dass es bei der Wiederherstellung des Ebabbar von Sippar
Zwar trifft Sauvages generelle Feststellung zu, dass allein das vergleichsweise hohe Tempo der Ziegelbauweise den spätbabylonischen Herrschern überhaupt erst erlaubt hat, in relativ kurzer Zeit eine Vielzahl von monumentalen Neubau- und Restaurierungsprojekten zu realisieren.226 Angesichts Schmids detaillierter Erhebungen muss allerdings gesagt werden, dass Sauvages nicht konsequent zu Ende geführte Kalkulationen nicht ausreichen dürften, um einen zuverlässigen Eindruck des tatsächlichen Arbeits- und Zeitaufwands bei der Errichtung von Etemenanki zu geben. Schon der Vergleich mit der Arbeiterzahl in Sippar
3.6 Materialwissen
3.6.1 Lehm und Ziegelbauweise
Da die Lehmziegelbauten Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Überschwemmungen und Unterspülungen nur bedingt zu trotzen vermochten, bedurften sie ständiger Pflege. Ohne die regelmäßige Erneuerung bzw. Ausbesserung des Wandverputzes und der Dachabdeckungen nach den Winterregen bildeten die Mauern bereits innerhalb kurzer Zeit Risse und stürzten ein. Wie lang die durchschnittliche Lebensdauer der Bauwerke war, lässt sich anhand der Texte nur schwer abschätzen. Die Nutzung von gewöhnlichen Lehmziegelbauten wie etwa ländlichen und städtischen Wohnhäusern dürfte aber nach allgemeiner Erfahrung mit rezenter Lehmziegelarchitektur auch bei Durchführung der erforderlichen Reparaturen einen Zeitraum von ca. 30 bis 60 Jahren kaum überschritten haben. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher und politischer Schwäche müssen darum halbverfallene Bauten und größere Ansammlungen von Lehmziegelschutt das Erscheinungsbild der Siedlungen in starkem Maße geprägt haben.228
Die Popularität der Lehmziegelbauweise
Im Süden bot sich grundsätzlich eher die Bauweise in Lehmziegeln oder terre pisé an. Gegenüber der Bauweise in terre pisé trat das Bauen in vorfabrizierten und standardisierten Lehmziegeln dabei allerdings bereits lange vor dem 4. Jahrtausend v. Chr. immer mehr in den Vordergrund, weil es ein schnelleres und akkurateres Arbeiten zuließ.229
Der bevorzugte Monat für die Ziegelproduktion v. a. bei großen Bauvorhaben war der dritte Monat des Jahres, d. h. die Zeit von Mai bis Juni direkt nach dem Frühjahrsregen. Er wird deshalb auch schon in Texten des 3. Jahrtausends v. Chr. als Monat der Ziegelherstellung erwähnt. Zu jenem Zeitpunkt war ausreichend Wasser vorhanden und die Sonne erlaubte das Trocknen der Ziegel. Auch Stroh und Häcksel waren in der auf die Ernte folgenden Zeit gut verfügbar. Juli und August waren eine günstige Zeit zum Bauen, da die Trockenheit des Bodens das Legen der Fundamente erleichterte.
Die bis ins Neolithikum zurück verfolgbare Bauweise in modelgeformten Lehmziegeln (libn) hat sich im Irak und in Syrien (Abb. 3.1) in nahezu unveränderter Form bis in die heutige Zeit erhalten. Gemeinhin wurden zur Produktion der Ziegel rechteckige hölzerne Modeln verwendet, die oben und unten offen waren. Normalerweise konnten mit einer Form jeweils ein Ziegel, bisweilen aber auch zwei oder drei Ziegel gleichzeitig angefertigt werden. Bei rotbraunen Ziegeln stammt der Lehm zumeist von frischen Böden, bei grauen Ziegeln kommt er aus Siedlungsschutt.
Zur Magerung der Ziegel, die der Verformung und der Bildung von Rissen entgegenwirken sollte, wurde dem Lehm Häcksel bzw. Dung beigemengt. Im Schnitt kamen auf 100 Ziegel etwa 60 kg Stroh. Der Kalkgehalt vieler Lehme im Irak
Die Lehmziegelproduktion erforderte keine speziellen Kenntnisse und Fertigkeiten und konnte von ungelernten Arbeitern durchgeführt werden. In den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts haben die Ausgräber im Dijala-Gebiet
Aufgrund der hohen Kosten für Brennmaterial wurde die Verwendung gebrannter Ziegel sowohl bei Tempel- und Palastbauten als auch im privaten Wohnhausbau auf ein Minimum beschränkt. Im Südirak
Über Ziegelöfen aus dem alten Zweistromland
Instruktiv ist eine von M. Sauvage vorgelegte Tabelle mit keilschriftlichen Belegen für Ziegelpreise aus der Ur III-Zeit, der altbabylonischen Zeit und der neu- bis spätbabylonischen Zeit, d. h. dem späten 3., frühen 2. und der ersten Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr. Aus der Gegenüberstellung ergibt sich, dass in der Ur III-Zeit und der altbabylonischen Zeit Backsteine rund 30 Mal so teuer wie Lehmziegel waren, in der neu- bis spätbabylonischen Zeit hingegen nur noch zwei bis fünf Mal so kostspielig.235
Was die Ziegelformen und -verbände betrifft, so ist schon im 6. und 5. Jahrtausend v. Chr. eine zunehmende Standardisierung der Ziegelmaße bei abnehmender Ziegelgröße zu beobachten. Zugleich entstehen immer ausgefeiltere Ziegelverbände, mit denen auch komplizierte rhythmische Wandgliederungen aus mehrfach abgetreppten Vor- und Rücksprüngen ausgeführt werden konnten (Abb. 3.50).
Backsteine treten, abgesehen von einer Reihe kleiner Modellziegel aus Tepe Gawra
Ein charakteristisches Format der frühgeschichtlichen Zeit stellen weiterhin „plankonvexe“ Ziegel dar. Der Name rührt daher, dass die Ziegel üblicherweise auf der Unterseite flach und auf der Oberseite konvex geformt waren.238 Sie setzen zu Beginn der Periode Frühdynastisch I, d. h. etwa an der Wende vom 4. zum 3. Jahrtausend v. Chr., ein. Ab dem jüngeren Abschnitt von Frühdynastisch III werden sie langsam seltener. Bereits unter Entemena von Lagaš
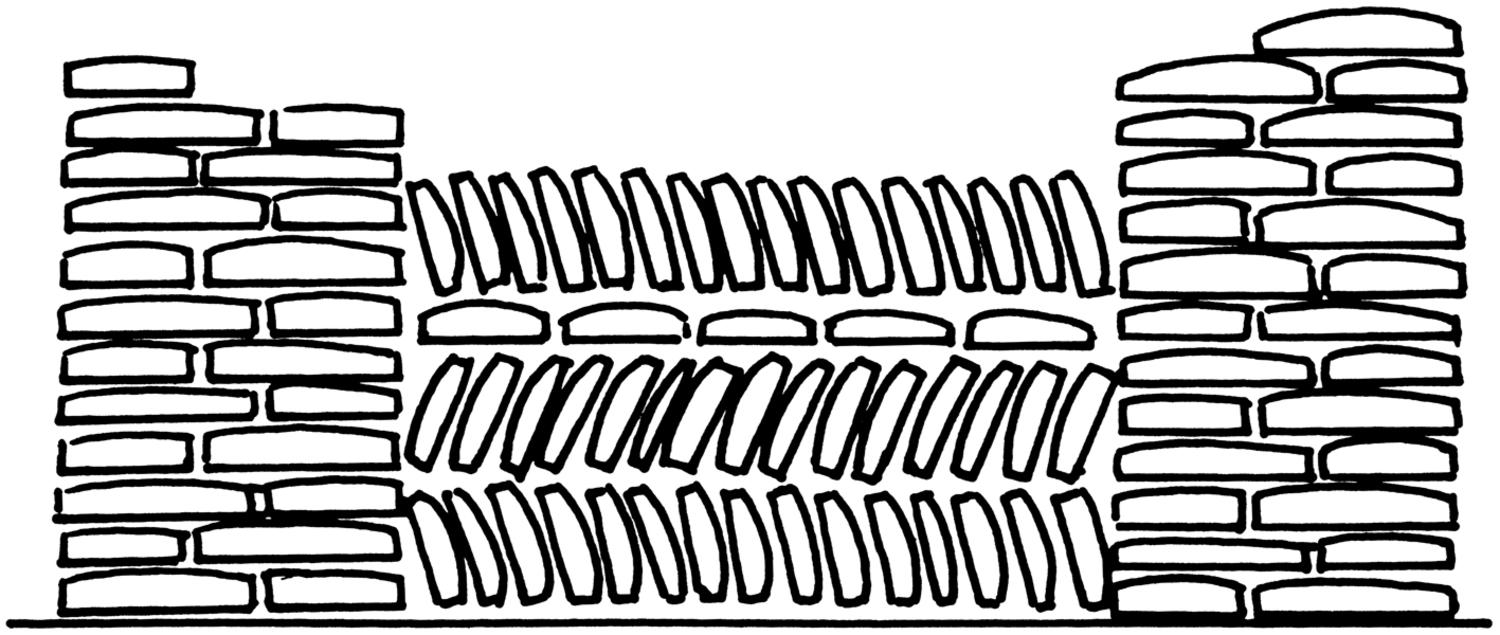
Abb. 3.32: Mauerverbände aus plankonvexen Ziegeln/Frühdynastische Zeit (Nissen 1988, Abb. 37) © University of Chicago Press.
Generell sind die plankonvexen Ziegel größer und unsorgfältiger gearbeitet als die ihnen zeitlich vorangehenden Riemchen. U. U. sind auch nicht alle plankonvexen Ziegel in Modeln geformt worden. Die Ziegelgrößen liegen grob bei 20–30 x 12–20 x 3–6 cm. Eng verbunden mit der plankonvexen Ziegelform ist der Fischgrätverband, in dem die Ziegel jeweils leicht geneigt auf ihren Schmalseiten verlegt werden (Abb. 3.32). Normalerweise erfolgte mit jeder neuen Ziegellage ein Richtungswechsel, der zu der Ausbildung des Fischgrätmusters führte.
Die Ziegel in statisch besonders relevanten Teilen der Wände wie den Ecken und den Bereichen zu beiden Seiten der Türen sind allerdings in der Regel nicht in Fischgrät-, sondern in gewöhnlichen Flachverbänden verlegt worden. H. J. Nissen239 hat in diesem Zusammenhang die Vermutung geäußert, dass das Bauen mit plankonvexen Ziegeln in Fischgrätverbänden den zweifachen Vorteil bot, dass es nicht nur ein schnelleres Verlegen der Ziegel erlaubt hat, sondern im Bereich der Wandfüllungen durchaus auch von ungeschulten Kräften durchgeführt werden konnte. Demnach sei die Bauweise mit plankonvexen Ziegeln, die namentlich für Süd
Im letzten Viertel des 3. Jahrtausends v. Chr. kehrte man wieder zu regulären Flachziegeln zurück, vielleicht auch weil durch die zeitsparende Bauweise mit plankonvexen Ziegeln und in Fischgrätverbänden die Qualität der Baukonstruktionen gelitten hatte. Möglicherweise aufgrund staatlicher Initiativen zur Vereinheitlichung der Maßsysteme und Verbesserung der Baustellenorganisation blieben die Ziegelformen und -größen von nun an bis ins späte 2. Jahrtausend v. Chr. mehr oder weniger standardisiert. Prinzipiell ist bei den auftretenden Formaten zwischen Quadratziegeln (Abb. 3.15), die in Nordmesopotamien
Die Verwendung von Backsteinen an öffentlichen Gebäuden nahm während der Ur III-Zeit (spätes 22.–21. Jh. v. Chr.) zu, als sie nicht selten zur Wandverkleidung benutzt wurden. In der altbabylonischen Zeit ist ein vermehrter Gebrauch von gebrannten Ziegeln gelegentlich auch in der gehobenen Privatarchitektur zu beobachten, so bspw. in Larsa
Für spezielle Zwecke angefertigte Formziegel von z. B. dreieckiger oder halbrunder Gestalt sind verstärkt seit dem späten 3. Jahrtausend v. Chr. bekannt, wo sie u. a. an den „Piliers de Goudea“ in Girsu

Abb. 3.33: Formziegelfries mit wasserspendenden Gottheiten am Inanna-Tempel des Karaindaš in Uruk
Eine chronologische Abfolge lässt sich für Inschriftziegel aus öffentlichen Gebäuden herstellen, die von Herrschern der ausgehenden frühdynastischen bis zur spätbabylonischen Zeit vorliegen. Die Inschriften wurden z. T. individuell angebracht, oft jedoch auch gestempelt. Als Inschriftträger hat man bevorzugt quadratische Ziegel verwendet.243
Mit der altorientalischen Lehmziegelbauweise verbinden sich unterschiedliche Formen des Wanddekors, von denen einige bereits im Kontext der Bauplanung angesprochen worden sind. Die Dekore waren überwiegend sehr arbeitsintensiv und konnten entweder plastisch oder in Gestalt von farbigen Verputzen und Wandmalereien ausgeführt sein. Da letztere sich häufig nur noch in geringen Resten erhalten haben, wird der weitverbreitete Gebrauch von Farben in der mesopotamischen Architektur heute oft unterschätzt.
In der späten Urukzeit war über große Teile Mesopotamiens
Aus dem frühen 2. Jahrtausend v. Chr. liegen aus mehreren Orten Süd
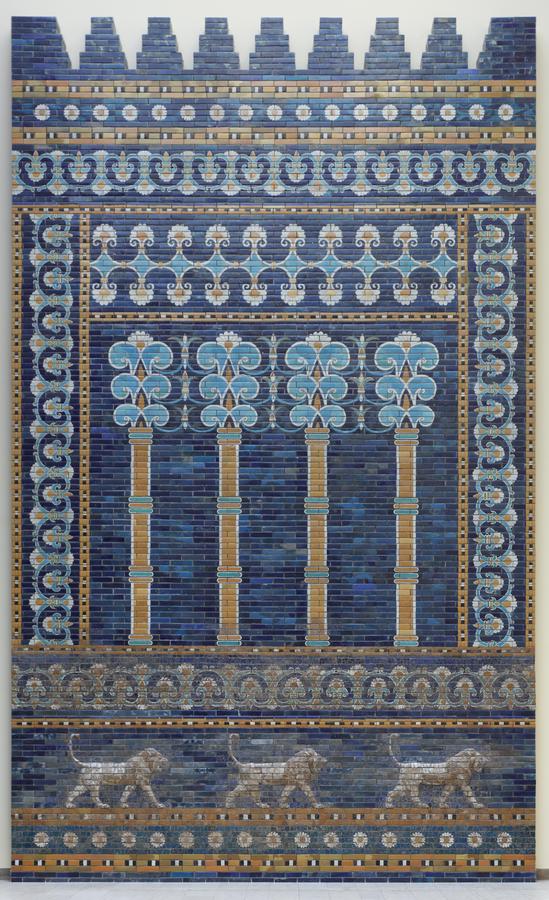
Abb. 3.34: Rekonstruktion der Außenwand aus Glasurziegeln vom Thronsaal Nebukadnezars II.
Anthropomorphe Friese aus gebrannten Formziegeln sind erstmals aus kassitischer Zeit bezeugt. Das bekannteste Beispiel bildet eine Darstellung Wasser und damit Fruchtbarkeit spendender Gottheiten im unteren Teil der Wände eines im 15. Jahrhundert v. Chr. von Karaindaš errichteten Tempels der Ištar in Uruk
Die Verwendung glasierter Ziegel zur Herstellung polychromer Wandfriese ist textlich für die mittelassyrische und durch Grabungsbefunde ab der neuassyrischen Zeit, genauer seit dem 9. Jahrhundert v. Chr., belegt. Zahlreiche Beispiele lassen sich insbesondere für Kalhu
Der Produktionsprozess der Friese war äußerst komplex. Für den Auftrag des Farbdekors mussten die Ziegel zunächst entsprechend ihrer späteren Anbringung im Fries ausgelegt werden. Vorzeichnungen auf den Sichtflächen signalisierten den Ziegelarbeitern, in welcher Weise die unterschiedlichen Pigmente
Die berühmtesten Beispiele altorientalischer Schmelzziegelreliefs stammen aus Babylon. Mit Hilfe der unzähligen dort gefundenen Glasurziegelfragmente aus spätbabylonischer Zeit konnten großformatige Rekonstruktionen der farbigen Ziegeldekorationen des Ištar-Tors, der Prozessionsstraße und der Hoffassade des Thronsaals in der sog. „Südburg“ (Abb. 3.34) angefertigt werden. Ebenso wie verschiedene Assyrerkönige erwähnt auch Nebukadnezar II. (604–562 v. Chr.) die Schmelzziegeldekore explizit in seinen Bauinschriften.
Im Gegensatz zu den assyrischen Friesen, die eher Wandmalereien ähneln, zeigen die babylonischen Darstellungen ein markantes Relief. Die häufige Wiederkehr einer vergleichsweise geringen Zahl von Motiven deutet dabei auf eine Massenproduktion. Vermutlich wurden für jedes Einzelmotiv ausgehend von einer originären Reliefvorlage eine Vielzahl von Ziegelformen angefertigt, mit deren Hilfe die Schmelzziegel schnell und in großer Stückzahl hergestellt werden konnten. Um einen kompletten Fugenschluss zu erreichen, waren die Sichtflächen der Ziegel stets etwas breiter als die Rückseiten, was den Ziegeln eine leicht keilförmige Gestalt verlieh. Als Glasurfarben hat man in Babylon
In Babylonien
Dem Schutz der Mauern gegen Feuchtigkeit und andere Witterungseinflüsse dienten vielfältige Verputze auf
Weitverbreitet zu allen Zeiten waren v. a. Verputze und Mörtel aus Lehm
Was die Lehmverputze anbetrifft, so kann man aus Beobachtungen an rezenter Lehmziegelarchitektur ableiten, dass im Regelfall zwei Putzschichten aufgetragen worden sein dürften. Zunächst eine dickere mit organischen Anteilen und einem höheren Lehmgehalt sowie anschließend eine feinere und dünnere. Häufig hat man den Lehmverputzen
Gips- und Kalkverputze lassen sich mit bloßem Auge nicht unterscheiden. Insofern können über die quantitative Verteilung der beiden Verputzarten im altorientalischen Bauwesen keine gesicherten Aussagen getroffen werden. Da
Die Herstellung von Kalkverputz
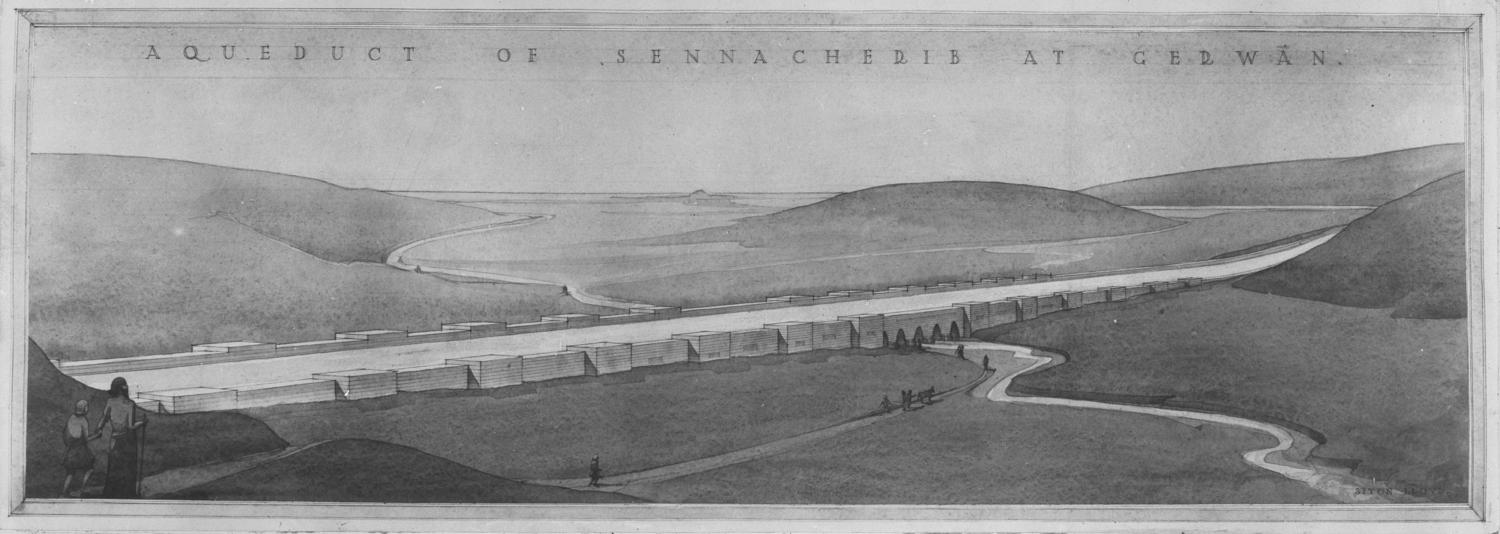
Abb. 3.35: Rekonstruktion des unter Sanherib
Mit Ausnahme von Tünche, die auch im Wohnhausbau gut bezeugt ist, begegnen
Unter den wenigen bekannten Beispielen einer Anbringung von Kalkverputzen ist an erster Stelle die neu geschaffene Residenzstadt Sargons II.
Der besonders dauerhafte
3.6.2 Bitumen
Vornehmlich in das späte 3. und frühe 2. Jahrtausend v. Chr. datierende Texte schildern den Transport von Bitumen in
Da
Eine deutliche Zunahme der Verwendung von
3.6.3 Stein und Steinbauweise
Abgesehen von Ausnahmen kam Stein im mesopotamischen Bauwesen der altorientalischen Zeit lediglich eine zweitrangige Bedeutung zu. Von einer Steinarchitektur im engeren Sinne lässt sich deshalb nicht sprechen, auch nicht in Assyrien
Entgegen einer verbreiteten Auffassung gab es indes nicht nur in Nordmesopotamien
Die eindrucksvollsten Zeugnisse urukzeitlicher Steinbauweise stammen aus Uruk selbst. Der Steinstifttempel aus der Archaischen Schicht VI/V des Eannabezirks hat möglicherweise einem Wasserkult gedient. Sein Fundament besteht aus grob behauenen Kalksteinblöcken, das aufgehende Mauerwerk aus einem unter Zusatz von Ziegelsplit angemachten Gipsbeton. Die nahezu vollständig ausgeraubten, wohl unter Zuhilfenahme hölzerner Schalungen errichteten Wände hat man mit einem Mosaikdekor aus Steinstiften in den Farben rosa bzw. rot (Kalk- oder Sandstein), weiß (Alabaster oder
Der monumentale sog. „Kalksteintempel“ der Archaischen Schicht V des Eannabezirks misst im Grundriss rund 30 x 76 oder mehr Meter. Er ist mit einem Sockel aus unregelmäßig geformten, an den Mauerkanten jedoch sehr exakt verlegten Kalksteinplatten versehen worden. Von dem Sockel hatten sich nur noch wenige Steinlagen erhalten. Die oberen Teile des Gebäudes waren wahrscheinlich in Lehmziegelmauerwerk ausgeführt.253

Abb. 3.36: „Steingebäude“ im Anubezirk von Uruk
In dem gleichfalls urukzeitlichen „Steingebäude“ am Fuß der Anu-Zikkurrat von Uruk
Die Anlage, deren Wände eine Höhe von 3,2–3,4 m aufwiesen, ist in eine tiefe Baugrube gesetzt worden. Nach Abschluss der Bauarbeiten dürfte sie mit Ausnahme eines im Nordosten zu rekonstruierenden Dromos für einen Betrachter nicht mehr sichtbar gewesen sein. Entsprechend blieben die aus grob behauenen Blöcken bestehenden Außenwände rau. Die Innenwände des Steingebäudes sind dagegen sämtlich verputzt worden.254
Auch an anderen Orten Südmesopotamiens
Erst in den Bauprogrammen der spätbabylonischen Herrscher begegnen Steine in Babylonien
Im mineralreichen Assyrien
Angesichts dieser Ausgangsbedingungen erstaunt es, dass der Steinbauweise in Nordmesopotamien
Ein vielfältigerer Einsatz von Stein als Baumaterial ist erst während des 2. Jahrtausends v. Chr. in der alt- und mittelassyrischen Architektur Assurs
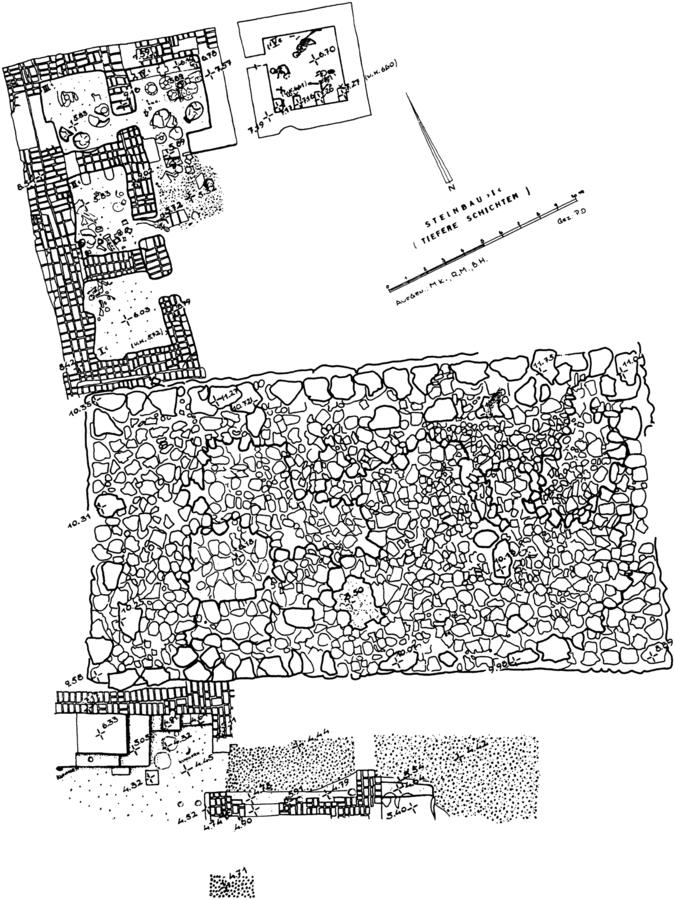
Abb. 3.37: Terrasse des Steinbaus I und ebenerdige Anbauten der tieferen Schichten in Tell Chuera
Weitere Veränderungen brachte die neuassyrische Zeit. Der Bau des Nordwestpalastes Assurnasirpals II.
Schließlich kam es im 8. Jahrhundert v. Chr. im öffentlichen Bauwesen zu einer signifikanten Zunahme qualitativ hochstehender Werksteinarchitektur. Besonders gut zu sehen ist dies in Dur-Šarrukin
Viele neuassyrische Inschriften bekunden die Verwendung von Stein in den großen königlichen Bauprojekten. Zu den lokalen Gesteinen traten dabei auch solche aus Kriegsbeute und Tributlieferungen. Die zahlreichen in den Texten gebrauchten Termini bezeichnen die unterschiedlichen Steinarten vornehmlich anhand ihrer Farbe (weiß/hell, rot/rötlich oder schwarz/dunkel), wobei Farbnuancen üblicherweise metaphorisch umschrieben wurden. Aus den Quellen geht klar hervor, dass eine gezielte Auswahl der Bausteine getroffen wurde, doch ist es vielfach nicht leicht, die assyrischen Benennungen mit spezifischen Gesteinsarten zu verbinden, v. a. dort, wo es sich um kalziumhaltiges
Im archäologischen Befund Assyriens
Das eindrucksvollste assyrische Beispiel für Kalksteinmauerwerk bildet indes das unter Sanherib angelegte Hinis-Kanalsystem, mit dessen Hilfe über eine Distanz von etwa 80 km Frischwasser von Bavian
Einen weiteren monumentalen Ingenieurbau aus der Zeit Sanheribs repräsentieren neben dem Aquädukt von Ğerwan
Der in der Region von Ninive
Basalt schließlich, der u. a. in den kurdischen Bergen anstand, ist als Baumaterial z. B. in den mittel- und neuassyrischen Königsgräbern des Alten Palasts von Assur
Über die Organisation der Arbeit in den Steinbrüchen sind wir bloß punktuell informiert. Hinweise auf die in der Umgebung von Ninive
Lässt man einmal die periodischen, militärisch flankierten Expeditionen altorientalischer Herrscher zur Steinbeschaffung außer Betracht, ist unbekannt, inwieweit der Zugang zu den Steinbrüchen beschränkt war und ob der Abbau der Gesteine kontinuierlich oder immer nur über bestimmte Zeiträume erfolgt ist. Das gilt gleichermaßen für die neuassyrische Zeit wie für andere Epochen der altorientalischen Geschichte. Auch sind die ökonomischen Austauschsysteme, in die die an der Peripherie Mesopotamiens
3.6.4 Holz
Oft haben sich von den Hölzern im Grabungsbefund aufgrund der Vergänglichkeit des Materials bloß wenige oder gar keine Spuren erhalten. Zudem war
In den Schriftquellen wie bspw. der Inschrift auf der Statue B des Gudea
Bevorzugt erfolgte der mühevolle Transport der Importhölzer auf dem Wasserweg (Abb. 3.29). Insbesondere aus neuassyrischer Zeit liegen Text- und Bildquellen vor, die die
Über die Zimmermannswerkzeuge auf den Baustellen ist nicht viel bekannt. Auf der Stele des Ur III-zeitlichen Herrschers Urnammu
Anders als in der öffentlichen Architektur wurden im privaten Wohnhausbau normalerweise nur lokal vorhandene Hölzer verwendet. In Südmesopotamien
3.6.5 Schilf und Schilfbauweise
Mattenabdrücke aus Grabungen zeigen, dass sich die Herstellungsweise von Schilfmatten über die Jahrtausende kaum gewandelt hat. Generell sind archäologische Zeugnisse des ephemeren Materials aber eher rar. Immerhin gibt es aus einer Reihe prähistorischer Fundorte Südmesopotamiens

Abb. 3.38: Schilfrohrlage und Doppeltau aus gedrehtem Schilf im Lehmziegelmassiv der Zikkurrat des Urnammu im Eannabezirk von Uruk
Aufgrund seiner Zugfestigkeit wurde Schilf auch als Anker und Binder in Lehmziegelstrukturen integriert, meist in Form von Matten oder dünnen Rohrlagen. Die Technik ist bereits in der frühdynastischen Zeit nachweisbar, fand im 2. Jahrtausend v. Chr. immer weitere Verbreitung und war schließlich in der öffentlichen Architektur der neuassyrischen und spätbabylonischen Zeit gängige Praxis. An den Mauern der Prozessionsstraße und des Ištartors im spätbabylonischen Babylon
In großen Mengen kam Schilf ebenfalls bei der Errichtung der gewaltigen Ziegelmassive der Stufentürme zum Einsatz. So befanden sich zwischen den Lehmziegellagen der Ur III-zeitlichen, ins späte 3. Jahrtausend v. Chr. datierenden Zikkurrat des Eannabezirks von Uruk
Ein sehr ähnliches Schema von Bewehrungen aus Schilf ist für die kassitische Zikkurrat von Dur Kurigalzu
3.7 Bautechniken
3.7.1 Gewölbebau
Neben den in Kragtechnik errichteten falschen Gewölben
Liegende Ringschichtengewölbe
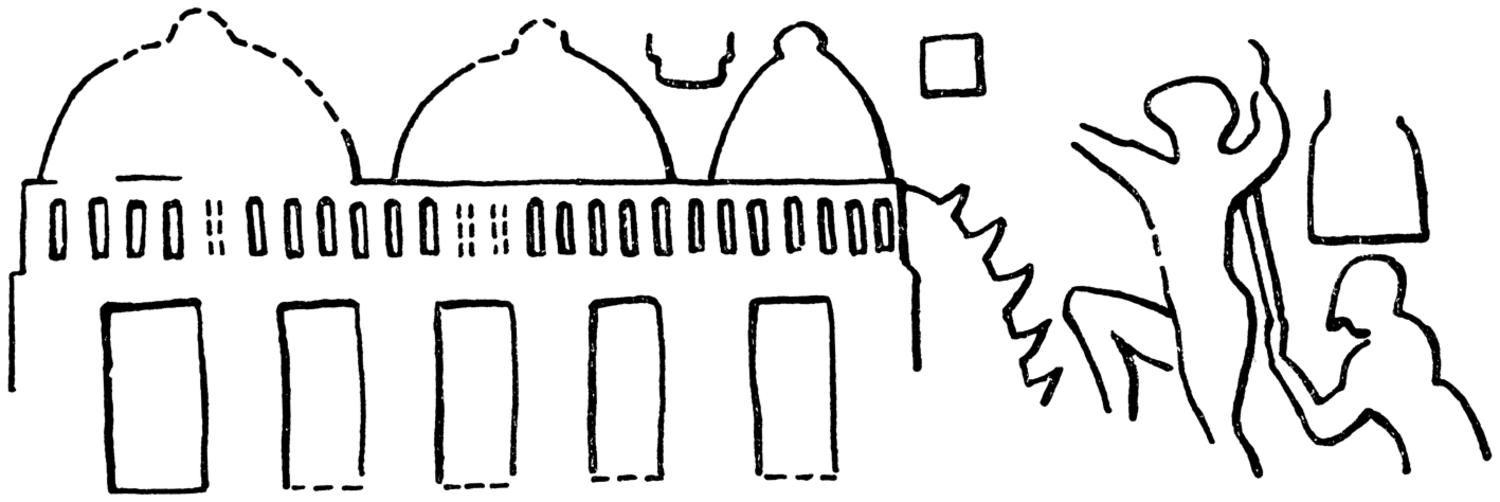
Abb. 3.39: Siegelabrollung mit Darstellung überkuppelter Vorratsspeicher aus Susa
Bezeugte Gewölbeformen sind im frühen Mesopotamien
Gräber zeigen bisweilen ebenfalls eine Überdeckung mit Kuppeln. So war in dem aus Kalksteinblöcken errichteten Grab PG/779 im frühdynastischen Königsfriedhof von Ur

Abb. 3.40: Kraggewölbe in Grabanlage der Ur III-Könige in Ur
Neben den Kuppelgewölben sind auch tonnen- und muldenförmige Gewölbe in Mesopotamien
Auch Gräber sind ab der frühdynastischen Zeit gelegentlich mit Tonnengewölben oder auch Mulden mit wangenartigen Schmalseiten überdeckt worden. So weist das schon erwähnte Grab PG/779 in Ur

Abb. 3.41: Radialgewölbe im Bâtiment 33 von Larsa
Außer Kraggewölben sind im frühen 3. Jahrtausend v. Chr. an Kanälen und Grüften auch echte Gewölbe belegt. Sie konnten z. B. an der Entwässerungsanlage des älterfrühdynastischen Tempelovals I von Hafaği
Seit der frühdynastischen Zeit treten echte Gewölbe

Abb. 3.42: Kraggewölbe im Round Building von Tell Razuk
Weitere oberirdische
Zur Errichtung der Gewölbe
In dem auf das Dach führenden, etwas über 1 m breiten Treppenhaus des Round Building konnte ein ansteigendes einhüftiges Kraggewölbe festgestellt werden. Am Treppenfuß maß die Gewölbehöhe 2,12 m, auf halbem Lauf hingegen nur noch 1,83 m. Sofern die gesamte Treppe überwölbt gewesen sollte, was wahrscheinlich ist, lässt sich für den Ausgang zum Dach eine
Berechnungen der im Gewölbebereich wirksamen Kräfte haben ergeben, dass diese nur einen Bruchteil der tatsächlichen Belastbarkeit der Mauern ausgemacht haben. Die Berechnungen basieren auf den Ergebnissen von petrographischen Analysen, Röntgendiffraktionsanalysen und Druckbelastungstests, nach denen die Ziegel des Round Building einem durchschnittlichen Druck von ca. 22,5 kg pro cm3 standhalten konnten.
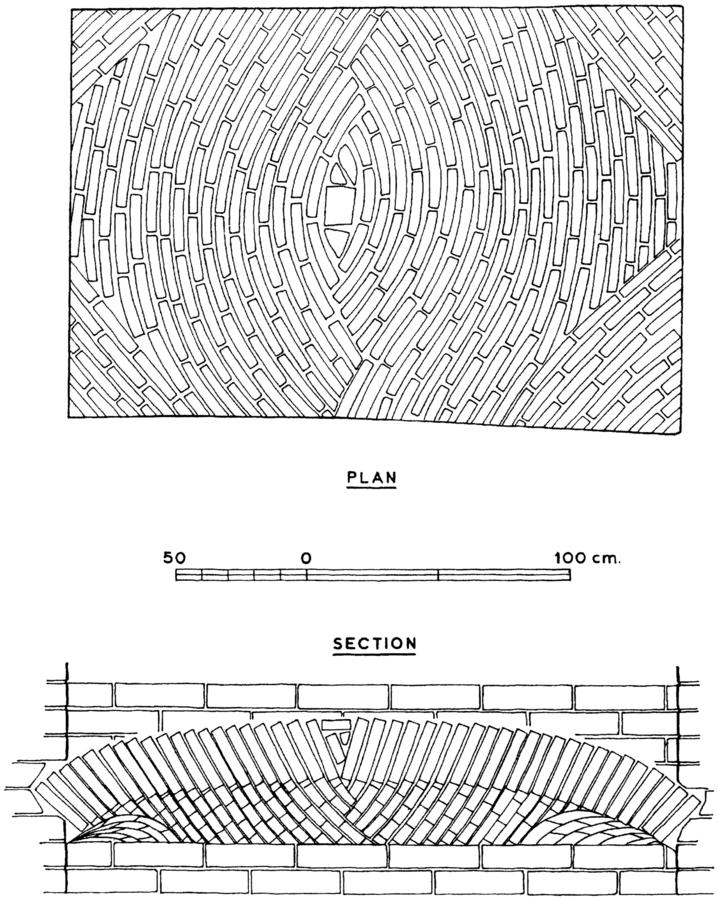
Abb. 3.43: Ringschichtengewölbe im Substruktionsmauerwerk am Südhang (Bereich AS) von Tell Rimah
Der außergewöhnliche Festigkeitsgrad des Baumaterials resultiert aus der mineralogischen Zusammensetzung der Ziegel, die durch einen hohen Anteil von
Ein weiteres Beispiel für frühe Kraggewölbkonstruktionen aus dem Hamrin-Gebiet
Der Rundbau von Tell Gubba
McG. Gibson erkannte in der Architektur des Hamrin-Gebiets
Eine Bestätigung haben Gibsons Thesen in der Zwischenzeit zudem durch die Aufdeckung einer größeren Anzahl oberirdischer Kraggewölbe an frühbronzezeitlichen, aus dem 3. Jahrtausend v. Chr. stammenden Bauten namentlich des Habur-Gebiets
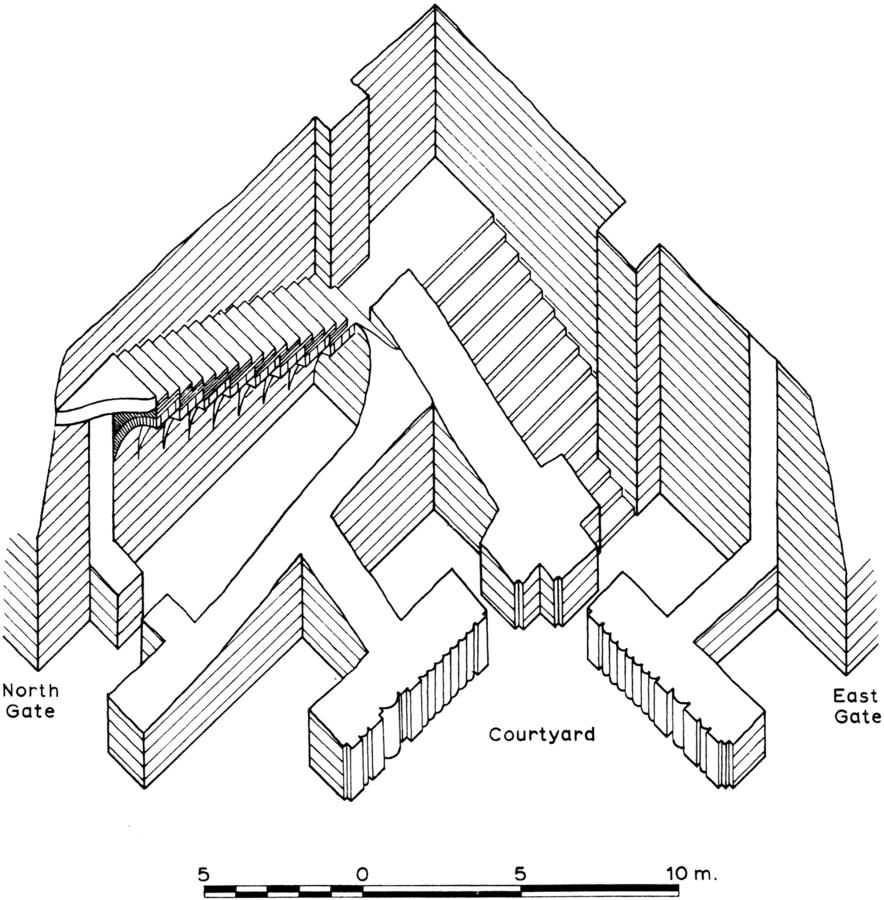
Abb. 3.44: Ansteigendes Radialgewölbe unter einer Treppe im Tempel von Tell Rimah
Die Antriebe zur Errichtung von Gewölben im Mesopotamien
Sicher ist das vergleichsweise häufige Auftreten von Wölbkonstruktionen in Zentral- und Nordmesopotamien
Ein unterschiedlicher Stellenwert des Gewölbebaus im Norden und Süden ist nicht nur im 3., sondern auch im 2. Jahrtausend v. Chr. erkennbar. So finden sich im privaten Wohnhausbau der südmesopotamischen Städte für die altbabylonische Zeit keine Belege oberirdischer Wölbkonstruktionen. Im Norden hingegen ist aus der ersten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr. eine größere Anzahl in Lehmziegeltechnik errichteter Tonnengewölbe
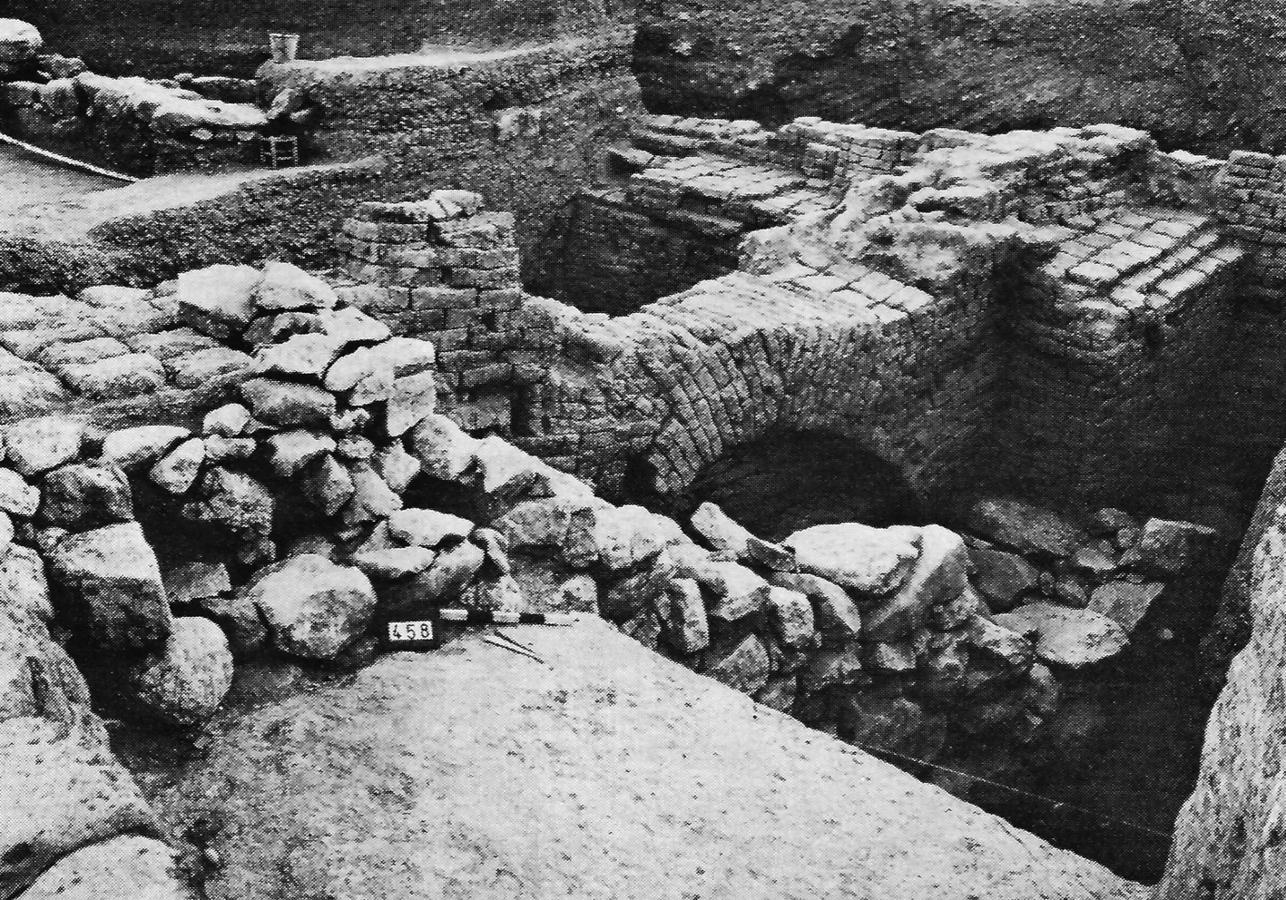
Abb. 3.45: Radialgewölbe am Nordost-Tor der Außenstadt von Tell Munbaqa
In Šaġir Bazar
Am altassyrischen Tempel von Tell Rimah
Zugleich hat man in Grüften des Ur-III-zeitlichen und altassyrischen Assur
Dass Ringschichtengewölbe
Seit dem 2. Jahrtausend v. Chr. begegnen Gewölbe ebenfalls an großen Durchgängen v. a. von Stadttoren.296 Belege kommen hier anders als bei den eingewölbten oberirdischen Räumen sowohl aus dem Norden wie aus dem Süden. So sind überwölbte Stadttore auf altbabylonischen Terrakottareliefs etwa aus Larsa
Dass auch im 1. Jahrtausend v. Chr. oberirdische Räume nordmesopotamischer Privathäuser bisweilen überwölbt worden sind, lässt sich an Häusern mit Lehmziegelgewölben aus Kalhu
Andere, an verschiedenen Stellen in Dur-Katlimmu
Die Überdeckung oberirdischer Räume zunächst mit Krag- und später echten Gewölben scheint also in Nordmesopotamien zwischen dem 3. und 1. Jahrtausend v. Chr. recht verbreitet gewesen zu sein. Hierbei haben möglicherweise lokale Bautraditionen, wie sie auch heute noch in der Ğazira
Grundsätzlich ist die vor rund 40 Jahren getroffene Feststellung E. Heinrichs, dass in altorientalischer Zeit lediglich baupraktische Gründe (wie eine besonders starke Belastung der Deckenkonstruktion) und Holzmangel zur Überwölbung von Räumen geführt hätten und die Geschichte des Gewölbebaus als architektonisches Ausdrucksmittel im Zweistromland
In Südmesopotamien
3.7.2 Spezieller Ingenieurbau
Der spezielle Ingenieurbau ist für Mesopotamien bislang kaum näher untersucht worden. Daher lässt der Forschungsstand gegenwärtig eine angemessene Würdigung der mesopotamischen Ingenieurleistungen in ihrer gesamten Breite nicht zu.306 Eine Ausnahme bildet bloß der Bereich des assyrischen Wasserbaus, zu dem eine umfassende Studie von A. M. Bagg erschienen ist.307
Im regenarmen Zweistromland hat der Wasserbau bereits sehr früh eine eminente wirtschaftliche und politische Bedeutung erlangt. Zeitweilig hat man in den gewaltigen Anstrengungen bei der künstlichen Bewässerung sogar einen entscheidenden Auslöser der Staatsentstehung und Hochkulturentwicklung in Mesopotamien
In Assyrien ergänzte die Bewässerungswirtschaft den vorherrschenden Regenfeldbau. Die landwirtschaftlichen Wasserbauten der Assyrer, über die wir durch schriftliche und archäologische Zeugnisse aus mittel- und neuassyrischer Zeit, namentlich Königsinschriften und Palastreliefs, unterrichtet sind, entstanden zumeist in Verbindung mit neuen Hauptstädten wie Kar-Tukulti-Ninurta
Da eine Ableitung von Tigriswasser aufgrund des Höhenunterschieds und der Schwankungen im Wasserstand schwierig und bisweilen sogar unmöglich war, hat man das Wasser aus anderen Flüssen und Gebirgsbächen über relativ große Distanzen durch Hauptkanäle in die verschiedenen Städte und umliegenden Felder geleitet. Bagg definiert die assyrischen Wasserbauten vor diesem Hintergrund als Ingenieurbauten mit dezidiert wasserwirtschaftlicher Zielsetzung. Auch wenn wir über die
Im Anschluss an die Entscheidung, ein Gebiet künstlich zu bewässern, musste als erstes der Wasserbedarf bestimmt werden. Hierzu waren im Prinzip jeweils sehr weitreichende und differenzierte Überlegungen und Erhebungen zu folgenden Punkten erforderlich:
Umfang der zu ernährenden Bevölkerung und durchschnittlicher Verbrauch
Vorhandenes Ackerland
Landwirtschaftliche Erträge mit und ohne Bewässerung
Klimatische Bedingungen: Verteilung der Niederschläge, Niederschlagsmenge, Temperaturverteilung (Verdunstungsrate)
Hydrologische Bedingungen: Gewässerregime, intermittierende Wasserläufe, Einzugsgebiete, Abflußmenge
Bodenbedingungen: Permeabilität, Infiltrationsrate.311
Den Verbrauch der Pflanzen sowie Verluste durch Versickerung, Verdunstung und weiterlaufendes überschüssiges Wasser galt es im Vorhinein abzuschätzen, um davon ausgehend den Wasserbedarf zu errechnen. Über diese erste Planungsphase der verschiedenen überlieferten Bauprojekte geben die von Bagg primär herangezogenen schriftlichen Quellen allerdings keinerlei Auskunft. Man weiß von daher nicht genau, in welcher Weise die Ingenieure ihre Aufgabe angegangen sind und welche der genannten Faktoren sie im Einzelnen berücksichtigt haben. Die notwendigen Eckdaten für eine annähernde Berechnung des Wasserbedarfs dürften aber empirisch gewonnen worden sein.312
Besser als über die Planung der Projekte und die einzelnen Schritte des Entwurfsprozesses sind wir über die gebauten Objekte und ihren Betrieb sowie ihre Instandhaltung unterrichtet. Da das Wasser jeweils von der Wasserentnahmestelle, dem sog. Fassungsort, bis zur Nutzungsstelle geleitet und anschließend ggf. auch wieder entsorgt werden musste, setzen sich die landwirtschaftlichen Wasserbauten der Assyrer grundsätzlich aus einer Reihe wiederkehrender Bestandteile zusammen: Fassung, Zuleitung, fakultative Speicher, eigentliche Bewässerungsanlagen, Ableitung und Rückführung.313
Bei den Wasserentnahmestellen können Quellfassungen, über die in den Texten nur wenige Angaben vorliegen, von Bach- und Flußwasserfassungen unterschieden werden. An letzteren dienten oft rechtwinklig oder schief zum Fluss angelegte Stauwehre dazu, die fassbaren Zuflüsse in die Wasserentnahmestelle einzuleiten.
Drei assyrische Fassungswerke sind bekannt und archäologisch erforscht worden. Es handelt sich hierbei um die Fassung des Patti-ḫegalli, also des „Kanals des Überflusses“, Assurnasirpals II.
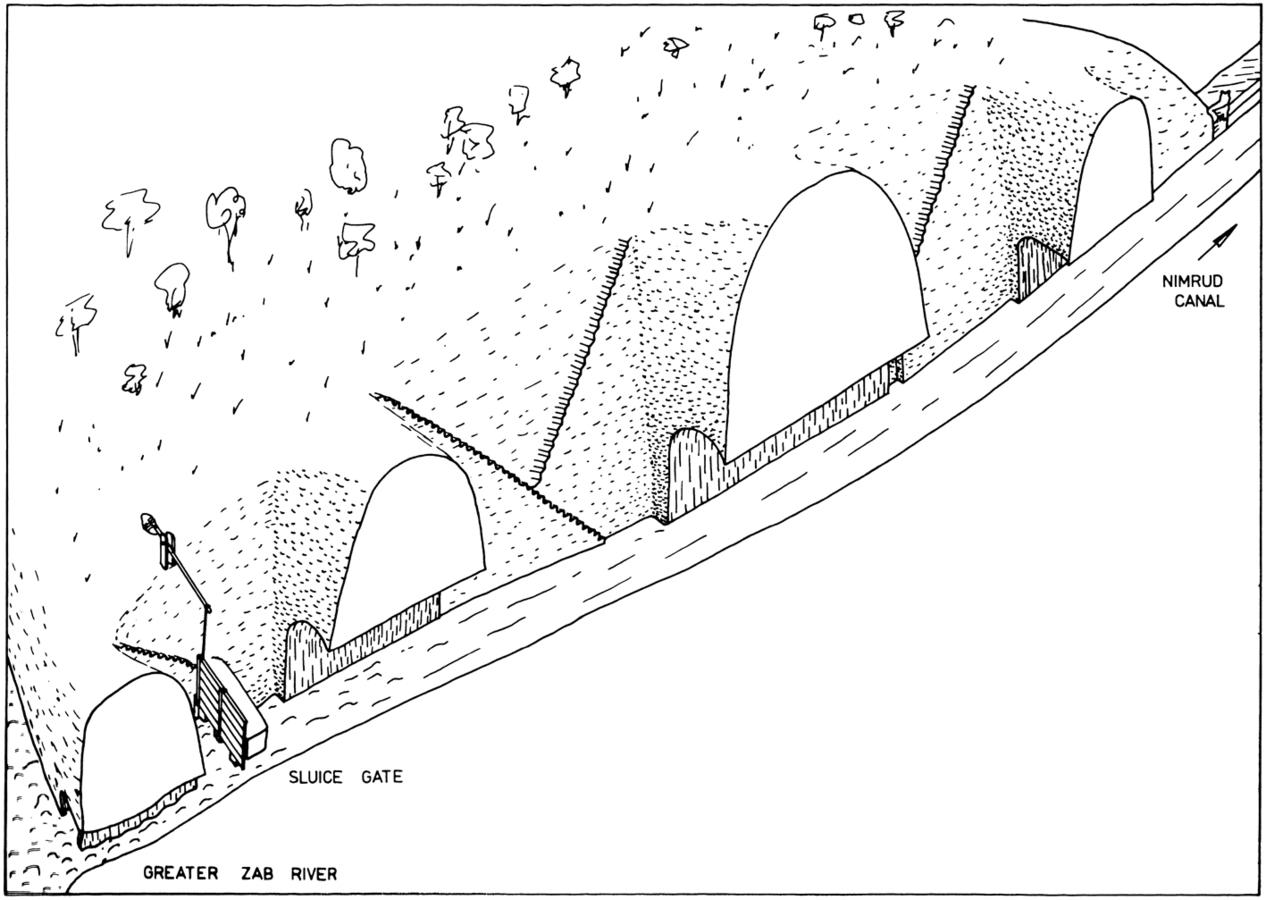
Abb. 3.46: Isometrie des Nagub-Tunnels Asarhaddons am oberen Zab
In allen drei Fällen spielten Tunnelstrecken einen wichtigen Part. So wurde der Patti-ḫegalli, zumindest während einer zweiten Nutzungsphase, durch den unter Asarhaddon
Die drei Tunnel bilden herausragende Leistungen der assyrischen Wasserbauingeniere. Der Tunnelabschnitt am Kanalkopf bei Hinis
Vertikale Nuten und Bohrungen an allen drei Tunneleingängen haben mit größter Wahrscheinlichkeit dazu gedient, Regulierorgane wie Hubschützen aus Holz aufzunehmen. Dass den Assyrern das Betriebsprinzip von Hubschützen geläufig war, bezeugen die Orthostatenreliefs Assurbanipals
Stauwehre hatten sich an keiner der drei Wasserentnahmestellen erhalten. Im Falle des Patti-ḫegalli war kein Stauwehr erforderlich, da der Eingang des Nagub-Tunnels direkt gegen die Strömung lag, teilweise unterhalb des Wasserspiegels des Flusses. Bei Hinis
Ein Problem bei der Errichtung von Fassungen, mit dem auch die Assyrer zu kämpfen hatten, bildet die Abweisung von Geschwemmsel und Geschiebe. Hiervon zeugt am Patti-ḫegalli ein offenbar älterer, gänzlich zusedimentierter Tunnel neben dem Nagub-Tunnel. Aber auch im Nagub-Tunnel betrug die Höhe der Ablagerungen immer noch etwa 1,5 m. Spülkanäle oder Absetzbecken sind für die assyrischen Wasserbauten weder archäologisch noch inschriftlich nachweisbar. Belegt ist demgegenüber in einem Brief Assurbanipals
Über Wasserleitungen wurde das Wasser von der Entnahmestelle zur Nutzungsstelle geführt. In den assyrischen Königsinschriften werden zumeist nur die zur Bewässerungsfläche führenden Hauptzuleiterkanäle und nicht die Vielzahl untergeordneter Kanäle erwähnt. Die Wasserleitungen stellten im Regelfall offene Kanäle dar, in denen das Wasser im Freilauf floss.
Bei der Trassierung wird man gewiss wirtschaftlichen Lösungen den Vorzug gegeben haben, doch stieß man zuweilen auf natürliche Hindernisse. So zwang beim Bau der Trasse des Hinis-Hosr-Kanals
Ein weiterer Äquädukt ist auf einem der Orthostatenreliefs aus dem Nordpalast Assurbanipals
Speicher fungieren im Rahmen von Bewässerungsvorrichtungen als Ausgleich zwischen Wasserangebot und -bedarf. Sie werden gebraucht, wenn die Abflüsse gegenüber den Zuflüssen überwiegen. In den Texten finden sich bislang allerdings keine Hinweise auf Speicher in den assyrischen Wasserbauten, abgesehen von einem Kaufvertrag aus mittelassyrischer Zeit mit der singulären Erwähnung eines Wasserreservoirs an einem im Habur-Gebiet
Künstliche Reservoire können mittels Wehren oder Talsperren errichtet werden. Nach ihrem Konstruktionsmaterial lassen sich Staumauern aus Mauerwerk und Staudämme aus Lockergestein (Erddämme respektive Steindämme) unterscheiden. Aus dem urartäischen Gebiet kennt man verschiedene Talsperren und es ist zu vermuten, dass die Assyrer sie gesehen haben. Die Funktion mehrerer in der Umgebung von Ninive
Neben den Primärkanälen umfassten die landwirtschaftlichen Bewässerungssysteme Assyriens
Um die Kulturpflanzen vor schädlicher Bodennässe zu bewahren, war es notwendig, das überschüssige Wasser aus dem bewässerten Ackerland abzuleiten. Durch die Schriftquellen beurkundet ist eine solche Ableitung nur in einem einzigen Fall. Sanherib hat den Wasserlauf des Kisiri-Kanals verlangsamt, indem er einen künstlichen Sumpf mit einem Naturreservat geschaffen hat. Die Rückführung nicht verbrauchten Wassers dürfte in Ninive
Der Höhenunterschied zwischen Wasserspiegel und Nutzungsfläche wurde mit Hilfe von Wasserschöpfvorrichtungen überwunden. Eindeutige Angaben über die Wasserschöpfgeräte im alten Mesoptamien
Was die Instandhaltung der Bewässerungsanlagen betrifft, so finden sich in den assyrischen Texten keinerlei Hinweise auf regelmäßige Wartungsarbeiten im Sinne einer Reinigung oder eines Ausbaggerns der Kanäle, also Arbeiten, die in Südmesopotamien
In drei Fällen werden verfallene Kanalbauten angesprochen. Weiterhin heißt es in einer Inschrift, dass sich – offenbar aufgrund einer Fehlberechnung oder baulicher Mängel – das Einlaufbauwerk des Hosr-Hinis-Kanals an der Wasserentnahmestelle bei Hinis
3.8 Bauleute und Bauprozess
3.8.1 Arbeitsteilung, Qualifikationsverteilung, Hierarchisierung und berufsständische Organisation
Einen ungefähren Eindruck des Spektrums der auf den großen Baustellen und in wichtigen Zulieferbereichen angefallenen Aufgaben vermittelt eine von A. Salonen besorgte Zusammenstellung sumerischer und akkadischer Fachtermini für im Ziegelbau beschäftigte Arbeiter, Fachkräfte und Funktionäre aus
Bezeugt sind im Einzelnen Erdarbeiter, die den Lehm in der Lehmgrube stachen (nāši marrim), solche, die ihn kneteten (lú-im), weiterhin „Lehmspezialisten“ (gal-im), Lehmträger (im-ı̇́l), Produzenten der Körbe zum Transport von Lehm, Ziegeln und Mörtel (ēpiš qappātim), Lehmziegelstreicher (lābin libitti), Backsteinfabrikanten (lú-na4im-na) und Ziegelbrenner (ṣārip agurrim), Zubereiter des Zuschlags für Glasurziegel (ša imnanakkim), Maurer (bānûm, rāṣipum), Baumeister (itinnum), leitende Baumeister (šitimgallum, rab itinnim) etc.
Die Bezeichnungen korrespondieren nicht alle mit eigenständigen Berufen, da viele Tätigkeiten auch von ungelernten Kräften ausgeführt werden konnten. Sie geben aber eine Vorstellung des Grades der Spezialisierung und der Qualifikationsverteilung im altorientalischen Bauwesen, wobei zu beachten ist, dass neben Ziegeln auch andere Baustoffe zum Einsatz gekommen sind, die weitere Arbeitsbereiche implizierten. Zugleich ist selbstverständlich, dass die Arbeitsteilung desto weiter reichte, je größer eine Baustelle war.325
Ein Beispiel für die Abwicklung der einfachen Arbeiten auf einer Großbaustelle des späten 3. Jahrtausends v. Chr. liefert ein Text der Ur III-Zeit. Er handelt von Ziegeln, die von Arbeitern an ihren Platz gebracht werden, und spiegelt eine Organisation in
Ein früher Hinweis auf die Einbeziehung fremder Arbeitskräfte in die großen öffentlichen Bauprojekte könnte aus der Zeit des Gudea
Die Rekrutierung von Kriegsgefangenen und Deportierten für öffentliche Bauprojekte ist spätestens seit altbabylonischer Zeit belegt.328 Im 1. Jahrtausend v. Chr. hat diese Praxis erheblich zugenommen, so dass ein großer Teil der Arbeiter auf den assyrischen Baustellen Kriegsgefangene waren. Ihre lange Zeit erfolgreichen Feldzüge und die in großem Stil durchgeführten Deportationen haben den assyrischen Herrschern eine gewaltige Zahl von Zwangsarbeitern zugeführt. So ist in den Quellen z. B. von 30.000 Deportierten aus Hama
Mehr Informationen gibt es zu den Fachkräften. Anhand zahlreicher Textquellen aus dem späten 4. und v. a. 3. Jahrtausend v. Chr. kann H. Neumann aufzeigen, dass die Baumeister jener Zeit in den verschiedenen Provinzen Südmesopotamiens hierarchisch organisiert waren. Auch eine berufsständische Organisation erscheint denkbar, lässt sich aber nicht beweisen. Von besonderer Relevanz ist die Bezeichnung „Oberbaumeister“ (šidim-gal). Sie tritt in Ur III-zeitlichen Texten und Siegellegenden aus Nippur
Verschiedene Oberbaumeister sind namentlich bekannt und über einige weiß man nähere Einzelheiten. Lugalazida
In Texten aus Girsu sìla doppelt so hohe Ölrationen wie die gewöhnlichen Baumeister erhalten, denen jeweils nur
sìla doppelt so hohe Ölrationen wie die gewöhnlichen Baumeister erhalten, denen jeweils nur
 sìla zustand.
sìla zustand.
Bisweilen lassen sich auch die beruflichen Laufbahnen einzelner
Prosopographische Untersuchungen zu Texten aus jener Periode verdeutlichen fernerhin, dass die Baumeistersöhne, so wie dies auch in anderen Berufen häufig der Fall gewesen ist, den Beruf ihres Vaters weitergeführt haben. Gelegentlich konnten sie allerdings auch neue Berufe ergreifen. So geht aus Texten aus Ur
Auch aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. gibt es Nachrichten darüber, dass die Söhne von Baumeistern üblicherweise den gleichen Beruf wie ihre Väter ausgeübt haben. Dokumentiert ist dies etwa in der Korrespondenz der assyrischen Staatsarchive.332
Neben den philologischen Analysen geben mitunter auch archäologische Studien erstaunlichen Aufschluss über den Arbeitsablauf und die Qualifikation der auf den Bauplätzen tätigen Handwerker. So konnte in detaillierten Untersuchungen zum Herstellungsprozess der Orthostatenreliefs in den neuassyrischen Palästen der Nachweis erbracht werden, dass der Entwurf bestimmter Szenen von einem Meister stammte, die Ausführung hingegen durch einen Gesellen mit geringerem handwerklichen Geschick erfolgt ist.333 Ähnliche Beobachtungen hat man auch an den reich verzierten Bronzebeschlägen auf Toren neuassyrischer Tempel und Paläste gemacht.334
In den offiziellen Inschriften der Assyrerkönige bleiben die Baumeister, Steinmetze und Skulpteure, sofern sie überhaupt erwähnt werden, durchweg anonym. Selbst die planenden Architekten und die Bauleiter, die in großer Zahl an den Unternehmungen mitgewirkt haben müssen, kommen dort allenfalls in sehr allgemeinen Zusammenhängen vor. Im Mittelpunkt der Texte stehen, lässt man einmal den Lobpreis der Herrscherpersönlichkeit außer Betracht, die Gebäude sowie ihre technischen und ästhetischen Vorzüge.335
Einen lebendigeren Eindruck der Arbeitsorganisation auf einer Großbaustelle der neuassyrischen Zeit vermitteln die den Bau der Residenzstadt Dur-Šarrukin
Die Bereitstellung der Arbeitskräfte und die Steuerung des Materialflusses lagen im wesentlichen in der Verantwortung der hohen Staatsbeamten, d. h. der Minister und Provinzgouverneure, wobei aus den Quellen als Hauptkoordinator und oberster Aufseher der Arbeiten Tab-šar-Aššur
Die einfachen Arbeiter, die das Gros der auf der Baustelle beschäftigten Personen ausmachten, bestanden aus Tausenden von Kriegsgefangenen und Deportierten unterschiedlichster Herkunft sowie aus dienstverpflichteten Assyrern. Auch die lokale Bevölkerung der nahegelegenen Dörfer ist in die Ziegelproduktion eingespannt worden. Beständiger Mangel herrschte bei den ausgebildeten Baumeistern sowie den Fachkräften anderer Sparten. Man hat sie deshalb ebenfalls aus allen Teilen des Reiches in Dur-Šarrukin
Weitere Beispiele komplexer Bauprozesse stellen die assyrischen Wasserbauten des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr. dar. A. M. Bagg differenziert dort grundsätzlich zwischen drei beteiligten Personengruppen: Den Funktionären, die für die Verwaltung der Projekte zuständig waren, den Fachleuten, d. h. den Wasserbauingenieuren, mit ihren spezifischen technischen Kenntnissen und den Baumeistern, Aufsehern und Arbeitern, die die Projekte ausführten.337
Die Verantwortung war nach einem dendritischen Schema verteilt, das sich in Gestalt eines Diagramms wiedergeben lässt, an dessen Spitze der König steht und dessen Basis die Arbeiter bilden. Die Informationen aus den Texten sind jedoch extrem spärlich und konzentrieren sich vornehmlich auf die beiden Enden der Befehlskette, d. h. den König und das Heer der Arbeiter (ṣābu).
Der König war der Auftraggeber der Bauvorhaben. Er legte die generellen Richtlinien fest und verfolgte den Gang der Arbeiten. Bei Sanherib
Die Tätigkeiten der in den Wasserbauprojekten beschäftigten Arbeiter werden in den Texten lediglich sehr allgemein abgehandelt und nicht näher präzisiert. So erfährt man in der Regel nur, dass sie an einem Kanal gearbeitet haben. Rätselhaft ist indes eine Angabe in Sanheribs Bavian-Inschrift, der zufolge er den Hinis-Hosr-Kanal
Innerhalb seines Quellenmaterials kann Bagg nur einen einzigen Terminus benennen, der auf einen Funktionär im wasserbaulichen Bereich hindeutet. Es handelt sich um den Terminus gugallu „Kanalinspektor“, der jedoch zumeist als Götterepitheton bezeugt ist. Bloß in einigen wenigen Fällen erscheint gugallu in Verbindung mit Personen. So wird in einem Brief an Sargon II.
Über die genauen Kompetenzen und Aufgabenbereiche des gugallu schweigen die assyrischen Texte.339 Auch bleibt offen, inwieweit eine Trennung von Amt und Beruf vorgelegen hat. Prinzipiell nimmt Bagg aber an, dass die höheren Beamten, in deren Zuständigkeit die Wasserbauten fielen, keine Experten gewesen sind. Bei niedrigeren Funktionären hält er es indessen für durchaus möglich, dass sie auch über fachliche Kenntnisse verfügt haben. Das Schema entspräche den hierarchischen Strukturen und der Kompetenzverteilung, wie sie beim Bau der neuassyrischen Residenzstadt Dur-Šarrukin
Was die mit der Realisierung der Projekte betrauten Personen anbetrifft, so liegen aus einem Brief des königlichen Schatzmeisters Tab-šar-Aššur
Die assyrischen Wasserbauingenieure werden in den Quellen nur einmal und lediglich indirekt erwähnt. Vor der Inbetriebnahme des Hinis-Hosr-Kanals
Aufgeführt sei schließlich ebenfalls noch das Zeugnis der neu- bis spätbabylonischen Tempelarchive aus dem Eannabezirk von Uruk
Neben einer großen Zahl von einfachen Arbeitern gab es gleichfalls Spezialisten (ummânum). Hierbei handelte es sich im wesentlichen um Baumeister (itinnum) sowie weitere Baufachleute (warad ekallim). Innerhalb beider Gruppen gab es aber nur wenige Personen, die besonders herausragten (mār bāni). Die Mehrzahl der Fachkräfte waren freie Handwerker von mittlerem Status.341
3.8.2 Leistung und Bezahlung
Über die Entlohnung und die hierfür zu erbringenden Arbeitsleistungen der Bauleute im Kontext der Tempel- und Palasthaushalte erfährt man hauptsächlich aus den Wirtschafts- und Verwaltungsurkunden der einzelnen Epochen sowie mathematischen Texten speziell der altbabylonischen Zeit.
Ausgebildete Baumeister erhielten im 3. Jahrtausend v. Chr. in aller Regel Rationen oder vergleichbare Zuteilungen, die aus Gerste, Mehl, Öl, Bier und Brot sowie Stoffen bestanden. Ferner gibt es Belege dafür, dass Baumeister Inhaber von Versorgungsfeldern waren. Oberbaumeister bezogen höhere Rationen als die einfachen Baumeister.343
Zumindest ein Teil der uns bekannten Baumeister aus der Ur III-Zeit gehörte offenbar zur vermögenden Ober- oder Mittelschicht. Dies zeigen Verwaltungs-, Gerichts- und private Rechtsurkunden, aus denen hervorgeht, dass Baumeister Eigentümer von Kleinviehherden, Sklaven und Hausgrundstücken gewesen sind.344
Das Gros der Arbeiter auf den öffentlichen Baustellen machten allerdings billige ungelernte Kräfte aus, Dienstverpflichtete und Zwangsarbeiter, die für ihre Tätigkeiten oft nicht viel mehr als die zum Überleben unbedingt notwendigen täglichen Lebensmittelrationen erhielten.345
Ein altbabylonischer Text führt Rationen auf, die in Verbindung mit dem Bau einer Schule verteilt worden sind.346 Die Arbeiten, für die man die Rationen ausgegeben hat, umfassten die Ziegelherstellung mit Hilfe von Modeln, den Ziegel- und Schilfrohrtransport sowie die Verlegung von Schilfrohr und Rohrmatten zwischen Ziegelschichten. Die Gesamtheit der Arbeiten wird mit dem Begriff „al-tar“ umschrieben, den man außer für Bauarbeiten auch für Feldarbeiten benutzte. Bei den Arbeitern hat es sich um Tagelöhner gehandelt, die offenbar keine besondere Spezialisierung aufwiesen.347
Aussagekräftig im Hinblick auf die Entlohnung der einfachen Arbeiter ist weiterhin ein Textdokument Sin-iddinams
Schriftquellen aus der Zeit der 3. Dynastie von Ur und aus altbabylonischer Zeit liefern zahlreiche Informationen über das Tagespensum (iškarum) der mit der Ziegelproduktion und dem Ziegeltransport befassten
Koeffizienten erleichterten die Ermittlung der Solleistungen. Der Terminus nazbālum entsprach bspw. der Ziegelmenge, die ein Arbeiter in 30 Tagen über eine Distanz von 30 ninda (180 m) transportieren konnte. Ausgehend von diesem Wert konnten verhältnismäßig einfach die Solleistungen für andere Strecken und Zeiträume kalkuliert werden. Da das nazbālum 30 bán Gerste gleichkam, ließ sich mit ihm ebenfalls die
Mathematische Texte hatten auch die Bemessung des Lohns bei abweichender Ziegelzahl zum Gegenstand, wobei jeweils wieder der spezifische Ziegeltyp und damit sein Gewicht berücksichtigt wurden.351
Weitere Tagespensa der Arbeiter in der Ziegelproduktion bestanden je nach Einsatzbereich darin, pro Tag 6 m3 Lehm
Auch ethnographische Beobachtungen können zuweilen bei der Taxierung durchschnittlicher Solleistungen helfen. So hat M. E. L. Mallowan beim Bau des Grabungshauses in Kalhu
3.9 Arten des Wissens und ihre Tradierung
3.9.1 Wissensart und grundlegende Quellen des Wissens
Zugleich ist das altorientalische Bauwissen
Mehrheitlich dürfte das Bauwissen im Laufe der Jahrtausende akkumuliert worden sein. Experimentelle Wissensgenerierung scheint dagegen vornehmlich während der Urukzeit im 4. Jahrtausend v. Chr. eine größere Rolle gespielt zu haben, als man, wie die Befunde im Anu- und im Eannabezirk von Uruk
In ähnlicher Weise wie die Urukzeit darf vielleicht auch schon die späte Ubaidzeit am Ende des 5. Jahrtausends v. Chr. charakterisiert werden, wenn man die sehr aufwendige öffentliche Architektur im Anubezirk von Uruk
3.9.2 Existenzformen des Wissens und Tradierung
Personales Wissen
Zweifelsohne wird es Expertenwissen von Einzelpersonen gegeben haben. Allerdings lassen sich solche Personen in den Textquellen kaum festmachen, da in den offziellen Bauinschriften und –monumenten stets nur die Herrschergestalt als Bauherr im Zentrum steht.359 In sehr anschaulicher Weise dokumentiert dies ein Sitzbild des Gudea von Lagaš
Das Schweigen der Quellen zu den hinter den Bauwerken stehenden Architektenpersönlichkeiten, die hierdurch für uns vollständig anonym bleiben, entspricht durchaus den altorientalischen Gepflogenheiten, wie sie auch aus anderen Bereichen der künstlerischen Produktion, soweit dieser Begriff auf den Alten Orient angewandt werden kann, bezeugt sind. Auch dort steht jeweils der Herrscher als Auftraggeber oder allenfalls das Werk, nicht aber der Bildhauer, Dichter usw. im Vordergrund.362
Vermutlich sind die nachweislich aus dem Bauhandwerk selbst stammenden „Oberbaumeister“ und die verschiedenen anderen Spezialisten, die bei den größeren Bauprojekten offenbar regelmäßig den für die bautechnische Seite zuständigen Personenkreis bildeten363, gleichzeitig auch die planenden Architekten und Ingenieure gewesen, da sie das hierzu erforderliche Expertenwissen in sich trugen. Sie dürften, jeweils in engem Dialog mit den Bauherren bzw. deren Beauftragten, z. B. die großen Wasserbauprojekte aus der Zeit Sanheribs
Neben dem Expertenwissen gab es als zweite Form des personalen Wissens die Bautradition. Sie begegnet in lokaler, regionaler und landesweiter Ausprägung. Grundsätzlich gilt, dass die Bautradition Mesopotamiens
Deutlicher werden die regionalen Verschiedenheiten, wenn man Syrien
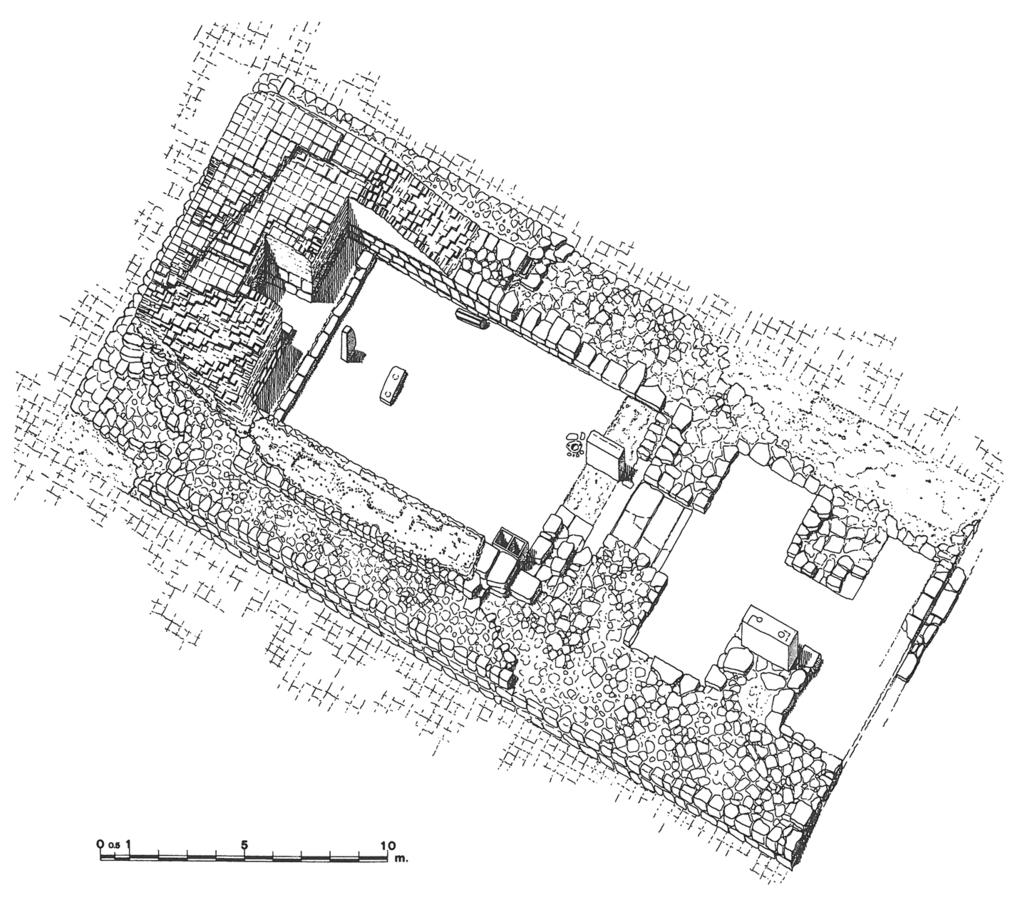
Abb. 3.47: Isometrie des Tempels D in Ebla
Was die Monumentalarchitektur angeht, ist überdies zu berücksichtigen, dass spätestens ab dem 1. Jahrtausend v. Chr. auf den großen Baustellen Baumeister aus allen Landesteilen und ebenfalls aus außermesopotamischen Gebieten tätig gewesen sind.368 Gerade für die neuassyrische (Abb. 3.30, 3.46), aber auch für die spätbabylonische Baukunst sind in diesem Zusammenhang Beeinflussungen durch auswärtige Baumeister angenommen worden.369
Die Tradierung des Wissens
Im Hinblick auf personales Wissen
Entsprechendes gilt für die reliefierten Orthostaten in den neuassyrischen Palästen (Abb. 3.27, 3.28, 3.29, 3.30), die in ihrer ausgereiften Programmatik und Bildgestaltung gleichfalls ein hohes Maß an Vorausplanung und Spezialwissen erforderten.375 Zudem gibt es bei den Reliefs klare Hinweise auf ein Nebeneinander von Meister- und Gesellenarbeit.376
Bei vielen anderen einfacheren Tätigkeiten, etwa der Anfertigung der Ziegelmasse oder dem Streichen der Lehmziegel, kann man dagegen zwar von einer Arbeitsteilung sprechen, die generell in Abhängigkeit von der Baustellengröße gestanden haben wird, nicht jedoch von Spezialwissen im engeren Sinne. Die betreffenden Arbeiten wurden ebenso wie der Materialtransport von dem Gros der einfachen, jederzeit austauschbaren Baustellenarbeiter ohne besondere bauhandwerkliche Kenntnisse ausgeführt.377
Objektiviertes Wissen
Von
Unter den zahlreichen Bauinschriften befinden sich zwar auch einige längere Bauberichte (Abb. 3.6), jedoch sind diese aus der Perspektive des Bauherrn und nicht derjenigen des Baumeisters verfasst, selbst wenn sich der Bauherr, wie im Falle Gudeas
Aufschlussreicher sind die mathematischen Texte v. a. der altbabylonischen Zeit (erste Hälfte des 2. Jt. v. Chr.), zu denen sich nähere Erläuterungen in dem gesonderten Beitrag von Rosel Pientka-Hinz finden. Die Texte zeigen, dass die altorientalischen Baumeister durchaus in der Lage gewesen sind, vor Beginn der Bauarbeiten sehr detaillierte Erhebungen zum Bauaufwand, d. h. dem Materialbedarf, der erforderlichen Arbeiterzahl, der Arbeitszeit und den Baukosten vorzunehmen.379
Unter den Bauzeichnungen
Architekturmodelle aus dem Alten Orient haben ihrerseits nicht als Mittel der Bauplanung gedient, sondern im Kult Verwendung gefunden.382 Bei der Tradierung von Architekturwissen
Niedergeschlagen hat sich altorientalisches Bauwissen dagegen in den Bauwerkzeugen, auch wenn die Belegsituation dort kaum weitreichende Schlüsse erlaubt. Das in der Bildkunst am häufigsten wiedergegebene Hilfsmittel ist der Tragkorb, in dem Lehm oder Ziegel transportiert werden konnten.383 Er erscheint z. B. auf der Stele des Urnammu (2112–2095 v. Chr.), die den Herrscher mit geschulterten Utensilien bei der Durchführung eines Tempelbaurituals zeigt (Abb. 3.9).
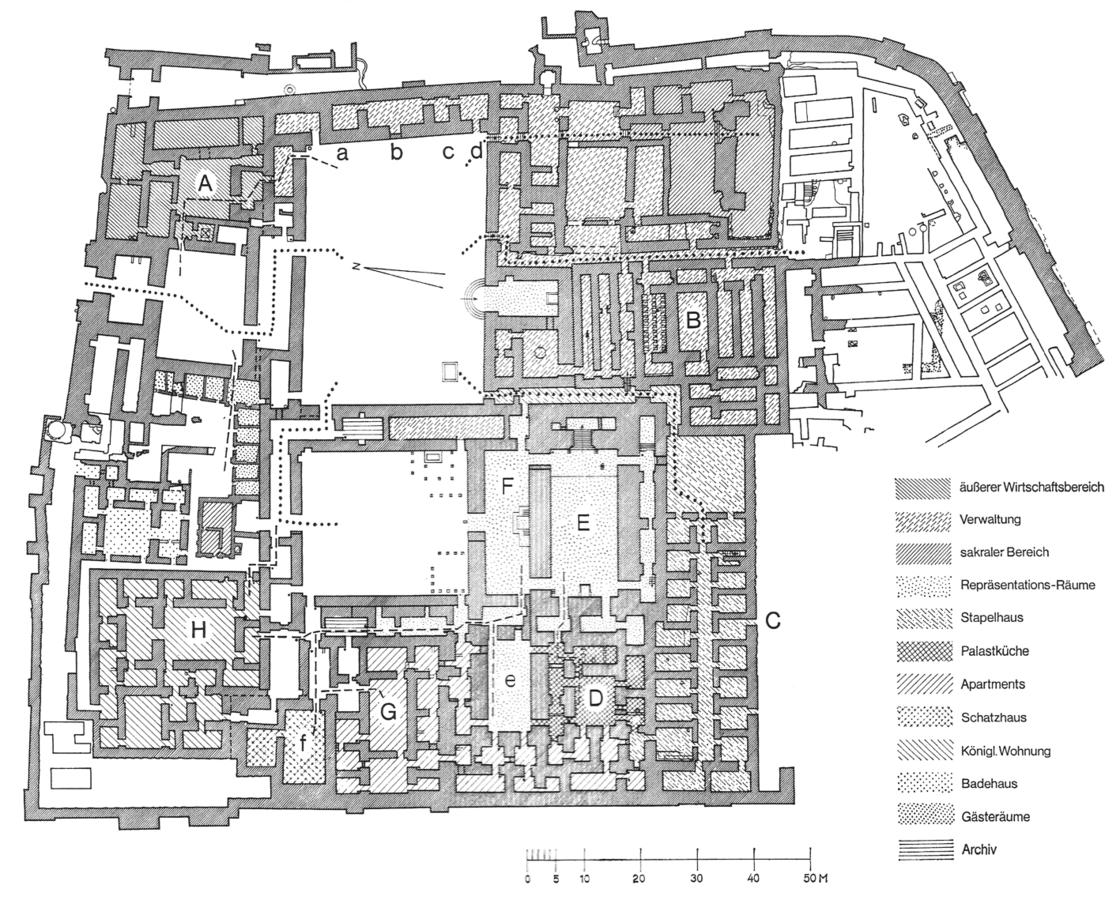
Abb. 3.48: Palast des Zimrilim in Mari
Die übrigen Werkzeuge Urnammus sind mit Ausnahme einer Axt nicht sicher identifizierbar. P. R. S. Moorey hat in ihnen einen Stechzirkel, eine Gießkelle für Bitumenmörtel und eine flache hölzerne Maurerkelle sehen wollen.384 Auch dokumentiert die Reliefdarstellung die Verwendung von Leitern auf der Baustelle. Die Urnammu in einem anderen Bildfeld der Stele überreichten Insignien Ring und Stab sind ebenfalls als Werkzeuge des Baumeisters, genauer als aufgerollte Messleine und Messstab, interpretiert worden.385
Die Messleine als Mittel zur Grundrissabschnürung findet zudem in den Inschriften Erwähnung, so etwa in der Zylinderinschrift Gudeas
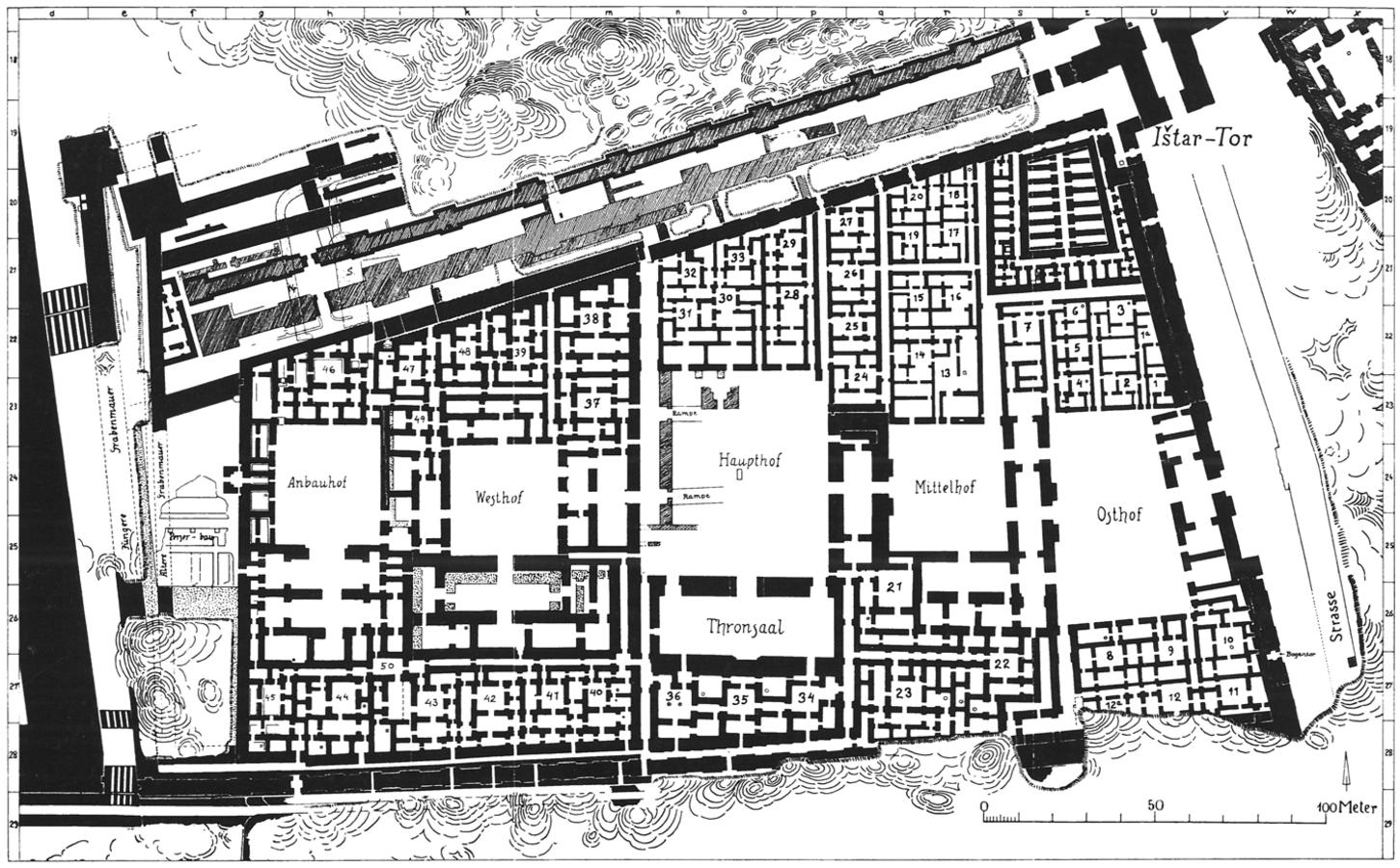
Abb. 3.49: „Südburg“ im Palastkomplex Nebukadnezars II. in Babylon
Originalfunde von Bauwerkzeugen fehlen auch weitgehend, da sich das Holz in der Regel nicht erhalten hat und die Metalle immer wieder eingeschmolzen worden sind.389
Reliefdarstellungen v. a. aus neuassyrischer Zeit geben ihrerseits noch Äxte zur Holz- und Sägen zur Steinbearbeitung wieder.390 In Verbindung mit den assyrischen Wasserbauten ist ferner die Verwendung von Meißeln bezeugt.391 Zum Transport mächtiger steinerner Bauglieder hat man unter Sanherib
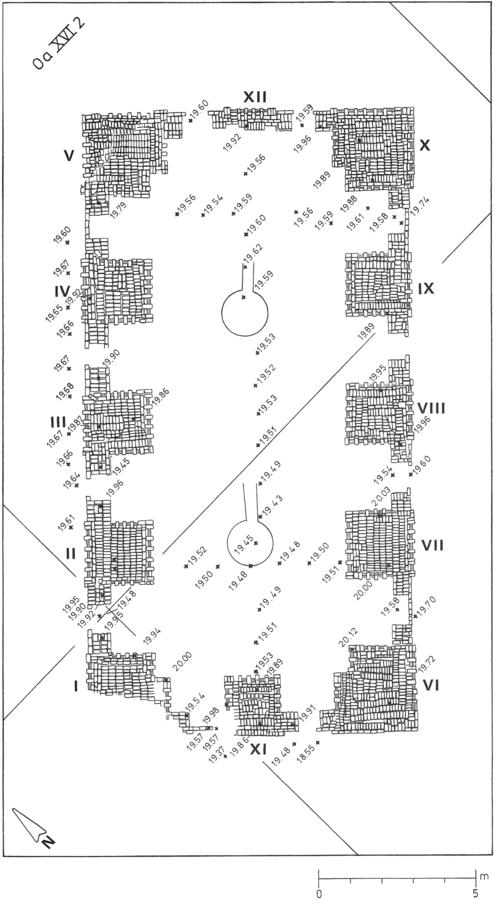
Abb. 3.50: Steingerechter Aufnahmeplan der Pfeilerhalle im Eannabezirk
Den mit Abstand aussagekräftigsten Fundus objektivierten Architekturwissens
Nicht nur für den heutigen Betrachter stellen die Bauten, deren Bestand sich mit jeder neuen Ausgrabung kontinuierlich erweitert, den deutlichsten Beweis des hoch entwickelten Architekturwissens im Alten Orient dar. Auch im Altertum wird das in den Bauten manifestierte Wissen sowohl für den Baumeisternachwuchs während der Ausbildung und praktischen Schulung als auch für die erfahrenen Bauleute eine prioritäre Informationsquelle gewesen sein. Die Möglichkeiten, die der Baubestand der modernen Forschung bezüglich der Rekonstruktion von Planungsverfahren und Bauausführung sowie ganz allgemein der Determination altorientalischen Bauwissens bietet, sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
Das in technischen Verfahren enthaltene Architekturwissen
Weiterhin könnte man die sehr unterschiedlichen Gründungsweisen nennen, zu denen neben Plattengründungen und Fundamentgräben, wie man sie bspw. aus dem urukzeitlichen Uruk
Schließlich sei noch auf die vielfältigen und v. a. in Nordmesopotamien
Institutionalisiertes Wissen
Über Ausbildungsinstitutionen im Bauwesen erfährt man kaum etwas. Neben dem baupraktischen Wissen, das die angehenden Baumeister sicher zum großen Teil von ihren Vätern und durch die tägliche Arbeit auf der Baustelle erworben haben, waren für die Berufsausübung weiterhin aber auch theoretische, darunter nicht zuletzt
Zwar liegt auch noch ein spätbabylonischer Lehrvertrag vor, der für einen arad ekalli die extrem lange Lehrzeit von acht Jahren ausweist. Dem Vertrag ist aber nur zu entnehmen, dass sich ein Lehrmeister um den Lehrling kümmern soll, nähere Einzelheiten über die Ausbildung werden nicht mitgeteilt. Zudem kann man diesen singulären Beleg nicht ohne weiteres auf andere Lehrverhältnisse übertragen, da es neben hoch qualifizierten Fachleuten stets auch etliche einfache Baumeister gegeben haben muss, denen eine weniger umfassende Ausbildung zuteil geworden ist.406
Im Hinblick auf Gewährleistungsinstitutionen
P. Pfälzner hat aus dem durch normierte Gassenfrontbreiten gekennzeichneten Wohnhauskonzept der sog. „Parzellenhäuser“, wie sie u. a. in Tell Chuera
Auf eine Bauaufsicht im Babylonien
Für die neuassyrische Zeit ist eine den Hausbau in Ninive
Briefen der späten neuassyrischen Zeit ist schließlich noch zu entnehmen, dass Aufgaben der Bauaufsicht sowie der Leistungskontrolle von Bauarbeiten vielfach wohl auch in den Händen eigens damit beauftragter königlicher Gesandter gelegen haben.410
Für eine Akademisierung oder gar eigenständige Forschungseinrichtungen im Bereich des altorientalischen Bauwesens gibt es, lässt man die bisweilen ungewöhnlich lange Ausbildungsdauer einmal außer Betracht, keine Anhaltspunkte. Hingegen zeichnen sich Akademisierungstendenzen im Ritualwesen ab, das im Baugeschehen immer eine besondere Stellung eingenommen hat.411
3.10 Anstösse und Wissensentwicklung
3.10.1 Einleitung
3.10.2 Anstöße durch gesellschaftlich vorgegebene Bauaufgaben sowie individuelle Aufgabendefinition
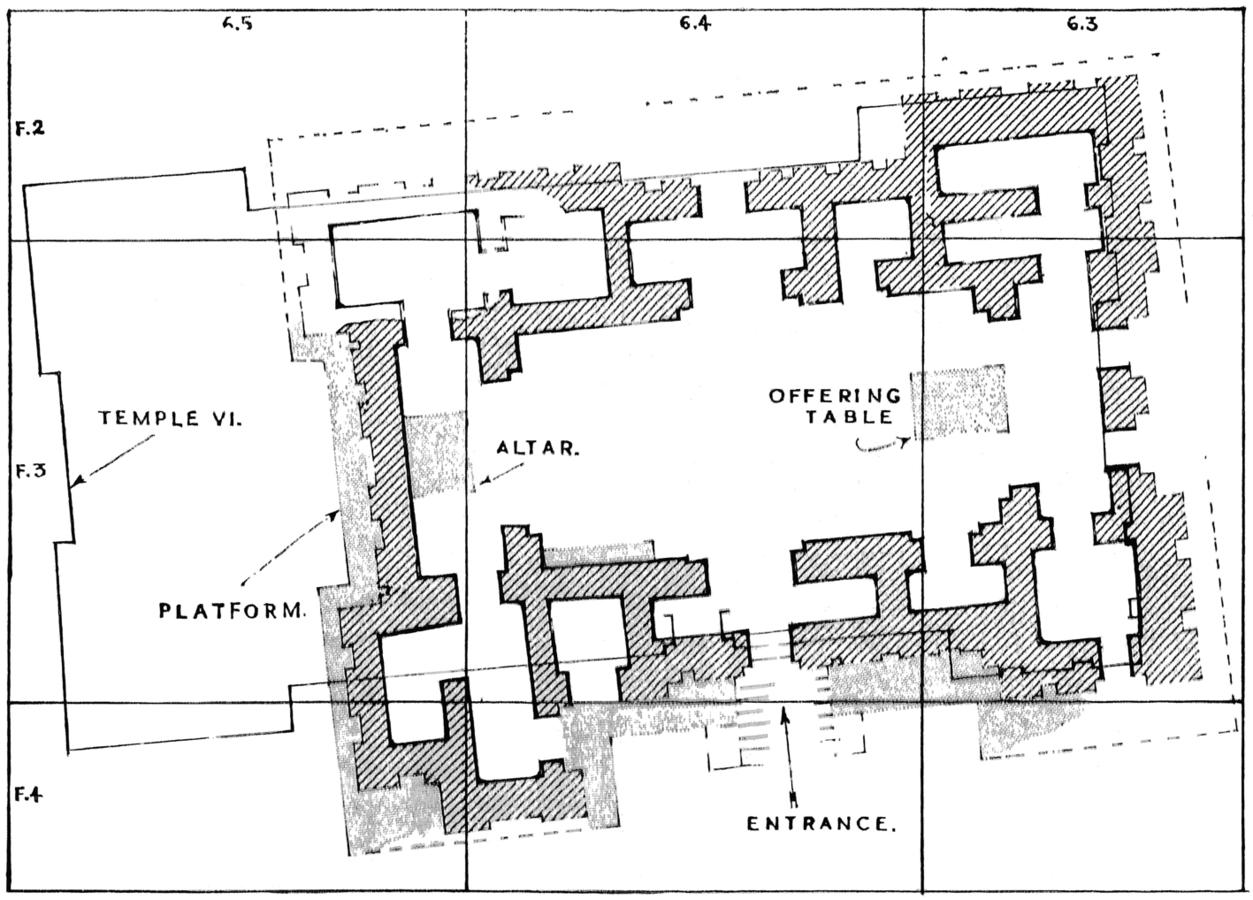
Abb. 3.51: Tempel VII aus der Abfolge prähistorischer Tempel in Eridu
Mit dem einsetzenden Urbanisierungsprozess hat auch der Bau von Verteidigungsanlagen der Entwicklung des Architekturwissens in Mesopotamien
Gleiches gilt für die monumentalen und vielfach mit Stiftmosaiken und aufwendigen Pfeiler-Nischen-Gliederungen versehenen Bauten im späturukzeitlichen Eannabezirk
Es gibt aus jener Epoche zahlreiche schriftliche und archäologische Zeugnisse für die Herausbildung einer hierarchisch gegliederten städtischen Gesellschaft mit einer komplexen Verwaltung und einer Herrschergestalt an der Spitze, für die die Errichtung prachtvoller Bauwerke, vornehmlich im Kontext der großen Heiligtümer, offenkundig ein Anliegen von höchster Priorität gewesen ist (Abb. 3.4, 3.5).
Ähnlich wie in späteren Zeiten dürften sowohl religiöse Motive wie auch der Wunsch nach propagandistischer Machtdemonstration im Fokus des Geschehens gestanden haben. Häufig ist auch betont worden, dass die mannigfaltigen Bauunternehmungen, in die weite Teile der Bevölkerung eingebunden waren, in den frühen Staaten einen bedeutenden wirtschaftlichen Faktor und ein wesentliches Element der kulturellen Identitätsstiftung dargestellt haben, wodurch sie zugleich der Konsolidierung der neu entstandenen Eliten dienten.
Überhaupt erst ermöglicht wurden die gewaltigen öffentlichen Bauprojekte durch die prosperierende Bewässerungswirtschaft im südlichen Zweistromland
Die Stratifizierung der frühsumerischen Gesellschaft schlägt sich auch in der Organisation des Bauwesens nieder, insofern als in den archaischen Texten aus Uruk
Hinsichtlich der Baumaterialien bildet die Urukzeit gleichfalls eine Zäsur. Erstmals kommen beim Bauen häufiger auch Backsteine zum Einsatz.417 Sie wurden, angesichts der geringen diesbezüglichen Resistenz der Lehmziegel, bevorzugt zum Schutz gegen Feuchtigkeit eingesetzt, oft in Verbindung mit Bitumenmörtel (Abb. 3.19). Zugleich liefert der Befund im Anu- und im Eannabezirk
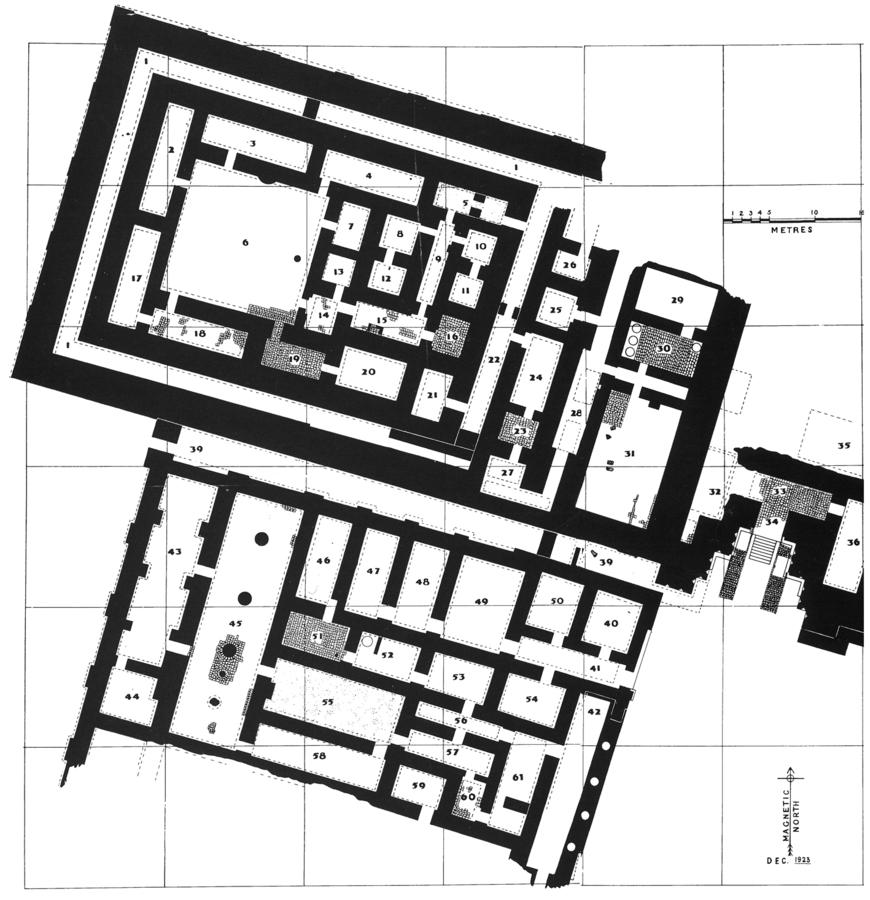
Abb. 3.52: Palace A in Hursagkalama
Eine weitere grundlegende Neuerung der frühdynastischen Zeit stellt die Bauweise mit plankonvexen Ziegeln dar, die ein rascheres Bauen unter vermehrter Einbindung ungelernter Kräfte ermöglicht zu haben scheint (Abb. 3.32). Die veränderte Ziegeltechnik ließe sich ggf. als Indiz einer voranschreitenden Arbeitsteilung interpretieren, wie sie aufgrund der immer größeren Bauprojekte in den frühdynastischen Stadtstaaten erforderlich geworden war. In Süd
Im Frühdynastikum vollzog sich gleichfalls ein tiefgreifender Wandel in der Organisation der Gebäudegrundrisse. So ist das sowohl für die Wohn- als auch für die
Hervorzuheben ist insbesondere die Ausbildung einer eigenständigen Palastarchitektur, selbst wenn Vorstufen hierzu durchaus schon in älterer Zeit vorhanden gewesen sind. Anders als die im Regelfall durch eher einfache Erschließungsmuster und Raumanordnungen gekennzeichneten Wohnhäuser und Tempel weisen die frühdynastischen Palastbauten, wie sie etwa in Eridu
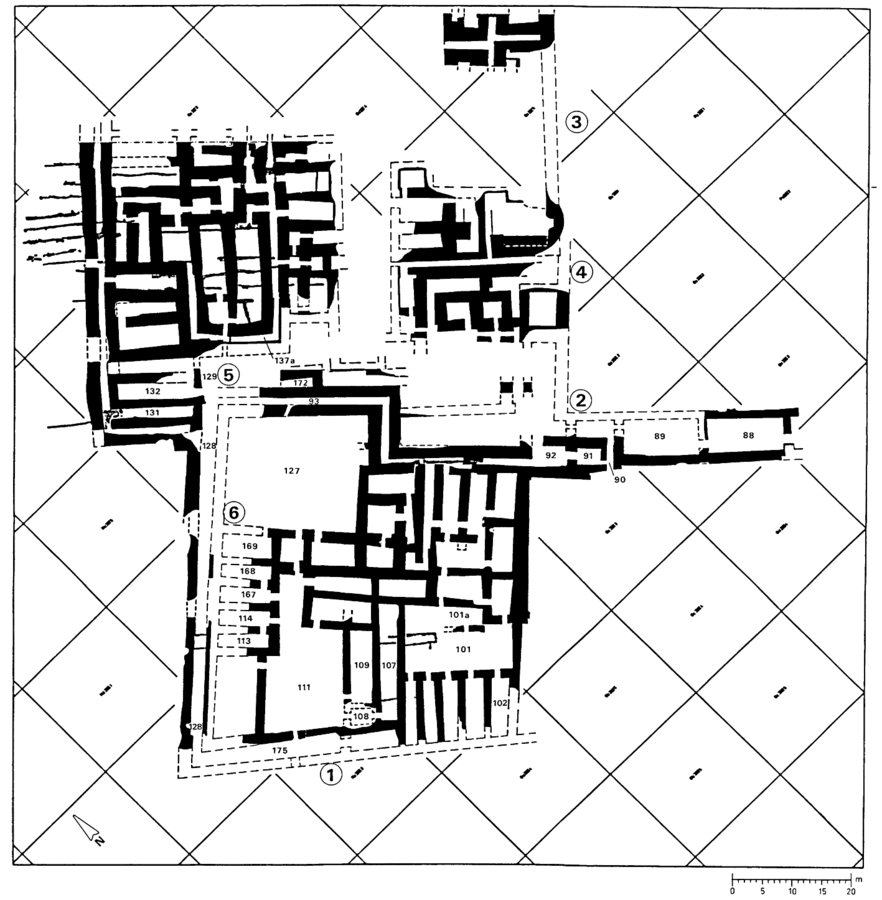
Abb. 3.53: Ergänzter Fundamentplan des „Stampflehmgebäudes“ im Eannabezirk
Ohne eine weitreichende Vorausplanung erscheint die Errichtung der Palastbauten nicht denkbar. Andererseits gibt es Anhaltspunkte dafür, dass den Grundrisslayouts keine genauen Gesamtpläne zugrunde gelegen haben. So fehlen formale Symmetrieachsen und die Mauerfluchten in den Palästen laufen nicht immer parallel oder rechtwinklig zueinander. Beim ausschließlich als Fundament erhaltenen „Stampflehmgebäude“ (Abb. 3.53) im Eannabezirk
Über die Architekturentwicklung während der Akkadzeit sind wir immer noch sehr unzulänglich informiert. Ausnahmen bilden primär einige Grabungsbefunde in nördlichen Orten wie Mari
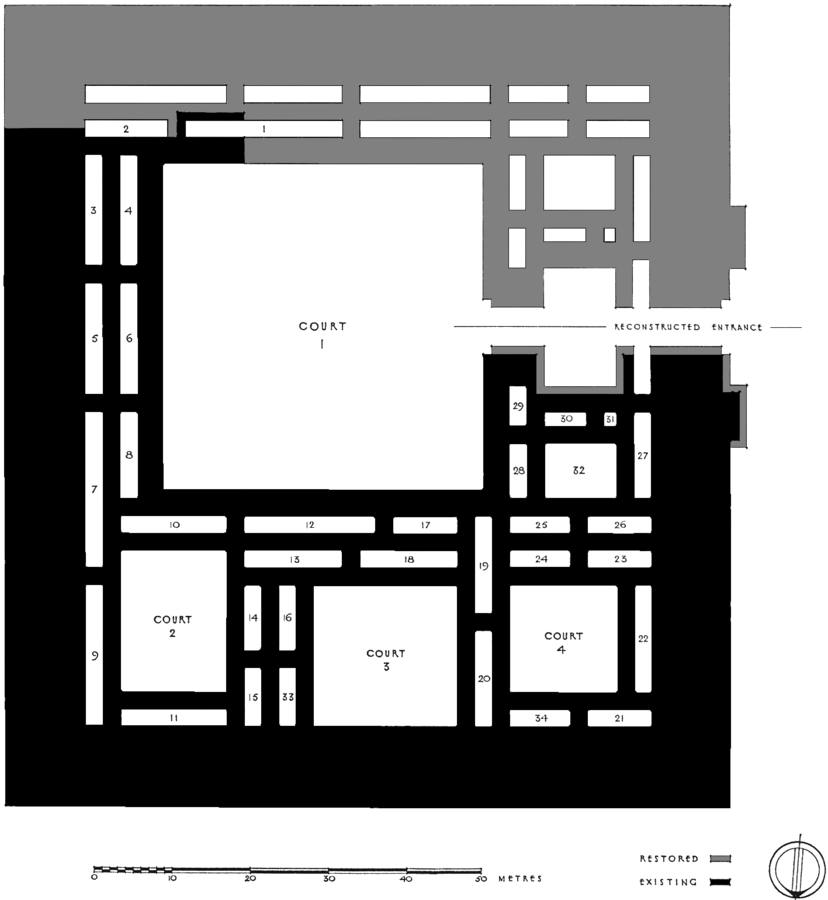
Abb. 3.54: Fundamentplan des Naram-Sin Palace in Tell Brak
Deswegen lässt sich auch nicht mit letzter Sicherheit sagen, ob der erstmals während der Ur III-Zeit unter Urnammu
Generell allerdings wurde gemäß den Selbstzeugnissen der Könige v. a. im Tempelbau der Wahrung der Tradition und der periodischen Rekonstruktion eines jeweils als ursprünglich angesehenen Gebäudezustands sehr hohe Bedeutung beigemessen. Hierzu gibt es zahlreiche inschriftliche Belege, gerade auch aus der Spätzeit des neuassyrischen Reiches und aus spätbabylonischer Zeit, so u. a. von Asarhaddon

Abb. 3.55: Grenzfestung Tukulti-Ninurtas I. in Tell Sabi Abyad
Zwar zeigt das Beispiel des Urnammu
Dabei ist anzunehmen, dass die Priesterschaften der großen Heiligtümer, die durch ihr spezifisches Wissen mehr als alle anderen am Bau Beteiligten als Hüter und Bewahrer altehrwürdiger Kulttraditionen auftreten konnten, auf die Planung von Baumaßnahmen und die Ausarbeitung architektonischer Entwürfe einen nicht minder großen Einfluss ausgeübt haben als die mit der Baudurchführung beauftragten, oft ebenfalls dem Tempelhaushalt entstammenden Baumeister. Einen indirekten Hinweis hierauf könnte ein Textbeleg aus dem 1. Jahrtausend v. Chr. bilden, dem zufolge verloren gegangene Kultordnungen verschiedener Heiligtümer in Uruk
Der im Vergleich zum Tempelbau stärker vom Herrscher geprägte Palastbau war prinzipiell innovativer. Das ließ sich bereits an den oben angesprochenen frühdynastischen Palästen aus Eridu
Hier machte, wie archäologische und, verstärkt ab dem späten 3. Jahrtausend v. Chr., auch textliche Befunde veranschaulichen, weniger die Beachtung der Tradition als vielmehr die individuelle Aufgabendefinition im Kontext herrscherlichen Strebens nach Ruhm einen entscheidenden Antrieb des Bauens aus. Es galt, sich nicht nur unter den Zeitgenossen, sondern auch über den Tod hinaus einen Namen zu machen. Größere Freiheiten für Bauherren und Planer ergaben sich obendrein dadurch, dass bei den Palästen die Bindung an einen festen, unveränderbaren Bauplatz nicht in gleicher Weise gegeben war wie bei den Tempeln.428
Dass sie durch ihre Bauwerke geschaffen hätten, was vor ihnen noch niemandem gelungen sei, haben schon die Ur III-Könige gerne herausgestellt, doch nimmt die Zahl entsprechender Verlautbarungen insbesondere in den Königsinschriften aus mittel- und neuassyrischer Zeit, d. h. ab der zweiten Hälfte des 2. Jahrtausends v. Chr., stark zu.429 Im Selbstbild der Herrscher wird ein sukzessiver Wandel erkennbar, der eine immer stärkere Fokussierung auf den Residenzstadt- und Palastbau zur Folge gehabt hat. Deutlich wird dies in zahlreichen groß angelegten und durch Ausgrabungen relativ gut erforschten Städte- und Palastbauprojekten der Assyrer, beginnend mit Kar-Tukulti-Ninurta
Namentlich für Sanherib
Den Wasserbau jener Zeit kennzeichnen vielfältige
Gerade unter den Assyrern waren es zudem einmal mehr militärische Erfordernisse, die neue Bauaufgaben stellten. Zum einen bezogen sich diese auf die Verteidigungsanlagen, wie sie sehr eingehend etwa von P. M. M. G. Akkermans in Tell Sabi Abyad
Neben den Befestigungen wurden gleichfalls gewaltige Zeughäuser für die Armee geschaffen, in denen offenbar auch die jährlichen Truppeninspektionen vor den Feldzügen erfolgten. Weiterhin dienten die Bauten zur Aufbewahrung von Kriegsbeute und Tributen. Beispiele kennt man aus Kalhu
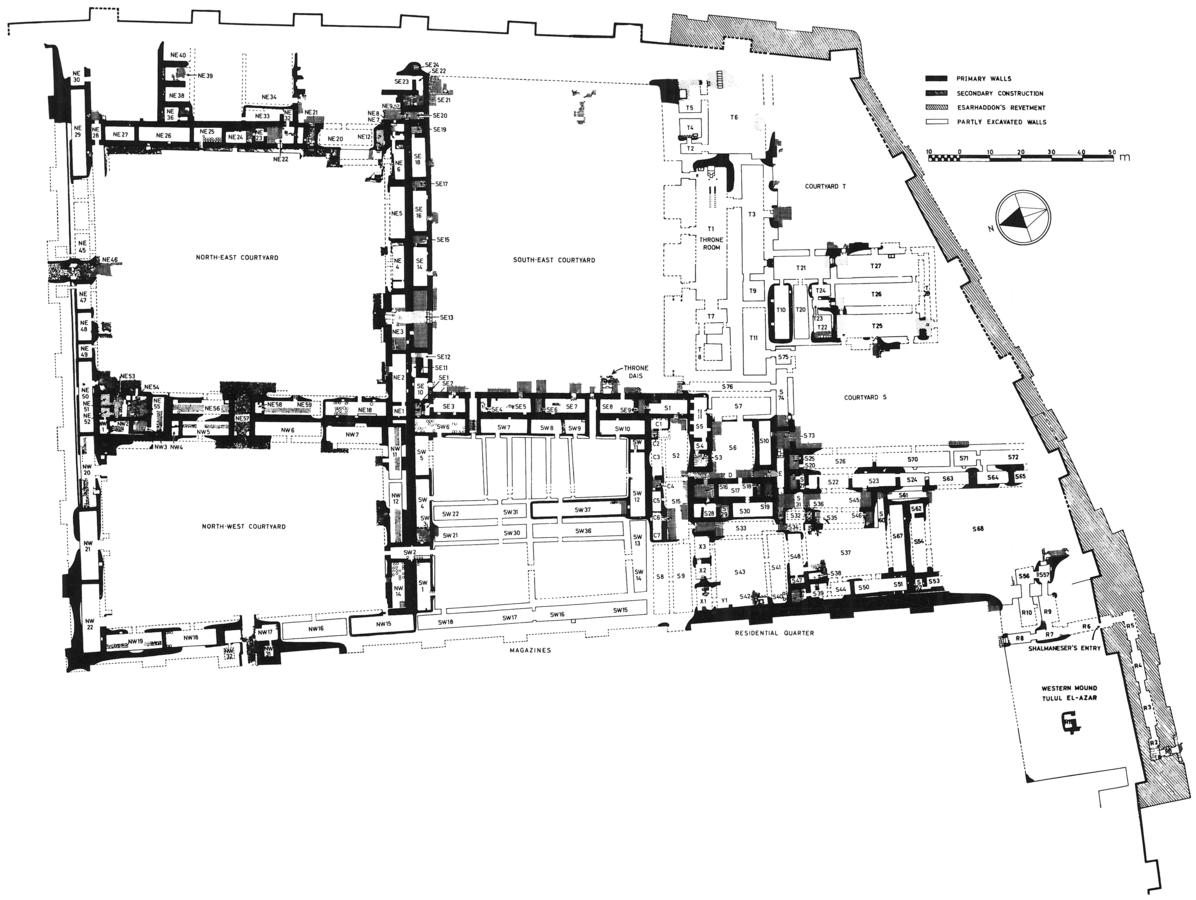
Abb. 3.56: Ekal māšarti Salmanassars III.
Gewichtige Veränderungen im mesopotamischen Bauwesen lassen sich auch in der spätbabylonischen Zeit beobachten, die wie schon die neuassyrische Zeit durch eine ungeheure königliche Bautätigkeit gekennzeichnet ist, welche sich vor allem auf die Hauptstadt, aber auch auf andere babylonische Städte erstreckte.
Abgesehen von dem gigantischen, unter Nabupolassar
Ungewöhnlich waren zudem die Gründungsweisen der „Südburg“ (Abb. 3.34, 3.49) und der „Hauptburg“ im zentralen Palastbezirk, die ähnlich auch an der sich nach Osten hin anschließenden Prozessionsstraße und am Ištartor nachgewiesen werden konnten. Sämtliche Mauern hatte man, offenkundig planmäßig, als Fundamentmauern in mehreren aufeinander folgenden Baustufen hochgezogen und sukzessive mit Schutt aufgefüllt oder auch massiv vermauert, bis die gewünschte Fußbodenhöhe erreicht war, ab der das aufgehende Mauerwerk begann. Auf solche Art ist der Palastbezirk gegenüber der umgebenden Bebauung deutlich betont und im Bereich des Kasr eine künstliche Zitadelle geschaffen worden.
Die massiven Gründungen haben allerdings, wie R. Koldewey bei der Freilegung der Mauern feststellen musste, zu enormen Setzungsproblemen geführt, denen man auf verschiedene Weise begegnet ist. Z. B. hat man dort, wo Mauerkörper unterschiedlicher Gründungshöhe aufeinander trafen, Gleitfugen angeordnet und die Fundamente des sog. „Sommerpalastes“ Nebukadnezars II.
Zweifellos sind die enorm aufwendigen Fundamentkonstruktionen in Babylon
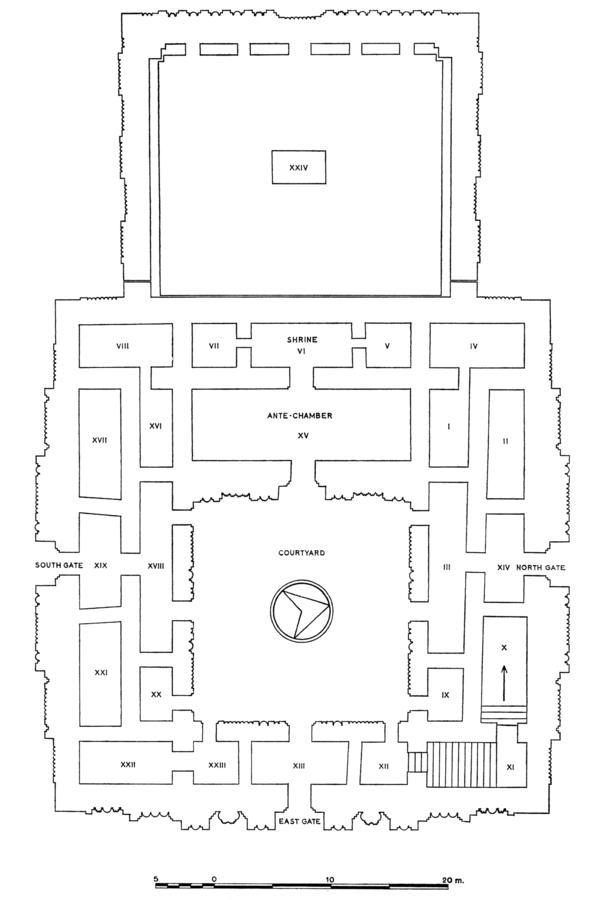
Abb. 3.57: Tempel von Tell Rimah
3.10.3 Anstöße durch interkulturelle Momente und aus Nachbardisziplinen
Zu verschiedenen Zeiten hat das altorientalische Architekturwissen Impulse durch interkulturelle Momente erhalten. Dies gilt in besonderem Maße für die peripheren Regionen wie bspw. Syrien
Im Folgenden sollen einige Beispiele möglicher interkultureller Anstöße aufgeführt werden. M. Bietak etwa hat für die erste Hälfte des 2. Jahrtasuends v. Chr. auf potentielle äußere Einflüsse in der Architektur von Ebla
Weiterhin lässt sich der nach den bisherigen Grabungsergebnissen nahe am Beginn der syrischen Mittelbronzezeit II erbaute Königspalast von Qatna
Andererseits lassen sich in Qatna
Als drittes Beispiel für externe Impulse kann die merkliche Zunahme qualitätvoller Werksteinarchitektur in Assyrien
Unter den Nachbardisziplinen, die die Wissensentwicklung
3.10.4 Verlorenes Wissen
Offenbar aus den südlichen Schwemmebenen stammende Zuwanderer hatten während der Späturukzeit am rechten Euphratufer
Mit dem Ende der urukzeitlichen Niederlassungen kehrte das mittlere Euphratgebiet wieder zu seiner althergebrachten Lebensweise in kleineren Gemeinschaften zurück. Die Bauweise in den frühbronzezeitlichen Orten ist von lokalem Charakter und lässt allenfalls singuläre Anklänge an die weit komplexere südliche Architektur erkennen. Ersichtlich hat kein größerer Bedarf an Anleihen aus den fremden Wissenstraditionen bestanden. Bis die ersten endogenen frühbronzezeitlichen Urbanisierungsprozesse am mittleren Euphrat einsetzten und sich damit einhergehend ein neuerlicher Wandel in der Architektur vollziehen sollte, sind noch einmal einige hundert Jahre vergangen.445
Bibliographie
Adams, R. McC. (1974). The Mesopotamian Social Landscape. A View from the Frontier. In: Reconstructing Complex Societies Ed. by C. B. Moore. Bulletin of the American Schools of Oriental Research Supplement 20. Cambridge/Mass.: MIT Press 1-20.
Akkermans, P. (2006). The Fortress of Ili-pada. Middle Assyrian Architecture at Tell Sabi Abyad, Syria. Subartu 17: 201-211
Akkermans, P., G. M. Schwartz (2004). The Archaeology of Syria. From Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (ca. 16,000-300 BC). Cambridge: Cambridge University Press.
Albenda, P. (1983). A Mediterranean Seascape from Khorsabad. Assur 3: 1-34
- (1986). The Palace of Sargon, King of Assyria. Paris: Éditions Recherche sur les civilisations.
Allinger-Csollich, W. (1991). Birs Nimrud I. Die Baukörper der Ziqqurat von Borsippa. Ein Vorbericht. Baghdader Mitteilungen 22: 383-494
Ambos, C. (2004). Mesopotamische Baurituale aus dem 1. Jahrtausend v. Chr.. Dresden: ISLET.
Amiet, P. (1980). La glyptique mésopotamienne archaїque. Paris.
Andrae, W. (1935). Die jüngeren Ischtar-Tempel in Assur. Leipzig: Hinrichs.
Anonymus (1999). Recent Excavations in Iraq. Iraq 61: 195-202
Arnold, D. (1996). Die Tempel Ägyptens. Götterwohnungen – Baudenkmäler – Kultstätten. Augsburg: Bechtermünz Verlag.
Aurenche, O. (1977). Dictionnaire illustré multilingue de l'architecture du Proche Orient Ancien. Lyon: Maison de l'Orient.
- (1981). La Maison orientale. L'architecture du Proche Orient Ancien des origines au milieu du quatrième millénaire. Paris: Libr. Orientaliste P. Geuthner.
Bagg, A. M. (2000). Assyrische Wasserbauten. Landwirtschaftliche Wasserbauten im Kernland Assyriens zwischen der 2. Hälfte des 2. und der 1. Hälfte des 1. Jahrtausends v. Chr.. Mainz: Philipp von Zabern.
- (2012). Zur Technologie altorientalischer Bewässerungssysteme: Technologietransfer in Nordmesopotamien im 1. Jt. v. Chr.. In: Wissenskultur im Alten Orient. Weltanschauung, Wissenschaften, Techniken, Technologien. 4. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 20.–22. Februar 2002, Münster Ed. by H. Neumann. Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft 4. Wiesbaden: Harrassowitz 339-371
- (2013). Bewässerung in Südmesopotamien. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 136-137
Baker, H. D. (2005). The Property Portfolio of a Family of Builders from Hellenistic Uruk. In: Approaching the Babylonian Economy. Proceedings of the START Project Symposium Held in Vienna, 1–3 July 2004 Ed. by H. D. Baker, M. Jursa. Alter Orient und Altes Testament 330. Münster: Ugarit-Verlag 7-43.
Bär, J. (2003). Die älteren Ischtar-Tempel in Assur. Stratigraphie, Architektur und Funde eines altorientalischen Heiligtums von der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends bis zur Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr.. Saarbrücken: Harrassowitz.
Battini, L. (2006). Pour une nouvelle classification de l'architecture domestique en Mésopotamie du IIIe au Ier mill. av. J.-C.. Akkadica 127: 73-92
Battini-Villard, L. (1999). L'espace domestique en Mésopotamie de la III. Oxford: J.E. Hedges.
Baumgartner, W. (1925). Untersuchungen zu den akkadischen Bauausdrücken. Zeitschrift für Assyriologie 36: 29-40
Beaulieu, P. A. (1989). The Reign of Nabonidus, King of Babylon 556–539 BC. New Haven, London: Yale University Press.
Becker, A. (1985). Neusumerische Renaissance? Wissenschaftsgeschichtliche Untersuchungen zur Philologie und Archäologie. Baghdader Mitteilungen 16: 229-316
Becker, H., M. Ess, M. E. (2013). Uruk: Urbane Strukturen im Magnet- und Satellitenbild. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 355-361
Behm-Blancke, M. R. (1989). Mosaikstifte am oberen Euphrat – Wandschmuck aus der Uruk-Zeit. Istanbuler Mitteilungen 39: 73-83
Bernbeck, R. (1995). Die Uruk-Zeit: Perspektiven einer komplexen Gesellschaft. In: Zwischen Euphrat und Indus. Aktuelle Forschungsprobleme in der Vorderasiatischen Archäologie Ed. by K. Bartl, R. Bernbeck, R. B.. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms-Verlag 57-67
Besenval, R. (1984). Technologie de la voûte dans l'Orient ancien des origines à l'époque sassanide. Paris: Éditions Recherche sur les civilisations.
Bietak, M. (1998). Gedanken zur Ursache der ägyptisierenden Einflüsse in Nordsyrien in der Zweiten Zwischenzeit. In: Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens Ed. by H. Guksch, D. Polz. Mainz: Philipp von Zabern 165-176
- (2010). From Where Came the Hyksos and Where Did They Go?. In: The Second Intermediate Period (Thirteenth–Seventeenth Dynasties). Current Research, Future Prospects Ed. by M. Marée. Orientalia Lovaniensia Analecta 192. Löwen, Paris, Walpole: Peeters Publishers 139-181
Biggs, R. D. (1966). The Abu Salabikh Tablets. A Preliminary Survey. Journal of Cuneiform Studies 20: 73-88
Böhme, S., S. Kulemann (1995). Das frühbronzezeitliche Nordmesopotamien: Nur provinzielles Hinterland?. In: Zwischen Euphrat und Indus. Aktuelle Forschungsprobleme in der Vorderasiatischen Archäologie Ed. by K. Bartl, R. Bernbeck, R. B.. Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms-Verlag 91-99
Bonatz, D. (2012). Stelen der Gudea- und Ur III-Zeit. Bildliche Wege des Wissenstransfers im Alten Orient. In: Wissenskultur im Alten Orient. Weltanschauung, Wissenschaften, Techniken, Technologien. 4. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 20.–22. Februar 2002, Münster Ed. by H. Neumann. Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft 4. Wiesbaden: Harrassowitz 307-326
Borger, R. (1956). Die Inschriften Asarhaddons, Königs von Assyrien. Graz: Selbstverlag des Herausgebers.
Borowski, O. (1997). Irrigation. In: The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East 3 Ed. by E. M. Meyers. Oxford: Oxford University Press 181-184
Botta, P.-E., E. Flandin (1849). Monument de Ninive II. Architecture et sculpture. Paris: Impr. Nationale.
Brandes, M. A. (1968). Untersuchungen zur Komposition der Stiftmosaiken an der Pfeilerhalle der Schicht IVa in Uruk-Warka. Berlin: Gebr. Mann Verlag.
Bretschneider, J. (1991). Architekturmodelle in Vorderasien und der östlichen Ägäis vom Neolithikum bis in das 1. Jahrtausend. Kevelaer: Butzon & Bercker.
- (2007). The ‚Reception Palace‘ of Uruk and its Architectural Origin. In: Power and Architecture. Monumental Public Architecture in the Bronze Age Near East and Aegean. Proceedings of the International Conference Power and Architecture Organized by the Katholieke Universiteit Leuven, the Université Catholique de Louvain and the Westfälische Wilhelms-Universität Münster on the 21st and 22nd of November 2002 Ed. by J. Bretschneider, J. Driessen, J. D.. Orientalia Lovaniensia Analecta 156. Löwen, Paris, Dudley: Peeters Publishers 11-22
Bretschneider, J., J. Driessen, J. D. (2007). Power and Architecture. Monumental Public Architecture in the Bronze Age Near East and Aegean. Proceedings of the International Conference Power and Architecture Organized by the Katholieke Universiteit Leuven, the Université Catholique de Louvain and the Westfälische Wilhelms-Universität Münster on the 21st and 22nd of November 2002. Löwen, Paris, Dudley: Peeters Publishers.
Brinkman, J. A. (1976). A Catalogue of Cuneiform Sources Pertaining to Specific Monarchs of the Kassite Dynasty. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.
Brusasco, P. (1999–2000). Family Archives and the Social Use of Space in Old Babylonian Houses at Ur. Mesopotamia 34–35: 1-173
Buccellati, G. (1997). Syria in the Bronze Age. In: The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East 5 Ed. by E. M. Meyers. Oxford: Oxford University Press 126-131
Buccellati, G., M. Kelly-Buccellati (2000). The Royal Palace of Urkesh. Report on the 12th Season at Tell Mozan/Urkesh: Excavations in Area AA, June–October 1999. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 132: 133-183
- (2001). Überlegungen zur funktionellen und historischen Bestimmung des Königspalastes von Urkeš. Bericht über die 13. Kampagne in Tall Mozan/Urkeš: Ausgrabungen im Gebiet AA, Juni–August 2000. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 133: 59-96
- (2002). Die große Schnittstelle. Bericht über die 14. Kampagne in Tall Mozan/Urkeš: Ausgrabungen im Gebiet AA, Juni–Oktober 2001. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 134: 103-130
- (2004). Der monumentale Palasthof von Tall Mozan/Urkeš und die stratigraphische Geschichte des abi: Bericht über die 15. Kampagne 2002. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 136: 13-39
Burstein, S. M. (1978). The Babyloniaca of Berossos. Malibu: Undena Publications.
Butterlin, P. (2013). Die Expansion der Uruk-Kultur. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 205-211
Cancik-Kirschbaum, E. (2003). Die Assyrer. Geschichte, Gesellschaft, Kultur. München: C.H. Beck.
Castel, C. (1992). Habitat urbain néo-assyrien et néo babylonien. De l'espace bâti à l'espace vécu. Paris: Libr. Orientaliste P. Geuthner.
- (1996). Un quartier de maisons urbaines du Bronze Moyen à Tell Mohammed Diyab (Djezireh Syrienne). In: Houses and Households in Ancient Mesopotamia. Papers Read at the 40th Rencontre Assyriologique Internationale Leiden, July 5–8, 1993 Ed. by K. R. Veenhof. Leiden, Istanbul: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten 273-283.
Castel, C., M. al-Maqdissi, M. M. (1997). Les maisons dans la Syrie antique du III. Beirut: Institut Français d'Archéologie du Proche-Orient.
Cooper, J. S. (1986). Sumerian and Akkadian Royal Inscriptions I: Pre-Sargonic Inscriptions. New Haven: Eisenbrauns.
Cooper, L. (2006). Early Urbanism on the Syrian Euphrates. New York, London: Routledge.
Czichon, R. M. (1992). Die Gestaltungsprinzipien der neuassyrischen Flachbildkunst und ihre Entwicklung vom 9. zum 7. Jh. v. Chr.. München, Wien: Profil.
Damerji, M. S. B. (1987). The Development of the Architecture of Doors and Gates in Ancient Mesopotamia. Tokio: Institute for Cultural Studies of Ancient Iraq.
Davey, C. J. (1985). The Negub Tunnel. Iraq 47: 49-55
Debruyne, M. (1997). A Corbelled Akkadian Grave (Field F). In: Tell Beydar, Three Seasons of Excavations (1992–1994). A Preliminary Report Ed. by M. Lebeau, A. Suleiman. Subartu 3. Turnhout: Brepols Publishers 145-154.
Deller, K., S. Parpola (1966). Die Schreibungen des Wortes etinnu „Baumeister“ im Neuassyrischen. Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 60: 59-70
Delougaz, P. (1940). The Temple Oval at Khafājah. Chicago: University of Chicago Press.
Delougaz, P., H. D. Hill, H.D. H. (1967). Private Houses and Graves in the Diyala Region. Chicago: University of Chicago Press.
Dohmann-Pfälzner, H., P. Pfälzner (2006). Ausgrabungen und Forschungen in Tall Mišrife – Qatna 2004 und 2005. Vorbericht der deutschen Komponente des internationalen Kooperationsprojektes. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 138: 57-107
- (2007). Ausgrabungen und Forschungen 2006 im Königspalast von Qatna. Vorbericht des syrisch-deutschen Kooperationsprojektes in Tall Mišrife/Qatna. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 139: 131-172
- (2008). Die Ausgrabungen 2007 und 2008 im Königspalast von Qatna. Vorbericht des syrisch-deutschen Kooperationsprojektes in Tall Mišrife/Qatna. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 140: 17-74
- (2011). Die Ausgrabungen 2009 und 2010 im Königspalast von Qatna. Vorbericht des syrisch-deutschen Kooperationsprojektes in Tall Mišrife/Qatna. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 143: 5-62
Donbaz, V., N. Yoffee (1986). Old Babylonian Texts from Kish Conserved in the Istanbul Archaeological Museum. Malibu.
Driel, G., Driel-Murray van (1979). Jebel Aruda 1977-1978. Akkadica 12: 2-28
- (1983). Jebel Aruda, the 1982 Season of Excavation, Interim Report (1). Akkadica 33: 1-26
Dunham, S. (1986). Sumerian Words for Foundation. Part I: Temen. Revue d'assyriologie et d'archéologie orientale 80: 31-64
- (2005). Ancient Near East Architecture. In: A Companion to the Ancient Near East Ed. by D. C. Snell. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publ 266-280
Edzard, D. O. (1972–1975). Haus. A. Philologisch. In: Reallexikon der Assyriologie 4 Ed. by E. Ebeling, B. Meissner. Berlin, New York: Walter de Gruyter 220-224
- (1991). Geschichte: Sumer und Akkad. In: Der Alte Orient. Geschichte und Kultur des alten Vorderasien Ed. by B. Hrouda. Gütersloh: C. Bertelsmann 55-84
Eichmann, R. (1991). Aspekte prähistorischer Grundrißgestaltung in Vorderasien. Mainz: Philipp von Zabern.
- (2007). Uruk. Architektur I. Von den Anfängen bis zur frühdynastischen Zeit. Rahden, Westf.: Verlag Marie Leidorf.
- (2013). Frühe Großarchitektur der Stadt Uruk. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 117-127
Eickhoff, T. (1985). Kar-Tukulti-Ninurta. Eine mittelassyrische Kult- und Residenzstadt. Berlin: Gebr. Mann Verlag.
Ellis, R. S. (1968). Foundation Deposits in Ancient Mesopotamia. New Haven, London: Yale University Press.
Elsen-Novák, G., M. Novák (2006a). Der „König der Gerechtigkeit“ – Zur Ikonologie und Teleologie des ‚Codex‘ Hammurapi. Baghdader Mitteilungen 37: 131-155
- (2006b). Fundamentierungstechniken im Palast von Qatna. In: Timelines. Studies in Honour of Manfred Bietak III Ed. by E. Czerny, I. Hein, I. H.. Orientalia Lovaniensia Analecta 149. Löwen, Paris, Dudley: Peeters Publishers 63-71
Ess, M. (2001). Uruk. Architektur II. Von der Akkad- bis zur mittelbabylonischen Zeit. Teil 1. Das Eanna-Heiligtum zur Ur III- und altbabylonischen Zeit. Mainz: Verlag Marie Leidorf.
- (2012). Stiftmosaik. In: Reallexikon der Assyriologie 13 Ed. by M. P. Streck. Berlin, New York: Walter de Gruyter 184-186
- (2013a). Die Technik der Tonstiftmosaiken. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 128-129
- (2013b). Bautechnische Beobachtungen in Uruk. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 232-233
- (2013c). Der Bau des Eanna-Heiligtums in Uruk. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 225-231
- (2013d). Altorientalische Grundsteinlegung. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 80-81
Ess, M., Neef van (2013a). Bauholz für die Tempel. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 58-59
- (2013b). Rohstoff Schilf. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 114-115
Ess, M., Pedde van (1992). Uruk. Kleinfunde II. Metall und Asphalt, Farbreste, Fritte/Fayence, Glas, Holz, Knochen/Elfenbein, Leder, Muschel/Perlmutt/Schnecke, Schilf. Mainz: Philipp von Zabern.
Fadhil, A. (1993). Erdbeben im Alten Orient. Baghdader Mitteilungen 24: 271-278
Faist, B. (2006). Zur Häusertypologie in Emar. Archäologie und Philologie im Dialog. Baghdader Mitteilungen 37: 471-480
Falkenstein, A. (1966a). Sumerische Bauausdrücke. Orientalia Nova Series 35: 229-246
- (1966b). Die Inschriften Gudeas von Lagaš I: Einleitung. Rom: Pontificium Institutum Biblicum.
Farber, G. (1989). al-tar im Edubba. Notwendige Arbeitsgänge beim Bau eines Schulhauses. In: DUMU-E Ed. by H. Behrens, D. Loding, D. L.. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum 137-147
Farber-Flügge, G. (1973). Der Mythos „Inanna und Enki“ unter besonderer Berücksichtigung der Liste der me. Rom: Biblical Institute Press.
Forest, J.-D. (1987). La grande architecture obeidienne: sa forme et sa fonction. In: Préhistoire de la Mésopotamie. La Mésopotamie préhistorique et l'exploration récente du djebel Hamrin. Colloque international du CNRS, Paris 17–19 décembre 1984 Ed. by J.-L. Huot. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique 385-423
Foster, B. R. (1982). Umma in the Sargonic Period. Hamden: Archon.
Frank, D. R. (1975). Versuch zur Rekonstruktion von Bauregeln und Maßordnung einer nordsyrischen Stadt des vierten Jahrtausends. Untersucht anhand von Grabungsergebnissen der Deutschen Orient-Gesellschaft in Habūba Kabīra. Ernst Heinrich zum 75. Geburtstag. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 107: 7-16
Frankfort, H. (1996). The Art and Architecture of the Ancient Orient. New Haven, London: Yale University Press.
Frayne, D. (1990). Old Babylonian Period (2003-1595 BC). Toronto: University of Toronto Press.
Freydank, H. (1975). Die Rolle der Deportierten im mittelassyrischen Staat. In: Die Rolle der Volksmassen in der Geschichte der vorkapitalistischen Gesellschaftsformationen Ed. by J. Hermann, I. Sellnow. Berlin: Akademie-Verlag 55-63
Friberg, J. (2001). Bricks and Mud in Metro-Mathematical Cuneiform Texts. In: Changing Views on Ancient Near Eastern Mathematics Ed. by J. Høyrup, P. Damerow. Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 19. Berlin: Reimer 61-154
- (2013). Dreitausend Jahre Mathematik in Keilschrifttexten. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 240-241
Fujii, Hrsg. (1981). Preliminary Report of Excavations at Gubba and Songor. Al Rafidan 2: 3-242
Garelli, P. (1969). Le Proche-Orient asiatique. Des origines aux invasions des peuples de la mer. Paris: Presses universitaires de France.
Garelli, P., V. Nikiprowetzky (1974). Le Proche-Orient asiatique. Les empires mésopotamiens, Israël. Paris: Presses universitaires de France.
Gelb, I. J. (1979). Household and Family in Early Mesopotamia. In: State and Temple Economy in the Ancient Near East Ed. by E. Lipinski. Orientalia Lovaniensia Analecta 5, 1. Löwen: Peeters Publishers 1-97
Gelb, I. J., B. Kienast (1990). Die altakkadischen Königsinschriften des dritten Jahrtausends v. Chr.. Stuttgart: Franz Steiner.
George, A. R. (1992). Babylonian Topographical Texts. Löwen: Peeters Publishers.
- (1993). House Most High. The Temples of Ancient Mesopotamia. Winona Lake: Eisenbrauns.
- (2008). The Truth about Etemenanki, the Ziggurat of Babylon. In: Babylon. Myth and Reality Ed. by I. L. Finkel, M. J. Seymour. London: British Museum 126-130
Gibson, McG. (1981). Uch Tepe I. Chicago, Kopenhagen: The Oriental Institute.
- (1987a). The Round Building at Tell Razuk: Form and Function. In: Préhistoire de la Mésopotamie. La Mésopotamie préhistorique et l'exploration récente du djebel Hamrin. Colloque international du CNRS, Paris 17–19 décembre 1984 Ed. by J.-L. Huot. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique 467-474
- (1987b). Le Protodynastique I. Synthèse de la séance. In: Préhistoire de la Mésopotamie. La Mésopotamie préhistorique et l'exploration récente du djebel Hamrin. Colloque international du CNRS, Paris 17–19 décembre 1984 Ed. by J.-L. Huot. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique 499-503
- (1990). Uch Tepe II. Chicago, Kopenhagen: The Oriental Institute.
Gilibert, A. (2004). Jenseits von Stil und Ikonographie. Späthethitische Einflüsse auf das assyrische Wandrelief. In: Die Außenwirkung des späthethitischen Kulturraumes. Güteraustausch – Kulturkontakt – Kulturtransfer. Akten der zweiten Forschungstagung des Graduiertenkollegs „Anatolien und seine Nachbarn“ der Eberhard-Karls-Universität Tübingen (20. bis 22. November 2003) Ed. by M. Novák, F. Prayon, F. P.. Alter Orient und Altes Testament 323. Münster: Ugarit-Verlag 373-385
de Graef, K. (2011). Rezension zu . Bibliotheca Orientalis LXVIII: 174-179
Grayson, A. K. (1972). Assyrian Royal Inscriptions. From the Beginning to Ashur-resha-ishi I.. Wiesbaden: Harrassowitz.
- (1976). Assyrian Royal Inscriptions. From Tiglath-pileser I to Ashur-nasir-apli II. Wiesbaden: Harrassowitz.
Gurdil, B. (2005) Architecture and Social Complexity in the Late Ubaid Period: A Study of the Built Environment of Değirmentepe in East Anatolia. phdthesis. University of California, Los Angeles
Gut, R. V. (1995). Das prähistorische Ninive. Zur relativen Chronologie der frühen Perioden Nordmesopotamiens. Mainz: Philipp von Zabern.
- (2002). The Significance of the Uruk Sequence at Nineveh. In: Artefacts of Complexity: Tracking the Uruk in the Near East Ed. by J. N. Postgate. Iraq Archaeological Reports 5. Warminster: David Brown Book Company 17-48
Hausleiter, A., H. J. Nissen (2002). Überdachung. Alter Orient und Ägypten. In: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike 12/1 Stuttgart, Weimar: Metzler 963-964
Heimpel, W. (2009). Workers and Construction Work at Garšana. Bethesda: CDL Press.
Heinrich, E. (1931). Fara. Ergebnisse der Ausgrabungen der Deutschen-Orient-Gesellschaft in Fara und Abu Hatab 1902/03. Berlin: Vorderasiatische Abteilung der Staatlichen Museen.
- (1957). Bauwerke in der Altsumerischen Bildkunst. Wiesbaden: Harrassowitz.
- (1957–1971). Gewölbe. In: Reallexikon der Assyriologie 3 Ed. by E. Ebeling, B. Meissner. Berlin, New York: Walter de Gruyter 323-340
- (1972–1975). Haus. B. Archäologisch. In: Reallexikon der Assyriologie 4 Ed. by E. Ebeling, B. Meissner. Berlin, New York: Walter de Gruyter 176-220
- (1976). Der Sturz Assurs und die Baukunst der Chaldäerkönige in Babylon. Archäologischer Anzeiger 1976: 166-180
- (1982). Die Tempel und Heiligtümer im alten Mesopotamien: Typologie, Morphologie und Geschichte. Berlin: Walter de Gruyter.
- (1984). Die Paläste im alten Mesopotamien. Berlin: Walter de Gruyter.
Heinrich, E., U. Seidl (1967). Grundrißzeichnungen aus dem Alten Orient. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 98: 24-45
- (1968). Maß und Übermaß in der Dimensionierung von Bauwerken im alten Zweistromland. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 99: 5-54
Heinz, M. (2002). Altsyrien und Libanon. Geschichte, Wirtschaft und Kultur vom Neolithikum bis Nebukadnezar. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Heisel, J. P. (1993). Antike Bauzeichnungen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Hemker, C. (1993). Altorientalische Kanalisation. Untersuchungen zu Be- und Entwässerungsanlagen im mesopotamisch-syrisch-anatolischen Raum. Münster: Agenda.
Hockmann, D. (2010). Gräber und Grüfte in Assur I. Von der zweiten Hälfte des 3. bis zur Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr.. Wiesbaden: Harrassowitz.
Horne, L. (1994). Village Spaces. Settlement and Society in Northeastern Iran. Washington/DC, London: Smithsonian Institution Press.
Houben, H., H. Guillaud (1989). Traité de construction en terre. Marseille: Éditions Parenthèses.
Hruška, B. (1999). Zum Gründungsritual im Tempel Eninnu. In: Munuscula Mesopotamica. Festschrift für Johannes Renger Ed. by B. Böck, E. Cancik-Kirschbaum, E. CK.. Alter Orient und Altes Testament 267. Münster: Ugarit-Verlag 217-228
Huot, J.-L. (1991). Les travaux français à Tell el 'Oueili et Larsa. Un bilan provisoire. Akkadica 73: 1-32
Jacobsen, T., S. Lloyd (1935). Sennacherib's Aquaeduct at Jerwan. Chicago: University of Chicago Press.
Jahn, B. (2005). Altbabylonische Wohnhäuser. Eine Gegenüberstellung philologischer und archäologischer Quellen. Rahden, Westf.: Verlag Marie Leidorf.
Joannès, F. (1982). Textes économiques de la Babylonie récente. Paris: Éditions Recherche sur les civilisations.
- (1989). Archives de Borsippa. La famille Ea-ilûta-bâni. Étude d'un lot d'archives familiales en Babylonie du VIIIe au Ve siècle av. J.-C.. Genf: Librairie Droz.
Johansen, F. (1978). Statues of Gudea Ancient and Modern. Kopenhagen: Akademisk Forlag.
Keetman, J. (2011). Eine als Ziqqurrat gedeutete Skizze einer Treppenanlage. Iraq 73: 169-176
Kessler, K. (1991). Geschichte: Die Assyrer – Babylonien im 2. und 1. Jahrtausend – Das Reich der Achämeniden. In: Der Alte Orient. Geschichte und Kultur des alten Vorderasien Ed. by B. Hrouda. Gütersloh: C. Bertelsmann 112-185
Kohlmeyer, K. (1996). Houses in Habuba Kabira-South. Spatial Organisation and Planning of Late Uruk Residential Architecture. In: Houses and Households in Ancient Mesopotamia. Papers Read at the 40th Rencontre Assyriologique Internationale Leiden, July 5–8, 1993 Ed. by K. R. Veenhof. Istanbul, Leiden: Nederlands historisch-archeologisch instituut te Istanbul 89-103
Koldewey, R. (1931). Die Königsburgen von Babylon I. Die Südburg. Leipzig: Hinrichs.
Lackenbacher, S. (1982). Le roi bâtisseur: Les récits de construction assyriens des origines à Teglatphalasar III. Paris: Éditions Recherche sur les civilisations.
- (1990). Le palais sans rival. Le rècit de construction en Assyrie. Paris: Éditions de la Découverte.
Lebeau, M. (2006). Les temples de Tell Beydar et leur environment immédiat à l'époque Early Jezirah IIIb. In: Les espaces syro-mésopotamiens, Dimensions de l'expérience humaine au Proche-Orient ancien, Volume d'hommage offert à Jean-Claude Margueron Ed. by P. Butterlin, M. Lebeau, M. L.. Subartu 17. Turnhout: Brepols Publishers 101-140
Leick, G. (1988). A Dictionary of Ancient Near Eastern Architecture. London: Routledge.
Linder, E. (1986). The Khorsabad Wall Relief: A Mediterranean Seascape or River Transport of Timbers?. Journal of the American Oriental Society 106: 273-281
Liverani, M. (1993). Akkad, the First World Empire: Structure, Ideology, Traditions. Padua: Sargon.
Lloyd, S. (1974). Abu Shahrein. A Memorandum. Iraq 36: 129-138
Lloyd, S., F. Safar (1943). Tell Uqair: Excavations by the Iraq Government Directorate of Antiquities in 1940 and 1941. Journal of Near Eastern Studies 2: 131-158
Loud, G., C. B. Altman (1938). Khorsabad II: The Citadel and the Town. Chicago: University of Chicago Press.
Ludwig, W. (1980). Maß, Sitte und Technik des Bauens in Habuba Kabira-Süd. In: Le Moyen Euphrate. Zone de contacts et d'échanges. Actes du Colloque de Strasbourg 10–12 mars 1977 Ed. by J. Margueron. Straßburg: Université des sciences humaines de Strasbourg 63-74.
Lundström, S. (2003). „Es klagen die großen Kanäle…“. Die Königsgrüfte im Alten Palast von Assur. In: Wiedererstehendes Assur. 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien Ed. by J. Marzahn, B. Salje. Mainz: Philipp von Zabern 129-135
Lupton, A. (1996). Stability and Change. Socio-Political Development in North Mesopotamia and South-East Anatolia 4000–2700 B.C.. Oxford: Tempus Reparatum.
Mackay, E. (1929). A Sumerian Palace and the ‚A‘ Cemetery at Kish, Mesopotamia. Chicago: Field Museum of Natural History.
Mallowan, M. E. L. (1947). Excavations at Brak and Chagar Bazar. Iraq 9: 1-259
- (1966). Nimrud and its Remains. London: Dodd, Mead.
- (1978). Samaria and Calah-Nimrud: Conjunctions in History and Archaeology. In: Archaeology in the Levant. Essays for Kathleen Kenyon Ed. by R. Moorey, P. J. Parr. Warminster: Aris & Phillips 155-161
Marchetti, N., L. Nigro (1997). Cultic Activities in the Sacred Area of Ishtar at Ebla during the Old Syrian Period: The Favissae F.5327 and F.5238. Journal of Cuneiform Studies 49: 1-44
Margueron, J.-C. (1982). Recherches sur les palais mésopotamiens de l'âge du bronze. Paris: Libr. Orientaliste P. Geuthner.
- (1985). Notes d'archéologie et d'architecture orientales 4. Propos sur le sillon destructeur (étude de cas). Syria 62: 1-20
- (1987). Quelques remarques concernant l'architecture monumentale à l'époque d'Obeid. In: Préhistoire de la Mésopotamie. La Mésopotamie préhistorique et l'exploration récente du djebel Hamrin. Colloque international du CNRS, Paris 17–19 décembre 1984 Ed. by J.-L. Huot. Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique 349-377
- (1992). Le bois dans l'architecture: Premier essai pour une estimation des besoins dans le bassin mésopotamien. Bulletin on Sumerian Agriculture VI: 79-96.
- (1997a). Larsa. In: The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East 3 Ed. by E. M. Meyers. Oxford: Oxford University Press 331-333
- (1997b). Mari. In: The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East 3 Ed. by E. M. Meyers. Oxford: Oxford University Press 413-417
- (1999). Du plan au volume: les bases méthodologiques de la restitution architecturale. In: Fluchtpunkt Uruk. Archäologische Einheit aus methodischer Vielfalt. Schriften für Hans Jörg Nissen Ed. by H. Kühne, R. Bernbeck, R. B.. Rahden, Westf.: Verlag Marie Leidorf 191-200
- (2004). Mari. Métropole de l'Euphrate au IIIe et au début du IIe millénaire av. J.-C.. Paris: Picard.
Martin, H. P. (1988). Fara: A Reconstruction of the Ancient Mesopotamian City of Shuruppak. Birmingham: Chris Martin & Assoc..
Martino, S. (2004). A Tentative Chronology of the Kingdom of Mittani from its Rise to the Reign of Tušratta. In: Mesopotamian Dark Age Revisited. Proceedings of an International Conference of SCIEM 2000 (8 Ed. by H. Hunger, R. Pruzsinsky. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 35-42
Matthews, D. M. (1995). Artisans and Artists in Ancient Western Asia. In: Civilizations of the Ancient Near East I Ed. by J. M. Sasson. New York: Scribner 455-486
Matthiae, P. (1995). Ebla. Un impero ritrovato. Dai primi scavi alle ultime scoperte. Turin: Einaudi.
Maul, S. M. (1997). Die altorientalische Hauptstadt. Abbild und Nabel der Welt. In: Die orientalische Stadt: Kontinuität, Wandel, Bruch Ed. by G. Wilhelm. Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft 1. Saarbrücken: Deutsche Orient-Gesellschaft 109-124
McMahon, A. (2009). Once There Was a Place: Settlement Archaeology at Chagar Bazar, 1999–2002. London: British Institute for the Study of Iraq.
Meuszyński, J. (1981). Die Rekonstruktion der Reliefdarstellungen und ihrer Anordnung im Nordwestpalast von Kalhu (Nimrud). Mainz: Philipp von Zabern.
Meyer, J.-W. (2007). Town Planning in 3rd Millennium Tell Chuera. In: Power and Architecture. Monumental Public Architecture in the Bronze Age Near East and Aegean. Proceedings of the International Conference Power and Architecture Organized by the Katholieke Universiteit Leuven, the Université Catholique de Louvain and the Westfälische Wilhelms-Universität Münster on the 21st and 22nd of November 2002 Ed. by J. Bretschneider, J. Driessen, J. D.. Orientalia Lovaniensia Analecta 156. Löwen, Paris, Dudley: Peeters Publishers 129-142.
Mielke, D. P. (2011a). Stadtmauer. B. Archäologisch. In: Reallexikon der Assyriologie 13 Ed. by M. P. Streck. Berlin, New York: Walter de Gruyter 80-85
- (2011b). Stadttor. C. Archäologisch. In: Reallexikon der Assyriologie 13 Ed. by M. P. Streck. Berlin, New York: Walter de Gruyter 91-97
Mieroop, M. (1997). The Ancient Mesopotamian City. Oxford: Oxford University Press.
- (2004). A History of the Ancient Near East ca. 3000–323BC. Malden, Oxford, Melbourne, Berlin: Wiley-Blackwell.
Miglus, P. A. (1989). Untersuchungen zum Alten Palast in Assur. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 121: 93-133
- (1999). Städtische Wohnarchitektur in Babylonien und Assyrien. Mainz: Philipp von Zabern.
- (2001). Nischen, „Nischenarchitektur'“. In: Reallexikon der Assyriologie 9 Ed. by E. Ebeling, B. Meissner. Berlin, New York: Walter de Gruyter 585-589
Moorey, P. R. S. (1978). Kish Excavations 1923–1933. With a Microfiche Catalogue of the Objects in Oxford Excavated by the Oxford Field Museum, Chicago Expedition to Kish in Iraq, 1923-1933. Oxford: Clarendon Press.
- (1990). From Gulf to Delta in the Fourth Millennium BCE – The Syrian Connection. Eretz-Israel 21: 62-69
- (1994). Ancient Mesopotamian Materials and Industries. The Archaeological Evidence. Oxford: Clarendon Press.
Moortgart, A. (1962). Tell Chuera in Nordost-Syrien. Vorläufiger Bericht über die dritte Grabungskampagne 1960. Köln, Opladen: Westdeutscher Verlag.
Muller, B. (2002). Les „maquettes architecturales“ du Proche-Orient ancien. Mésopotamie, Syrie, Palestine du IIIe au milieu du Ier millénaire av. J.-C.. Beirut: Institut français d'archéologie du Proche-Orient.
Muller, B., D. Vaillancourt (2001). Maquettes architecturales de l'antiquité. Regards croisés (Proche-Orient, Égypte, Chypre, bassin égéen et Grèce, du Néolithique à l'époque hellénistique). Actes du Colloque de Strasbourg, 3–5 décembre 1998. Paris: E. de Boccard.
Nagel, W. (1958). Meister- und Gesellenarbeit an neuassyrischen Reliefs. Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts 73: 1-8
Nemet-Nejat, K. R. (1993). Cuneiform Mathematical Texts as a Reflection of Everyday Life in Mesopotamia. New Haven: American Oriental Society.
Neumann, H. (1989). Umma and Nippur in altakkadischer Zeit. Orientalistische Literaturzeitung 84: 517-527
- (1992). Bemerkungen zum Problem der Fremdarbeit in Mesopotamien (3. Jt. v. u. Z.).. Altorientalische Forschungen 19: 266-275
- (1993). Handwerk in Mesopotamien. Untersuchungen zu seiner Organisation in der Zeit der III. Dynastie von Ur. Berlin: Akademie-Verlag.
- (1996). Der sumerische Baumeister (šidim). In: Houses and Households in Ancient Mesopotamia. Papers Read at the 40th Rencontre Assyiologique Internationale Leiden, July 5–8, 1993 Ed. by K. R. Veenhof. Uitgaven van het Nederlands historisch-archaeologisch instituut te Istanbul 78. Istanbul, Leiden: Nederlands historisch-archeologisch instituut te Istanbul 153-169
Nippa, A. (1991). Haus und Familie in arabischen Ländern. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart. München: C.H. Beck.
Nissen, H. J. (1988). The Early History of the Ancient Near East, 9000-2000 B. C.. Chicago, London: University of Chicago Press.
- (2006). Machtarchitektur im frühen Babylonien. Baghdader Mitteilungen 37: 61-68
Nissen, H. J., P. Damerow, P. D. (1990). Frühe Schrift und Techniken der Wirtschaftsverwaltung im alten Vorderen Orient. Informationsspeicherung und -verarbeitung vor 5000 Jahren. Berlin: Verlag Franzbecker.
Nöldeke, A., E. Heinrich, E. H. (1934). Fünfter vorläufiger Bericht über die von der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft in Uruk-Warka unternommenen Ausgrabungen. Berlin: Walter de Gruyter.
Novák, M., P. Pfälzner (2000). Ausgrabungen in Tall Mišrife – Qatna 1999. Vorbericht der deutschen Komponente des internationalen Kooperationsprojektes. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 132: 253-295
Novák, M., J. Schmid (2001). Zur Problematik von Lehmziegelgewölben. Konstruktionstechniken und Verfahren zur Analyse am Beispiel von Gewölbebauten im ‚Roten Haus‘ in Dur-Katlimmu/Magdalu. Baghdader Mitteilungen 32: 205-253
Novák, M. (1994). Eine Typologie der Wohnhäuser von Nuzi. Baghdader Mitteilungen 25: 341-446
- (1999). Herrschaftsform und Stadtbaukunst. Programmatik im mesopotamischen Residenzstadtbau von Agade bis Surra man ra'a. Saarbrücken: Harrassowitz.
- (2004). Hilani und Lustgarten. Ein „Palast des Hethiter-Landes“ und ein „Garten nach dem Abbild des Amanus“ in Assyrien. In: Die Außenwirkung des späthethitischen Kulturraumes. Güteraustausch – Kulturkontakt – Kulturtransfer. Akten der zweiten Forschungstagung des Graduiertenkollegs „Anatolien und seine Nachbarn“ der Eberhard-Karls-Universität Tübingen (20. bis 22. November 2003) Ed. by M. Novák, F. Prayon, F. P.. Alter Orient und Altes Testament 323. Münster: Ugarit-Verlag 335-372
- (2012). Die architektonische Raumgestaltung als Kommunikationsform. In: Wissenskultur im Alten Orient. Weltanschauung, Wissenschaften, Techniken, Technologien. 4. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 20.–22. Februar 2002, Münster Ed. by H. Neumann. Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft 4. Wiesbaden: Harrassowitz 283-305
Nunn, A. (1988). Die Wandmalerei und der glasierte Wandschmuck im Alten Orient. Leiden, New York, Kopenhagen, Köln: Brill.
Oates, D., J. Oates (2001a). The Excavations. In: Excavations at Tell Brak 2: Nagar in the Third Millennium BC Ed. by D. Oates, J. Oates, J. O.. Cambridge, London: McDonald Institute for Archaeology 15-98
- (2006). Tripartite Buildings and Early Urban Tell Brak. Subartu 17: 33-40
Oates, J., D. Oates (2001b). Nimrud. An Assyrian Imperial City Revealed. London: British School of Archaeology in Iraq.
Oates, D. (1967). The Excavations at Tell al-Rimah, 1966. Iraq 29: 70-96
- (1970). The Excavations at Tell al-Rimah, 1968. Iraq 32: 1-26
- (1973). Early Vaulting in Mesopotamia. In: Archaeological Theory and Practice Ed. by D. E. Strong. London, New York: Academic Press 183-191
- (1990). Innovations in Mud-brick: Decorative and Structural Techniques in Ancient Mesopotamia. World Archaeology 21: 388-406
Oates, J. (2002). Tell Brak: The 4. In: Artefacts of Complexity: Tracking the Uruk in the Near East Ed. by J. N. Postgate. Iraq Archaeological Reports 5. Warminster: Aris & Phillips 111-122
- (2007). Monumental Public Architecture in Late Chalcolithic and Bronze Age Mesopotamia, with Particular Reference to Tell Brak and Tell al Rimah. In: Power and Architecture. Monumental Public Architecture in the Bronze Age Near East and Aegean. Proceedings of the International Conference Power and Architecture Organized by the Katholieke Universiteit Leuven, the Université Catholique de Louvain and the Westfälische Wilhelms-Universität Münster on the 21st and 22nd of November 2002 Ed. by J. Bretschneider, J. Driessen, J. D.. Orientalia Lovaniensia Analecta 156. Löwen, Paris, Dudley: Peeters Publishers 161-181
Oded, B. (1979). Mass Deportations and Deportees in the Neo-Assyrian Empire. Wiesbaden: Ludwig Reichert.
Opificius, R. (1964). Befestigungen des Zweistromlandes im Beginn des zweiten Jahrtausends. Baghdader Mitteilungen 3: 78-90
Orthmann, W. (1975). Der Alte Orient. Berlin: Propyläen.
- (1976). Mumbaqat 1974. Vorläufiger Bericht über die von der Deutschen Orient-Gesellschaft mit Mitteln der Stiftung Volkswagenwerk unternommenen Ausgrabungen. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 108: 25-44
Otto, A. (2006). Alltag und Gesellschaft zur Spätbronzezeit: Eine Fallstudie aus Tall Bazi (Syrien). Turnhout: Brepols Publishers.
Owen, D. I., R. H. Mayr (2007). The Garshana Archives. Bethesda: CDL Press.
Paley, S. M., R. P. Sobolewski (1987). The Reconstruction of the Relief Representations and their Positions in the Northwest-Palace at Kalhu (Nimrud) II. Rooms I. S. T. Z, West-Wing. Mainz: Philipp von Zabern.
- (1992). The Reconstruction of the Relief Representations and their Positions in the Northwest-Palace at Kalhu (Nimrud) III. The Principal Entrances and Courtyards. Mainz: Philipp von Zabern.
Parker, B. J. (2006). Rezension zu Postgate (2002). Bibliotheca Orientalis LXIII: 155-162
Parpola, S. (1995). The Construction of Dur-Šarrukin in the Assyrian Royal Correspondence. In: Khorsabad, le palais de Sargon II, roi d'Assyrie. Actes du colloques organisé au musée du Louvre par le Service culturel les 21 et 22 janvier 1994 Ed. by A. Caubet. Paris: Documentation française 47-77
Pedde, F. (2003). Der Palast der Väter. Die Ausgrabung des Alten Palastes. In: Wiederstehendes Assur. 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Assyrien Ed. by J. Marzahn, B. Salje. Mainz: Philipp von Zabern 119-128
Pedde, F., M. Heinz, M. H. (2000). Uruk. Kleinfunde IV. Metall- und Steinobjekte im Vorderasiatischen Museum zu Berlin. Mainz: Philipp von Zabern.
Pedde, F., S. Lundström (2008). Der Alte Palast in Assur. Architektur und Baugeschichte. Wiesbaden: Harrassowitz.
Petschow, H. (1965). Zur Systematik und Gesetzestechnik im Codex Hammurabi. Zeitschrift für Assyriologie 57: 146-172
- (1957–1971). Gesetze. Der Codex Hammurabi (CH). In: Reallexikon der Assyriologie 3 Ed. by E. Ebeling, B. Meissner. Berlin, New York: Walter de Gruyter 255-269
- (1980–1983). Lehrverträge. In: Reallexikon der Assyriologie 6 Ed. by E. Ebeling, B. Meissner. Berlin, New York: Walter de Gruyter 556-570
Pfälzner, P. (1997). Wandel und Kontinuität im Urbanisierungsprozeß des 3. Jtsds. v. Chr. in Nordmesopotamien. In: Die orientalische Stadt: Kontinuität, Wandel, Bruch. 1. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 9.–10. Mai 1996 in Halle/Saale Ed. by G. Wilhelm. Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft 1. Saarbrücken: Harrassowitz 239-265.
- (2001). Haus und Haushalt. Wohnformen des dritten Jahrtausends vor Christus in Nordmesopotamien. Mainz: Philipp von Zabern.
- (2008). Das Tempeloval von Urkeš. Betrachtungen zur Typologie und Entwicklungsgeschichte der mesopotamischen Ziqqurrat im 3. Jt. v. Chr.. Zeitschrift für Orient-Archäologie 1: 396-433
- (2009a). Wolkenkratzer aus der Bronzezeit. Antike Welt 1/09: 4
- (2009b). Macht und Reichtum in der Königsresidenz. In: Schätze des Alten Syrien. Die Entdeckung des Königreichs Qatna Ed. by M. al-Maqdissi, D. Morandi Bonacossi, D. M.B.. Stuttgart: Theiss Verlag 165-171
- (2009c). Die Wasserversorgung der Herrscher. In: Schätze des Alten Syrien. Die Entdeckung des Königreichs Qatna Ed. by M. al-Maqdissi, D. Morandi Bonacossi, D. M.B.. Stuttgart: Theiss Verlag 175
Pollock, S. (1999). Ancient Mesopotamia. The Eden That Never Was. Cambridge: Cambridge University Press.
- (2013). Differenzierung und Klassifizierung in Gesellschaften des 4. und 3. Jahrtausends v. Chr.. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 149-155
Porter, A. (2012). Mobile Pastoralism and the Formation of Near Eastern Civilizations. Weaving Together Society. Cambridge: Cambridge University Press.
Porter, A., T. L. McClellan (2006). Rezension zu Muller 2002. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 344: 91-92
Porter, B. N. (2003). Trees, Kings, and Politics. Studies in Assyrian Iconography. Freiburg, Göttingen: Academic Press Fribourg/Paulusverlag, Vandenhoeck & Ruprecht.
Postgate, J. N. (1992). Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History. London, New York: Routledge.
Potts, D. T. (2013). Handel im frühen Alten Orient. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 255-261
Powell, M. A. (1982). Metrological Notes on the Esagila Tablet and Related Matters. Appendix II: Bricks as Evidence for Metrology. Zeitschrift für Assyriologie 72: 116-123
- (1987–1990). Maße und Gewichte. In: Reallexikon der Assyriologie 7 Ed. by E. Ebeling, B. Meissner. Berlin, New York: Walter de Gruyter 457-517
Preusser, C. (1955). Die Paläste in Assur. Berlin: Gebr. Mann Verlag.
Pütt, K. (2005). Zelte, Kuppeln und Hallenhäuser. Wohnen und Bauen im ländlichen Syrien. Petersberg: Imhof.
Radner, K. (1997). Die neuassyrischen Privatrechtsurkunden als Quelle für Mensch und Umwelt. Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project.
- (2005). Die Macht des Namens. Altorientalische Strategien zur Selbtsterhaltung. Wiesbaden: Harrassowitz.
Rashid, S. A. (1983). Gründungsfiguren im Iraq. München: C.H. Beck.
Reade, J. (1995). The Khorsabad Glazed Bricks and their Symbolism. In: Khorsabad, le palais de Sargon II, roi d'Assyrie. Actes du colloque organisé au musée du Louvre par le Service culturel les 21 et 22 janvier 1994 Ed. by A. Caubet. Paris: Documentation françáise 225-251
- (2009). Rezension zu . Bibliotheca Orientalis LXVI: 653-656
Renette, S. (2009). A Reassessment of the Round Buildings in the Hamrin Valley (Central Iraq) during the Early Third Millennium BC. Paléorient 35/2: 79-98
Renger, J. (1990). Rivers, Watercourses and Irrigation Ditches. Bulletin on Sumerian Agriculture V: 31-46.
Roaf, M. (2012). The Fall of Babylon in 1499 NC or 1595 MC. Akkadica 133: 147-174
Robson, E. (1996). Building with Bricks and Mortar. Quantity Surveying in the Ur III and Old Babylonian Periods. In: Houses and Households in Ancient Mesopotamia. Papers Read at the 40th Rencontre Assyriologique Internationale Leiden, July 5–8, 1993 Ed. by K. R. Veenhof. Leiden, Istanbul: Nederlands historisch-archeologisch instituut te Istanbul 181-190
- (1999). Mesopotamian Mathematics 2100-1600 BC. Technical Constants in Bureaucracy and Education. Oxford: Clarendon Press.
Rösner, U. (1991). Naturraum. In: Der Alte Orient. Geschichte und Kultur des alten Vorderasien Ed. by B. Hrouda. Gütersloh: C. Bertelsmann 11-33
Rouault, O. (2004). Rezension zu Muller – Vaillancourt (2001). Syria 81: 271-276
Russell, J. M. (1992). Sennacherib's Palace without Rival at Niniveh. Chicago, London: University Of Chicago Press.
- (1998). The Program of the Palace of Assurnasirpal II at Nimrud. Issues in the Research and Presentation of Assyrian Art. American Journal of Archaeology 102: 655-715
Safar, F., M. A. Mustafa, M.A. M. (1981). Eridu. Baghdad: Republic of Iraq, Ministry of CultureInformation, State Organization of AntiquitesHeritage.
Saggs, H. W. F. (2005). Völker im Lande Babylon. Stuttgart: Theiss Verlag.
Sallaberger, W. (1997). Nippur als religiöses Zentrum Mesopotamiens im historischen Wandel. In: Die orientalische Stadt: Kontinuität, Wandel, Bruch. 1. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 9.–10. Mai 1996 in Halle/Saale Ed. by G. Wilhelm. Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft 1. Saarbrücken: SDV 147-168.
- (2004). Relative Chronologie von der späten frühdynastischen bis zur altbabylonischen Zeit. In: 2000 v. Chr. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklungen im Zeichen einer Jahrtausendwende. 3. Internationales Colloquium der Deutschen Orient-Gesellschaft 4.–7. April 2000 in Frankfurt a. M. und Marburg a. d. Lahn Ed. by J.-W. Meyer, W. Sommerfeld. Colloquien der Deutschen Orient-Gesellschaft 3. Saarbrücken: SDV 15-43
Salonen, A. (1972). Die Ziegeleien im alten Mesopotamien. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.
Sarzec, E. de (1884). Découvertes en Chaldée. Paris: E. Leroux.
Sauvage, M. (1992). L'utilisation de la voûte dans l'habitat à Mohammed Diyab. In: Recherches en Haute Mésopotamie – Tell Mohammed Diyab, Campagnes 1990 et 1991 Ed. by J.-M. Durand. Mémoires de Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires 2. Paris: Société pour l'étude du Proche-Orient ancien 23-30
- (1998). La brique et sa mise en oeuvre en Mésopotamie. Paris: Éditions Recherche sur les civilisations.
- (1999). La construction des ziggurats sous la troisième dynastie d'Ur. Iraq 60: 45-63
Schachner, A. (2007). Bilder eines Weltreichs. Kunst- und kulturgeschichtliche Untersuchungen zu den Verzierungen eines Tores aus Balawat (Imgur-Enlil) aus der Zeit Salmanassars III., König von Assyrien. Turnhout: Brepols Publishers.
Schmid, H. (1985). Der Tempelplan IM 44036,1 – Schema oder Bauplan?. Orientalia Nova Series 54: 289-293
- (1992). Zur inneren Organisationsform früher mesopotamischer Palastbauten. In: Von Uruk nach Tuttul. Eine Festschrift für Eva Strommenger. Studien und Aufsätze von Kollegen und Freunden Ed. by B. Hrouda, S. Kroll, S. K.. Münchener Vorderasiatische Studien 12. München, Wien: Profil 185-192.
- (1995). Der Tempelturm Etemenanki in Babylon. Mainz: Philipp von Zabern.
- (1999). Vorderasiatische Archäologie und Bauforschung. In: Fluchtpunkt Uruk. Archäologische Einheit aus methodischer Vielfalt. Schriften für Hans Jörg Nissen Ed. by H. Kühne, R. Bernbeck, R. B.. Rahden, Westf.: Verlag Marie Leidorf 184-190
Schmidt, J. (1979). XXIX. und XXX. Vorläufiger Bericht über die von dem Deutschen Archäologischen Institut aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft unternommenen Ausgrabungen in Uruk-Warka 1970/71 und 1971/72. Berlin: Gebr. Mann Verlag.
Schmitt, A. W. (2012). Die Jüngeren Ischtar-Tempel und der Nabû-Tempel in Assur. Architektur, Stratigraphie und Funde. Wiesbaden: Harrassowitz.
Schnabel, P. (1923). Berossos und die babylonisch-hellenistische Literatur. Leipzig, Berlin: Teubner.
Schwartz, G. M. (2006). Rezension zu Wäfler 2003. Bibliotheca Orientalis LXIII: 175-176
Selz, G. J. (2013). Religiöse Praktiken im Alten Orient der Frühzeit. In: Uruk. 5000 Jahre Megacity Ed. by N. Crüsemann, M. Ess, M. E., van M.. Petersberg: Imhof 235-239
Sence, G. (2007). Dur-Sharrukin: Le portrait de Sargon II. Revue des études anciennes 109: 429-447
Shakir, B. (2001–2002). The Excavations of Tell al-Namil. Sumer 51: 1-50
Sievertsen, U. (1998). Untersuchungen zur Pfeiler-Nischen-Architektur in Mesopotamien und Syrien von ihren Anfängen im 6. Jt. v. Chr. bis zum Ende der frühdynastischen Zeit. Oxford: J. und E. Hedges.
- (1999). Das Bauwesen im Alten Orient. Aktuelle Fragestellungen und Forschungsperspektiven. In: Fluchtpunkt Uruk. Archäologische Einheit aus methodischer Vielfalt. Schriften für Hans-Jörg Nissen Ed. by H. Kühne, R. Bernbeck, R. B.. Rahden, Westf.: Verlag Marie Leidorf 201-214
- (2002). Private Space, Public Space and Connected Architectural Developments throughout the Early Periods of Mesopotamian History. Altorientalische Forschungen 29: 307-329
- (2003). Synchronismen zwischen Mesopotamien, der Levante und Ägypten in der 2. Hälfte des 4. Jt. v. Chr. Das zeitliche Verhältnis der Urukkultur und Protoelams zur Negade-Kultur. In: Altertumswissenschaften im Dialog. Festschrift für Wolfram Nagel zur Vollendung seines 80. Lebensjahres Ed. by R. Dittmann, C. Eder, C. E.. Alter Orient und Altes Testament 306. Münster: Ugarit-Verlag 467-512
- (2006). Neue Forschungen zur Chronologie der Mittelbronzezeit in Westsyrien im kulturellen Kontext des levantinisch-ostmediterranen Raums: Eine Zwischenbilanz. Damaszener Mitteilungen 15: 9-65
- (in Vorb.). Frühe Gewölbebauten in Mesopotamien. In: Aspekte des Gewölbebaus im Alten Orient - Terminologien, Technologien, Fallstudien Ed. by A. Kose, M. Novák, M. N..
Sollberger, E., J.-R. Kupper (1971). Inscriptions royales sumériennes et akkadiennes. Paris: Le Cerf.
Steible, H. (1982). Die altsumerischen Bau- und Weihinschriften. Stuttgart: Franz Steiner.
- (1991). Die neusumerischen Bau- und Weihinschriften. Stuttgart: Franz Steiner.
Steinkeller, P. (1987). Rezension zu Foster 1982. Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes 77: 182-195
Sténuit, M.-E. (2007). Deux campagnes de restauration architecturale à Tell Beydar/Nabada (automne 2003 – printemps 2004). In: Tell Beydar, The 2000–2002 Seasons of Excavations, the 2003–2004 Seasons of Architectural Restoration. A Preliminary Report Ed. by M. Lebeau, A. Suleiman. Subartu 15. Turnhout: Brepols Publishers 255-309
Stol, M. (1976–1980). Kanal(isation). A. Philologisch. In: Reallexikon der Assyriologie 5 Ed. by E. Ebeling, B. Meissner. Berlin, New York: Walter de Gruyter 355-365
- (2012). Bitumen in Ancient Mesopotamia. The Textual Evidence. Bibliotheca Orientalis LXIX: 48-60
Stone, E. C. (1987). Nippur Neighborhoods. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.
Stone, E. C., P. Zimansky (2004). The Anatomy of a Mesopotamian City: Survey and Soundings at Mashkan-Shapir. Winona Lake: Eisenbrauns.
Strommenger, E. (1957-1971). Grab I. Irak und Iran. In: Reallexikon der Assyriologie 3 Ed. by E. Ebeling, B. Meissner. Berlin, New York: Walter de Gruyter 581-593
- (1980). Habuba Kabira. Eine Stadt vor 5000 Jahren. Mainz: Philipp von Zabern.
Suter, C. E. (2000). Gudea's Temple Building. The Representation of an Early Mesopotamian Ruler in Text and Image. Groningen: Styx Pub.
Taraqji, A. (1999). Nouvelles découvertes sur les relations avec l'Egypte à Tell Sakka et à Keswé, dans la region de Damas. Bulletin de la Société Française d'Égyptologie 144: 27-43
Tunca, Ö. (1984). L'architecture religieuse protodynastique en Mésopotamie. Löwen: Peeters Publishers.
- (1990). „Temple“ ou „bâtiment de prestige“? À propos des temples des périodes d'el-Obed et d'Uruk, et des données ethnoarchéologiques. In: De la Babylonie à la Syrie, en passant par Mari. Mélanges offerts à Monsieur J.-R. Kupper à l'occasion de son 70e anniversaire Ed. by Ö. Tunca. Lüttich: Université de Liège 263-269
Ur, J. (2005). Senacherib's Northern Assyrian Canals: New Insights from Satellite Imagery and Aerial Photography. In: Nineveh. Papers of the XLIXe Rencontre Assyriologique Internationale London, 7–11 July 2003 Ed. by D. Collon, A. George. London: The British School of Archaeology in Iraq 317-345
Vallet, R. (1996). Habuba Kebira (Syrie) ou la naissance de l'urbanisme. Paléorient 22(2): 45-76
Van Beek, G. W. (1997). Der Ursprung des Gewölbebaus. In: Frühe Stadtkulturen Ed. by W. Hoepfner. Heidelberg, Berlin, Oxford: Spektrum Verlag 152-159
Vandersleyen, C. (1975). Das Alte Ägypten. Berlin: Propyläen.
Veenhof, K. R. (1996). Houses and Households in Ancient Mesopotamia. Papers Read at the 40. Istanbul, Leiden: Nederlands historisch-archeologisch instituut te Istanbul.
Vicari, J., F. Brüschweiler (1985). Les ziggurats de Tchoga-Zambil (Dur-Untash) et de Babylone. In: Le dessin d'architecture dans les sociétés antiques. Actes du Colloque de Strasbourg 26–28 janvier 1984 Straßburg: Univ. des Sciences Humaines 47-57
Villard, P. (2006). Les descriptions des maisons néo-assyriennes. In: Les espaces syro-mésopotamiens, Dimensions de l'expérience humaine au Proche-Orient ancien, Volume d'hommage offert à Jean-Claude Margueron Ed. by P. Butterlin, M. Lebeau, M. L.. Subartu 17. Turnhout: Brepols Publishers 521-528
Waetzoldt, H. (1990). Zu den Bewässerungseinrichtungen in der Provinz Umma. Bulletin on Sumerian Agriculture V: 1-29.
Wäfler, M. (2003). Tall al-Hamidiya 4. Vorbericht 1988–2001. Freiburg, Göttingen: Academic Press Fribourg, Vandenhoeck & Ruprecht.
Walker, C. B. F. (1991). Wissenschaft und Technik. In: Der Alte Orient. Geschichte und Kultur des alten Orients Ed. by B. Hrouda. Gütersloh: C. Bertelsmann 247-269
Wartke, R.-B. (2002). Werkzeuge. Alter Orient und Ägypten. In: Der Neue Pauly 12/2 Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler 481-483
Watelin, L. C., S. H. Langdon (1934). Excavations at Kish IV 1925–1930. Paris: Libr. Orientaliste P. Geuthner.
Weiss, H. (1997). Leilan, Tell. In: The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East 3 Ed. by E. M. Meyers. Oxford: Oxford University Press 341-347
Weitemeyer, M. (1962). Some Aspects of the Hiring of Workers in the Sippar Region at the Time of Hammurabi. Kopenhagen: Munksgaard.
Werner, P. (1994). Die Entwicklung der Sakralarchitektur in Nordsyrien und Südostkleinasien vom Neolithikum bis in das 1. Jt. v. Chr.. München, Wien: Profil.
- (1998). Tall Munbaqa. Bronzezeit in Syrien. Neumünster: Wachholtz.
Westenholz, A. (1984). Rezension zu Foster 1982. Archiv für Orientforschung 31: 76-81
- (1987). Old Sumerian and Old Akkadian Texts in Philadelphia II: The ‚Akkadian‘ Texts, the Enlilemaba Texts, and the Onion Archive. Kopenhagen: Museum Tusculanum Press.
- (1999). The Old Akkadian Period: History and Culture. In: Mesopotamien. Akkade-Zeit und Ur III-Zeit Ed. by W. Sallaberger, A. Westenholz. Orbis Biblicus et Orientalis 160/3. Freiburg, Göttingen: Universitätsverlag Fribourg, Vandenhoeck & Ruprecht 17-117
Wilcke, C. G. (1991). Schrift und Literatur. In: Der Alte Orient. Geschichte und Kultur des alten Vorderasien Ed. by B. Hrouda. Gütersloh: C. Bertelsmann 271-297
Wilhelm, G. (1991). Geschichte: Hethiter und Hurriter. In: Der Alte Orient. Geschichte und Kultur des alten Vorderasien Ed. by B. Hrouda. Gütersloh: C. Bertelsmann 85-112
Wilkinson, T. J., N. Galiatsatos, N. G., Lawrence N., L. N., D. Lawrence (2012). Late Chalcolithic and Early Bronze Age Landscapes of Settlement and Mobility in the Middle Euphrates: A Reassessment. Levant 44: 139-185
Wiseman, D. J. (1972). A Babylonian Architect?. Anatolian Studies 22: 141-147
Wittfogel, K. A. (1962). Die orientalische Despotie. Eine vergleichende Untersuchung totaler Macht. Köln: Kiepenheuer & Witsch.
Wittke, A.-M. (2006). Einige Bemerkungen zu Erdbeben und ihrer Verknüpfung mit religiösen Vorstellungen. Baghdader Mitteilungen 37: 531-547
Woolley, C. L. (1934). Ur Excavations II. The Royal Cemetery. A Report on the Predynastic and Sargonid Graves Excavated between 1926 and 1931. London: British Museum Press.
- (1974). Ur Excavations VI. The Buildings of the Third Dynasty. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Wright, G. R. H. (2000). Ancient Building Technology. Historical Background. Leiden: Brill.
Yon, M. (2006). The City of Ugarit at Tell Ras Shamra. Winona Lake: Eisenbrauns.
Zagarell, A. (1986). Trade, Women, Class, and Society in Ancient Western Asia. Current Anthropology 27: 415-430
Fußnoten
Nippa 1991, 33–48; Moorey 1994, 302ff.; Sauvage 1998, 11ff.; Pütt 2005, 8ff..
Heinrich 1957, 11ff.; Nippa 1991, 49–60.
Moorey 1994, 335ff.; Werner 1994, 153, 155f., 165–169, 171f.; Werner 1998, 52ff.; Pfälzner 2001, 112f.; Elsen-Novák and Novák 2006b, 63ff.; Otto 2006, 14f., 151ff.; Yon 2006, 27ff..
Nissen 1988, 65ff.; Mieroop 1997, 23ff.; Oates 2002, 111ff.; Akkermans and Schwartz 2004, 181ff.; Mieroop 2004, 19ff.; Oates and Oates 2006, 33ff.; Pollock 2013, 149ff.
Driel and van 1979, 16ff.; Driel and van 1983, 6ff.; Vallet 1996, 45ff.
Heinrich 1982, 35ff.; Eichmann 2007, 33ff.
Nissen 1988, 129ff.; Edzard 1991, 55ff.; Liverani 1993; Mieroop 2004, 39ff.; Saggs 2005, 76ff.
Nissen 1988, 186f.; Neumann 1993, 25; Suter 2000, 90.
Insbesondere für die Zeit vor der Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr. ist die altorientalische Chronologie noch sehr unsicher und es kommen verschiedene Chronologiesysteme zur Anwendung, die im Extrem um mehr als 200 Jahre differieren. Vgl. hierzu zuletzt Sallaberger 2004, 15ff.; Radner 2005, 8f.; Roaf 2012, 147ff.. Ich verwende im Folgenden das Datengerüst der sog. „Mittleren Chronologie“, wie es etwa bei Frankfort 1996, 416; Mieroop 2004, 281ff.; Saggs 2005, 211f. vorzufinden ist, allerdings lediglich im Sinne einer Konvention. Persönlich tendiere ich zu Daten, die zwischen den Systemen der „Kurzchronologie“ und der „Mittleren Chronologie“ liegen, wozu im Einzelnen auf Sievertsen 2006, 9ff. verwiesen sei. Für die mittel- und neuassyrischen Herrscher ab Assur-nirari II. (1414–1408 v. Chr.) gebe ich die Regierungszeiten entsprechend Cancik-Kirschbaum (2003, 124) an.
Edzard 1991, 70ff.; Wilhelm 1991, 94ff.; Martino 2004, 35ff.; Mieroop 2004, 80ff.; Saggs 2005, 112ff.
Kessler 1991, 123ff.; Cancik-Kirschbaum 2003, 56ff.; Mieroop 2004, 197ff.
Edzard 1972–1975, 223f.; Heinrich 1972–1975, 176ff.; Stone 1987; Castel 1992; Novák 1994, 341ff.; Veenhof 1996; Castel et.al. 1997; Radner 1997, 249ff.; Battini-Villard 1999; Miglus 1999; Brusasco 1999–2000; Pfälzner 2001; Akkermans and Schwartz 2004, 181ff.; Jahn 2005; Battini 2006, 73ff.; Faist 2006, 471ff.; Villard 2006, 521ff.; de Graef 2011, 174ff.
Heinrich 1982; Tunca 1984; George 1993; Werner 1994; Akkermans and Schwartz 2004, 181ff.; Lebeau 2006, 101ff.
Allinger-Csollich 1991, 383ff.; Schmid 1995; Sauvage 1999, 45ff.; Ess 2001; Pfälzner 2008, 396ff.
Vgl. einstweilen Lackenbacher 1982; Lackenbacher 1990; Moorey 1994, 302ff.; Sauvage 1998; Sievertsen 1999, 201ff.; Dunham 2005, 266ff.; Wright 2000.
An dieser Stelle sei gleichfalls auf die grundlegende Kritik der Schriftquellen zum altorientalischen Bauwissen in dem Beitrag von Markus Hilgert verwiesen.
Schnabel 1923, 253; Farber-Flügge 1973, 24, 56ff.; Burstein 1978, 13f.; Ambos 2004, 5.
Sauvage 1998, 73f.; Ambos 2004, 3f., 29–36.
Bezüglich der Rituale beim Wohnhausbau vgl. im Einzelnen Ambos 2004, 63f..
Für die Durchsicht und sprachliche Korrektur der akkadischen Begriffe in meinem Beitrag danke ich sehr herzlich Rosel Pientka-Hinz.
Ellis 1968, 9–12, 16f.; Heinrich 1982, 117; Suter 2000, 88f..
Zu Kulla, Mušda(ma) sowie dem Töpfer- und Backsteingott Nunurra vgl. im Einzelnen Ellis 1968, 18–20; Ambos 2004, 21ff.. Der Verantwortungsbereich von Kulla umfasste gemäß dem sumerischen Mythos „Enki und die Weltordnung“ zunächst lediglich die Ziegelherstellung, während der eigentliche Hausbau mit den unter Verwendung einer Messleine durchgeführten Vermessungsarbeiten sowie der Errichtung der Fundamente in die Zuständigkeit von Mušda(ma) fiel. Im 1. Jahrtausend v. Chr. leitete Kulla hingegen als Architektengott den gesamten Bauprozess.
Ellis 1968, 35ff., 153ff.; Rashid 1983; Ess 2013d, 80f..
Steinkeller apud Stone and Zimansky 2004, 135ff. Abb. 78–100.
Russell 1992, 175–190 Abb. 93–101; Russell 1998, 655ff.; Ambos 2004, 82f.; Otto 2006, 244.
Ellis 1968, 20f.; Hansen apud Orthmann 1975, 188 Abb. 85. Vgl. ebenfalls noch Suter 2000, 213.
Ellis 1968, 22f.; J. Börker-Klähn apud Orthmann 1975, 203–205 Abb. 37–38, 115–116; Moorey 1994, 303 Abb. 19; Suter 2000, 217–220; Bonatz 2012, 307ff.. Siehe hinsichtlich der Deutung der auf der Urnammu-Stele abgebildeten Insignien Ring und Stab als Maßband und Messstab zuletzt Elsen-Novák and Novák 2006a, 137f. Abb. 3–5; Bonatz 2012, 320f..
Lackenbacher 1982, 139f.; Russell 1992, 224f..
Ellis 1968, 32f.; Russell 1992, 226; Ambos 2004, 79–82.
Schmid 1995, 84. Immerhin gibt es einige archäologische Indizien, etwa eine Abfolge übereinander liegender Fußböden oder erhaltene Rauminventare, wie sie v. a. in Zerstörungskontexten auftreten, die die Fertigstellung und Nutzung eines Gebäudes zweifelsfrei absichern.
Ellis 1968, 20ff.; Lackenbacher 1990, 39f., 62; Hruška 1999, 217ff.; Suter 2000; Ambos 2004, 4; Bonatz 2012, 321.
Heinrich 1982, 35ff.; Neumann 1996, 156; Sievertsen 1998, 29ff., 241ff.; Eichmann 2007.
Ein Überblick über den Forschungsstand und die hauptsächlichen Quellengruppen von der frühdynastischen bis zur Achämenidenzeit (6.–4. Jh. v. Chr.) findet sich bei Bagg 2000, 10–12, 284f., Anm. 308–310.
Stol 1976–1980, 355ff.; Nissen 1988, 95f., 129f., 141f., 144f.; Renger 1990, 31ff.; Borowski 1997, 182f..
Petschow 1965, 164f.; Petschow 1957–1971, 266.
Petschow 1965, 164f.; Petschow 1957–1971, 266; Neumann 1996, 153, 163f.. Dem Baumeister, der durch unsachgemäße Bauausführung einen Hauseinsturz und damit den Tod des Hauseigentümers verschuldete, drohte nach dem Rechtsstandard des Codex Hammurapi die Talionsstrafe. Im Falle der Tötung eines Sklaven oder des Verlusts von sonstigem Eigentum des Bauherrn musste gleichwertiger Ersatz gestellt werden. Das eingestürzte Gebäude war vom Baumeister auf eigene Kosten wiederherzustellen.
Baumgartner 1925, 29ff., 123ff., 219ff.; Falkenstein 1966a, 229ff.; Dunham 1986, 31ff..
Falkenstein 1966b, 68f.; Bonatz 2012, 322f..
Vgl. Miglus 1999, 75f.; Jahn 2005, 142ff., 150.
Allgemein vgl. zur – oft auch nur partiell ausgeführten – Mehrstöckigkeit altorientalischer Bauten ebenfalls noch Radner 1997, 271f.; Werner 1998, 66ff. Abb. 54–55, 69–70; Battini-Villard 1999, XXVIII, 403f.; Margueron 1999, 197–199; Miglus 1999, 231; Oates and Oates 2001b, 212; Pfälzner 2001, 130–134; Gurdil 2005, 240–246; Otto 2006, 16–18 Abb. 16; Villard 2006, 526f.; Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2007, 158, 163, 167; Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2008, 20–45, 73f.; Pfälzner 2009a, 4; Pfälzner 2009b, 171; Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2011, 5f., 10–28.
Zu den überlieferten Zeichnungen, die verschiedenen Zwecken und nicht ausschließlich der Bauplanung gedient haben, vgl. Heinrich and Seidl 1967, 24ff.; Wiseman 1972, 141ff.; Schmid 1985, 289ff.; Eichmann 1991, 95; Heisel 1993, 7–75; Schmid 1995, 137–146; Sauvage 1998, 75f.; Miglus 1999, 217ff.; Sievertsen 1999, 205 und Keetman 2011, 169ff. sowie den Beitrag von Claudia Bührig im vorliegenden Band. Die altorientalischen Architekturmodelle dienten nicht als Vorbilder beim Bauen. Sie spiegeln vielmehr gebaute Architektur wider und sind gemäß Bretschneider 1991 im offiziellen Tempelkult, im privaten Hauskult und im Totenkult zum Einsatz gekommen. Weitere Ausführungen zu den Modellen finden sich bei Miglus 1999, 231f.; Muller and Vaillancourt 2001; Muller 2002; Rouault 2004, 271–276 und Porter and McClellan 2006, 91f..
Vgl. hierzu im Einzelnen Robson 1996, 181ff.; Robson 1999, 57–92, 145–157 ; Friberg 2001, 61–154 sowie den Beitrag von Rosel Pientka-Hinz im vorliegenden Band.
Heinrich 1982, Abb. 108, 113, 121; Eichmann 2007, 159ff., 218ff., 363ff.; Ess 2012, 185; Eichmann 2013, 121f.; Ess 2013a, 128f..
Oates 1990, 391ff.; Oates 2007, 173–175.
Vgl. zu den Stiftmosaiken lediglich Brandes 1968, 136.
Siehe hierzu auch den Beitrag von Dietmar Kurapkat im vorliegenden Band.
Heinrich 1982, 45, 70, 78f., 117, 120, 139f.; Heinrich 1984, 37–43; Miglus 1989, 93–133; Sauvage 1998, 51–53; Pedde 2003, 119–121; Eichmann 2007, 238, 364ff.; Pedde and Lundström 2008; Reade 2009, 654. Bei Miglus (1989, 127–133) finden sich ebenfalls einige Überlegungen zum Entwurf des „Urplans“ und des „Lehmziegelfundamentplans“ des Alten Palasts von Assur. Er nimmt an, dass neben den Gesamtabmessungen des Gebäudes zunächst die Abmessungen und Proportionen einiger besonders wichtiger, in sich abgeschlossener Bauteile festgelegt worden sind.
Zu einer vierten Konstruktionsweise vgl. jetzt ebenfalls noch Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2011, 29–33.
Lackenbacher 1990, 36f.; Fadhil 1993, 271ff.; Parpola 1995, 67; Wittke 2006, 531ff..
Miglus 1999, 3ff., 245ff.; Pfälzner 2001, 3ff.
Suter 2000, 71ff.; Bonatz 2012, 323f..
Heinrich 1984, 172f.; Lackenbacher 1990, 50–54.
Ess 2001, 326; Nissen 2006, 61ff.; Bonatz 2012, 324f..
Lackenbacher 1990, 56f.; Porter 2003.
Eine abweichende Auffassung vertritt George 1992, 109–119, 414–434; George 2008, 128–130.
Vgl. im Einzelnen Eichmann 2007, 320f., 488–490; Ess 2013b, 233.
Siehe zur Umrechnung Schmid 1995, 49, 51, 78.
Mieroop 1997, 52ff.; Meyer 2007, 129ff.; Becker et.al. 2013, 355ff..
Strommenger 1980, 33ff.; Vallet 1996, 45ff..
Maul 1997, 109ff.; Novák 1999, XVIIff., 91ff., 141ff.; Novák 2012, 297ff.; Ess 2013c, 228.
Moorey 1994, 5f.; Potts 2013, 256–258.
Moorey 1990, 62ff.; Sievertsen 2003, 477ff.; Butterlin 2013, 205ff..
Orthmann 1975, 320 Abb. 223; Albenda 1983, 103ff.; Linder 1986, 273ff.; Moorey 1994, 353f.; Parpola 1995, 60.
Lackenbacher 1990, 76f.; Parpola 1995, 55–57.
Zu einem möglichen archäologischen Nachweis derartiger Baustelleneinrichtungen im frühsumerischen Eannabezirk von Uruk vgl. Eichmann 2013, 122.
Schmid 1995, 91. Zu unlängst durchgeführten extensiven Arbeitsaufwandsberechnungen in Verbindung mit mittanizeitlicher Monumentalarchitektur aus Tell el-Hamidiya (Mitte des 2.Jt. v. Chr.) vgl. jetzt ebenfalls noch Wäfler 2003 sowie die Besprechung bei Schwartz 2006, 175.
Vgl. in diesem Zusammenhang auch Faist 2006, 471ff..
Ellis 1968, 17f.; Moorey 1994, 304f.; Ambos 2004, 22.
Vgl. hierzu zuletzt Eichmann 2007, 358.
Vgl. hierzu im vorliegenden Band den Beitrag von Dietmar Kurapkat.
Behm-Blancke 1989, 73ff.; Moorey 1994, 309f.; Eichmann 2007, 371–374; Ess 2012, 184–186; Ess 2013a, 128f.. Funde aus Buto im westlichen Nildelta deuten darauf hin, dass die Technik des Wanddekors aus Tonstiften während der späten Urukzeit über Nordsyrien bis nach Ägypten gelangt ist, auch wenn der letzte Beweis hierfür noch nicht erbracht ist. Vgl. im Einzelnen Sievertsen 2003, 486–489.
Oates 1990, 391ff.; Moorey 1994, 310–312; Sauvage 1998, 137f.; Oates 2007, 173–175.
Nunn 1988, 160ff.; Moorey 1994, 315–317, 319–321.
Schmidt 1979, 13–25; Heinrich 1982, 67f.; Eichmann 2007, 438ff.; Eichmann 2013, 120.
Siehe zuletzt Gilibert 2004, 373ff..
Vgl. Novák 2004, 335ff..
Damerji 1987; Margueron 1992, 79ff.; Moorey 1994, 347–361 Abb. 19; Schmid 1995, 70, 79, 81–85; Eichmann 2007, 236, 244f.; Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2008, 18, 65–71, 73; Pfälzner 2009a, 4; Pfälzner 2009b, 167f., 170; Pfälzner 2009c, 175; Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2011, 6, 51–55; Bonatz 2012, 320; Eichmann 2013, 120; Ess and van 2013a, 58f..
Ess 2001, 32–43, 59–61, 239f.; Ess 2013c, 226f..
Moorey 1994, 361f.; Schmid 1995, 69; Margueron 1997a, 332.
Vgl. hierzu auch Heinrich 1957–1971, 339f..
Vgl. zu weiteren Belegen aus Tell Beydar und Tell Brak ebenfalls noch Debruyne 1997, 145f. Abb. 2–3; Oates and Oates 2001a, 57–61, 66, 73, 80, 85f., 88f. Abb. 62, 64–67, 70, 72, 74, 77, 79, 81–82, 91, 103, 115, 121; Sténuit 2007, 255, 263 Abb. 45–46.
Vgl. Pütt 2005, passim..
Vgl. Heinrich 1957–1971, 338–340 sowie ebenfalls noch Heinrich 1982, 174f., 191f., 200 Abb. 260, 264, 287, 291.
Heinrich and Seidl 1968, 25ff.; Heinrich 1957–1971, 338–340; Heinrich 1984, 90, 207–209, 214f.; Sauvage 1998, 64, 151; Miglus 1999, 20f..
Wittfogel 1962. Kritisch hierzu Adams 1974, 10; Bernbeck 1995, 61.
Neumann 1992, 273f.; Neumann 1996, 158.
Der Baumeister Ur-Igalim aus Umma ist im zweiten Jahr des Šusin als šidim, im sechsten Jahr des Šusin jedoch bereits als ugula-šidim und als šidim-gal bezeugt, während der Baumeister Lu-Utu aus Girsu im vierten Jahr des Amar-Su’ena als šidim und im dritten Jahr des Šusin als nu-bànda-šidim auftritt.
Parpola 1995, 55f.. Vgl. darüber hinaus ebenfalls noch Baker 2005, 7ff..
Nagel 1958, 1ff.; Czichon 1992, 16, Anm. 29.
Zu älteren Belegen des gugallu und weiterer in Verbindung mit den Wasserbauten bezeugter Beamten, vgl. Renger 1990, 39.
Sauvage 1998, 82. Vgl. zu Bauprozessrelevanten Berechnungen im Kontext der altorientalischen Ziegelbauweise ferner auch Robson 1996, 181ff..
Nippa 1991, 32, 34ff.; Pfälzner 2001, 397–399.
Wilcke 1991, 295; Matthews 1995, 455ff.; Suter 2000, 151–153.
Neumann 1996, 162f.; Sauvage 1998, 80.
Heinrich 1982, 1ff.; Moorey 1994, 302, 335f., 361f.; Sauvage 1998, 13, 138, 151, 157f.; Miglus 1999, 257f..
Günstige Ausgangsbedingungen für die archäologische Bestimmung von Werkstatttraditionen bieten seit ihrer umfassenden Publikation durch Eichmann 2007 die großflächig und in längeren Schichtensequenzen erfassten sowie in steingerechten Plänen dokumentierten Befunde späturukzeitlicher Großarchitektur im Eanna- und Anubezirk von Uruk. Ansonsten vgl. ebenfalls noch Schachner 2007, 19–22, 105–109 zur Anfertigung des berühmten Bronzetors C von Balawat aus der Zeit Salmanassars III. (858–824 v. Chr.) im bīt mummê sowie Reade 1995, 228f. zu kontemporären Glasurziegeldekoren mutmaßlich unterschiedlicher Werkstätten im ekal māšarti von Kalhu.
Nunn 1988, 142ff.; Moorey 1994, 315ff.; Sauvage 1998, 29ff..
Heinrich and Seidl 1967, 24ff.; Wiseman 1972, 141ff.; Schmid 1985, 289ff.; Eichmann 1991, 95; George 1992, 109–119; Heisel 1993, 7–75; Schmid 1995, 137–146; Sauvage 1998, 75f.; Miglus 1999, 217ff.; Sievertsen 1999, 205; George 2008, 128–130.
Vgl. Elsen-Novák and Novák 2006a, 137f.; Bonatz 2012, 320f..
Zum Nachweis der Schnürtechnik in einem urukzeitlichen Grabungsbefund aus Uruk vgl. Ess 2013b, 233 Abb. 38.4–5.
Ellis 1968, 20ff.; Lackenbacher 1982, 130f.; Moorey 1994, 305; Sauvage 1998, 74f.; Suter 2000, 91.
Moorey 1994, 353–355. Mit Blick auf die Holzbearbeitung vgl. jetzt ebenfalls noch Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2008, 18, 65–71, 73; Pfälzner 2009c, 175 und Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2011, 6, 51–55 zu den Feuchtholzfunden aus dem Brunnen im Königspalast von Qatna.
Heinrich 1982, 45ff., 70ff.; Eichmann 2007, 33ff.; Eichmann 2013, 118ff..
Strommenger 1980, 31ff.; Vallet 1996, 45ff..
Schmid 1995, 103ff.; Ess 2001, 323ff.; Ess 2013c, 225ff.
Margueron 1982, 209ff.; Heinrich 1984, 68ff.; Margueron 1997b, 415f.; Akkermans and Schwartz 2004, 314–316.
Heinrich 1984, 145ff., 170ff.; Novák 1999, 141ff..
Heinrich 1984, 203ff.; Novák 1999, 98f., 104.
Aurenche 1977, 88; Heinrich 1984, 13f.; Sauvage 1998, 51ff.; Pedde 2003, 119ff.; Elsen-Novák and Novák 2006b, 63ff.; Eichmann 2007, 238.
Heinrich 1984, 199ff.; Novák 1999, 98f., 104.
Heinrich 1957–1971, 323ff.; Besenval 1984, 159ff.; Miglus 1999, 20f., 105, 139; Pfälzner 2001, 116ff., 129f.; Novák and Schmid 2001, 205ff.; Sievertsen in Vorb..
Parpola 1995, 55f.; Neumann 1996, 153; Robson 1996, 181ff.. Vgl. hierzu im Einzelnen den Beitrag von Rosel Pientka-Hinz im vorliegenden Band.
Petschow 1965, 164f.; Petschow 1957–1971, 266; Neumann 1996, 153, 163f.; Mieroop 2004, 106–108.
Heinrich 1982, 23ff.; Forest 1987, 385ff.; Margueron 1987, 349ff.; Sievertsen 1998, 19–28, 30–34, 185–191, 239–242, 278–280, 301f.; Sievertsen 1999, 206f..
Brandes 1968, 9ff.; Heinrich 1982, 45ff., 70ff.; Sievertsen 1998, 43ff., 244ff., 303f.; Eichmann 2007, 33ff.; Eichmann 2013, 118–122.
Nissen 1988, 65ff.; Nissen et.al. 1990, 47ff.; Edzard 1991, 55ff.; Bernbeck 1995, 57ff.; Pollock 1999, 175ff.; Sievertsen 2002, 311ff.; Bretschneider et.al. 2007, 1; Selz 2013, 235ff..
Nissen 1988, 93; Moorey 1994, 307f.; Sauvage 1998, 115ff.; Eichmann 2007, 15ff.; Ess 2013b, 232.
Heinrich 1984, 9–28; Tunca 1990, 263ff.; Schmid 1992, 190ff.; Sievertsen 2002, 315f.; Eichmann 2007, 188–204; Eichmann 2013, 122–127; Selz 2013, 239.
Heinrich 1982, 137ff.; Heinrich 1984, 29ff.; Neumann 1996, 157f.; Novák 1999, 79–84; Buccellati and Kelly-Buccellati 2000, 133ff.; Buccellati and Kelly-Buccellati 2001, 59ff.; Oates and Oates 2001a, 15ff.; Buccellati and Kelly-Buccellati 2002, 103ff.; Akkermans and Schwartz 2004, 233ff.; Buccellati and Kelly-Buccellati 2004, 13ff.; Mieroop 2004, 59ff.; Oates 2007, 165ff.; Pfälzner 2008, 413; Eichmann 2013, 126f.; Ess 2013c, 226.
Ess 2001, 323ff.; Nissen 2006, 61ff.; Ess 2013c, 225ff..
Vgl. Ambos 2004, 49.
Für das „Stampflehmgebäude“ in Uruk ist gemäß Eichmann 2013, 126f. u. U. auch eine frühakkadische Datierung denkbar.
Margueron 1982, 35ff., 107ff., 209ff.; Heinrich 1984, 14ff., 25ff., 68ff.; Lackenbacher 1990, 37; Schmid 1992, 190ff.; Akkermans and Schwartz 2004, 314–316; Margueron 2004, 431ff.; Radner 2005, 96ff., 272.
Heinrich 1984, 97ff.; Eickhoff 1985; Albenda 1986; Russell 1992; Novák 1999, 120ff.; Bagg 2000, 36ff., 95ff., 147ff., 169ff.; Sence 2007, 429ff..
Heinrich 1984, 114ff., 170–173; Lackenbacher 1990, 39; Novák 1999, 110ff., 124ff., 137f., 148ff., 159ff.; Oates and Oates 2001b, 144ff..
Eine Beschriftung von Ziegeln ist erstmals während der späten frühdynastischen Zeit in Girsu und Lagaš zu belegen. Sie stellte in Mesopotamien weitgehend ein Prärogativ des Herrschers dar. Vgl. im Einzelnen Sauvage 1998, 38ff., 122ff..
Ellis 1968, 20ff.; Schmid 1995, 80; Ambos 2004, 68, 77.
Heinrich 1984, 68, 74ff. Abb. 40; Taraqji 1999, 35ff. Abb. 7, 9–11; Novák and Pfälzner 2000, 260–264, 275–279; Akkermans and Schwartz 2004, 318; Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2006, 71–78; Elsen-Novák and Novák 2006b, 63f. Abb. 1; Sievertsen 2006, 23, 32–35; Dohmann-Pfälzner and Pfälzner 2007, 164ff. Abb. 23; Pfälzner 2009b, 165ff..
Mallowan 1978, 155ff.; Moorey 1994, 336, 346.
Im Einzelnen vgl. den Beitrag von Rosel Pientka-Hinz im vorliegenden Band.
Ludwig 1980, 63ff.; Strommenger 1980, 14f., 61f.; Hemker 1993, 30f., 82, 120f.; Bernbeck 1995, 60, 64f.; Böhme and Kulemann 1995, 91ff.; Gut 1995, 222f., 285; Kohlmeyer 1996, 89ff.; Lupton 1996, 66ff.; Vallet 1996, 45ff.; Buccellati 1997, 127; Sievertsen 1998, 223ff., 294ff.; Pfälzner 2001, 104ff., 395f.; Gut 2002, 22f. Abb. 21; Heinz 2002, 56–66; Akkermans and Schwartz 2004, 181ff., 211ff.; Cooper 2006, 8ff., 278–281; Parker 2006, 155ff.; Meyer 2007, 129ff.; Porter 2012, 1ff.; Wilkinson et.al. 2012, 139ff.; Butterlin 2013, 211.